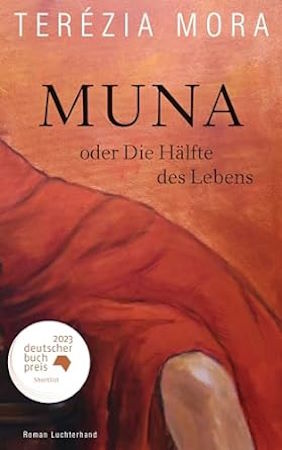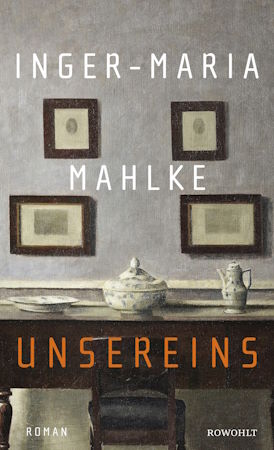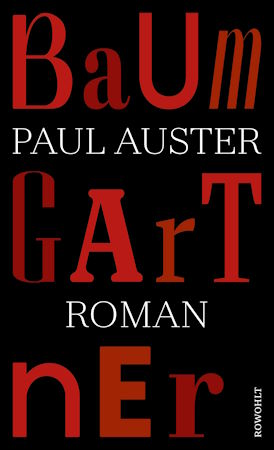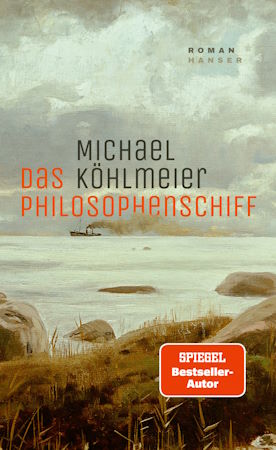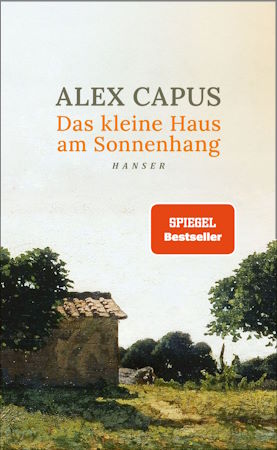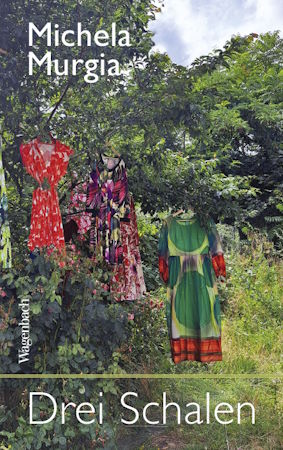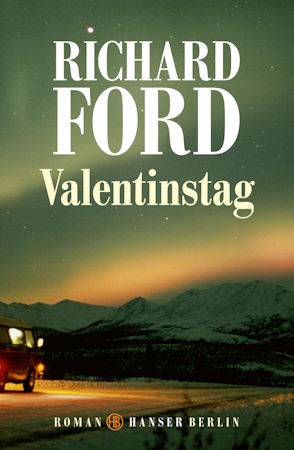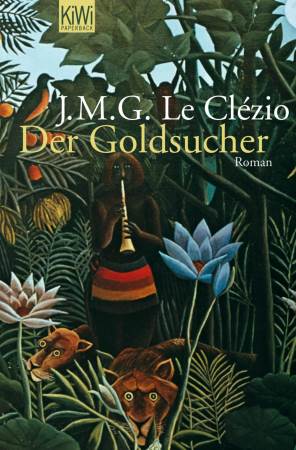John Banville : Geister
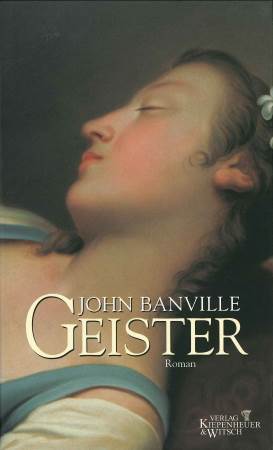
Inhaltsangabe
Kritik
Der Ich-Erzähler, dessen Namen wir nicht erfahren, war wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aufgrund seiner guten Führung entließ man ihn nach zehn Jahren aus dem Gefängnis.
In einer Kneipe traf er sich mit Billy, einem früheren Mithäftling, der einem Kerl den Bauch aufgeschlitzt hatte, weil dieser verbal über seine Schwester hergezogen war. Er rief seine Ex-Frau an, aber sie wollte ihn nicht sehen. Dann überredete er Billy, ihn nach Coldharbour zu bringen. Unterwegs fuhren sie bei seinem früheren Elternhaus vorbei, in dem jetzt seine von ihm geschiedene Frau wohnte. Er brach in das Haus ein und sah sich darin um. Dabei wurde er von seinem inzwischen siebzehn- oder achtzehnjährigen Sohn Van überrascht, der jedoch nichts gegen ihn unternahm.
In Coldharbour ging er an Bord eines Schiffes, das ihn zu einer 15 km langen und 8 km breiten Insel brachte, wo er sich mit einem Empfehlungsschreiben von Anna Behrens, der Witwe des Kunstsammlers Helmut Behrens, zu dem früher renommierten Kunsthistoriker Silas Kreutznaer begab. Das alte, abgelegene Haus, in dem dieser wohnte, gehörte nicht dem Professor, sondern seinem Faktotum Lux, dessen Alter der Ich-Erzähler auf „zwischen 25 und 50“ schätzte.
Ich hatte alles abgeworfen, was ich nur hatte abwerfen können, außer der Existenz als solcher. (Seite 44)
Er hatte Kreutznaer schon einmal vor zwanzig Jahren in einer Galerie in Whitewater kennen gelernt, aber der Kunstexperte erinnerte sich nicht mehr an ihn. Kreutznaer nahm ihn auf; er sollte ihm bei der Arbeit an einem Werk über das Leben und die Kunst des niederländischen Malers Jean Vaublins helfen.
Aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, war uns beiden daran gelegen, an der Behauptung festzuhalten, dass ich lediglich sein Gehilfe sei, die Wahrheit aber ist, ehe ich noch recht wusste, wie mir geschah, hatte er mir die Aufgabe ganz allein übertragen. (Seite 54)
Zweimal in der Woche musste der Ich-Erzähler sich in dem 2 km vom Hafen entfernten einzigen Dorf bei Sergeant Toner melden, dem einzigen Polizisten auf der Insel.
Kurz nach seiner Ankunft lernte er die aus Holland oder Südafrika stammende Witwe Vanden kennen, deren einziges Kind, die Tochter Dickie, vor zwanzig Jahren gestorben war. Bei einem seiner Besuche fand er Mrs Vanden tot in ihrem Bett. Da fiel ihm auf, dass er nicht einmal ihren Vornamen kannte. Er stöberte in ihren Sachen herum, fand aber keine Hinweise auf ihre Vergangenheit.
Sie hatte alles über Bord geworfen und nur das absolut Notwendige behalten. Verglichen mit ihrem Leben war das meine noch immer randvoll mit dem Treibgut früherer, untergegangener Leben. (Seite 119)
Eines Tages sucht eine Gruppe von sieben gestrandeten Urlaubern Zuflucht im Haus des Professors bzw. seines Faktotums. Gegen den Willen Kreutznaers lässt Lux die Schiffbrüchigen herein: einen Greis namens Croke, die Blondine Flora, die behauptet, einundzwanzig zu sein, aber höchstens achtzehn oder neunzehn Jahre alt ist, Felix, „ein dünner, geschmeidiger, blässlicher Mann mit schlechten Zähnen, schwarzgefärbtem Haar und düster-wachsamem Blick“, die Fotografin Sophie, die einen Bildband mit dem Titel „Tableaux morts“ plant und im Rahmen eines Sommerjobs in einem Hotel am Festland auf die Kinder Hatch, Pound und Alice aufpassen soll. Flora und Felix lernten sich erst am Vortag kennen, und die junge Frau weiß inzwischen nicht mehr, warum sie Felix nachts in ihr Hotelzimmer ließ und sie im Bett einen Orgasmus vortäuschte.
Kreutznaer kennt Felix von früher, aus Whitewater, und er fürchtet sich vor ihm, aber der Besucher beruhigt ihn:
„Warum sollte ich Ihnen etwas antun wollen? Nein: Sie sind doch schließlich meine goldene Gans.“ (Seite 166)
Der Ich-Erzähler weicht den Besuchern den ganzen Tag über aus. Auch er kennt Felix von früher. Der erzählt ihm, Anna Behrens sei einer Fälschung aufgesessen, weil Professor Kreutznaer das Gemälde für echt erklärt und mit dieser Expertise viel Geld verdient habe.
Und so sitze ich also an dem alten Fichtenholztisch, in jenem Licht, und vor mir steht das Frühstück, und ich – in der einen Hand einen Becher starken Tee und in der anderen ein Buch, während mein Geist müßig den eigenen Gedanken nachhängt. Lux und der Professor sind noch im Bett – sie sind beide Langschläfer –,
und ich, ich glaube, ich genieße diese Stunde des Alleinseins, wenn Genuss das rechte Wort ist für einen solchen neutralen Zustand schlichten Sichtreibenlassens. Auftritt Flora. Sie war barfuß, hatte wie gewöhnlich die Schultern hochgezogen und die Hände tief in den Taschen von Lux‘ altem Regenmantel vergraben. Sie setzte sich an den Tisch, und ich deutete stumm auf die Teekanne, und sie nickte, und ich goss ihr Tee ein. Wie üblich. Wir treffen uns oft so beim Frühstück; wir sprechen nie. Wie beredt sind doch in solchen Augenblicken die Geräusche, die all die kleinen Dinge machen, das Strudeln, wenn der Tee eingeschenkt wird, das Klacken und das gedämpfte Klappern des Geschirrs, der plötzliche, silberhelle Ton, wenn ein Löffel auf den Rand einer Untertasse schlägt. Und auf einmal, ohne Vorwarnung, fing sie an zu reden. Oh, ich weiß nicht, worüber, auf den Sinn habe ich kaum geachtet; irgendwas von einem Traum oder einer Erinnerung, wie sie als Kind an einem Sommernachmittag auf einer hügeligen Straße unterhalb einer Klostermauer stand und über die Dächer der Stadt auf das ferne Meer blickte, während ein Junge, der schwachsinnig war, um sie herumhüpfte und ihr Fratzen schnitt. Der Inhalt war nicht wichtig, ich glaube, für uns beide nicht. Das, was sie interessierte, war dasselbe, was mich interessierte, nämlich … nämlich was? Wie die Gegenwart von der Vergangenheit zehrt oder von den Interpretationen der Vergangenheit. Wie im trüben Wasser der Erinnerung plötzlich Teile der verlorenen Zeit an die Oberfläche kommen, hell und klar und unglaublich detailliert, kleine, vollkommene Inseln, und es möglich scheint, dort zu leben, und sei es auch nur für einen Augenblick. Und während sie redete, ertappte ich mich dabei, wie ich sie betrachtete und sie zum allerersten Mal nicht als eine Anhäufung von Details sah, sondern ganz aus einem Guss, fest und einzigartig und wie ein Wunder. Nein, nicht wie ein Wunder. Das ist es ja gerade. Sie war einfach da, eine Inkarnation ihrer selbst, nicht länger mehr nur eine Zusammenballung von Adjektiven, sondern das reine und präsente Substantiv. (Seite 204f)
Die Gestrandeten übernachten auf der Insel. Am nächsten Tag reisen sie wieder ab.
Leserinnen und Leser, die von einem Roman eine Geschichte erwarten, werden mit „Geister“ kaum etwas anfangen können, denn John Banville bietet allenfalls eine rudimentäre Handlung, und die Figuren bleiben schemenhaft. „Geister“ ist ein „Konzert der Bilder“ (Gerhard Schulz, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 14. Juni 2000), ein absurdes Vexierspiel, in dem sich Realität, Traum, Fiktion und die Geister der Vergangenheit vermischen. John Banville wechselt denn auch immer wieder zwischen Präsens und Imperfekt. Lesenswert ist der Roman vor allem wegen der sprachlichen Virtuosität des irischen Schriftstellers. Zusammen mit „Das Buch der Beweise“ und „Athena“ bildet „Geister“ die so genannte Mördertrilogie von John Banville.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2007
Textauszüge: © Kiepenheuer & Witsch
John Banville (kurze Biografie / Bibliografie)
John Banville: Das Buch der Beweise
John Banville: Athena
John Banville: Der Unberührbare
John Banville: Sonnenfinsternis
John Banville: Caliban
John Banville: Die See
John Banville: Unendlichkeiten
John Banville: Im Lichte der Vergangenheit