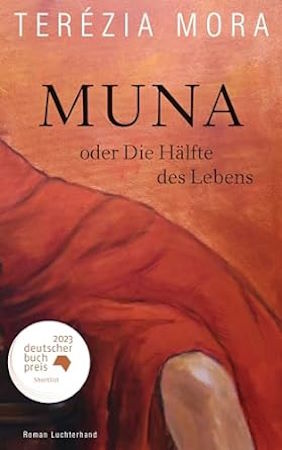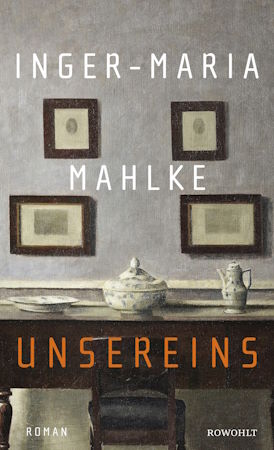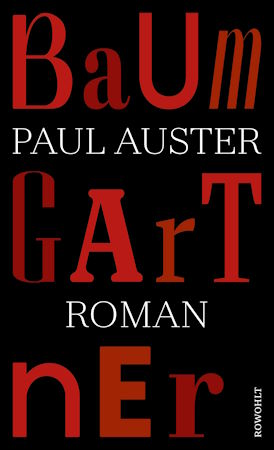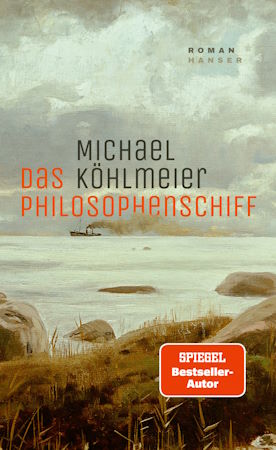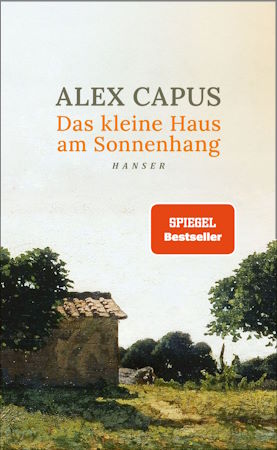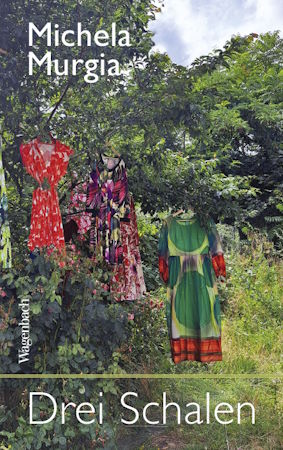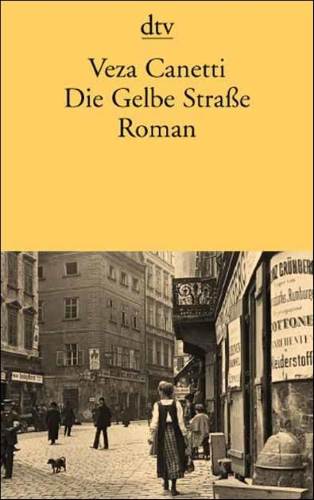Maxim Biller : Die Tochter
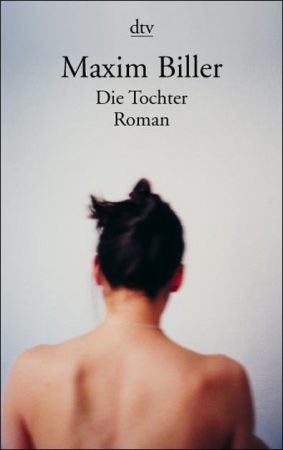
Inhaltsangabe
Kritik
Gegenwart
Als Motti Wind nach zehn langen, bedrückenden Jahren seine Tochter Nurit wiedersah, hatte sie fast gar nichts an. Ihre dunkle Windjacke, die weiße Bluse und die Jeans lagen neben ihr auf dem großen Hotelbett, das mit einer schweren roten Decke bezogen war. Sie hatte bereits ihre Socken abgestreift und die beiden gelben Spangen aus dem Haar gelöst, sodass es nun über ihre nackten Schultern fiel und ihren hohen Brustansatz bedeckte. Während sie das orangefarbene Bikinioberteil, das vorne zusammengebunden war, vorsichtig aufzuschnüren begann, überlegte Motti kurz, ob es nicht besser wäre aufzuhören, aber dann dachte er, dass es ohnehin keine Rolle spielte, ob er weitermachte oder nicht. Ihre großen, mädchenhaften Brüste wirkten wie angeschwollen, man sah ihnen an, dass sie gerade erst gewachsen waren […] (Seite 11)
Mit diesen Sätzen beginnt der Roman „Die Tochter“ von Maxim Biller.
Wie es begann
Mordechai („Motti“) Wind ist ein Israeli, der einen Monat nach der Absolvierung seines Wehrdienstes wegen des Libanonkriegs im Juni 1982 wieder zu den Waffen gerufen wurde und dabei erlebte, wie sein Freund Muamar zerfetzt wurde. Danach – Ende November 1982 – wollte er nach Neu Delhi fliegen, um auf andere Gedanken zu kommen.
Auf dem Flug zum Zwischenstopp in München saß er neben der blonden deutschen Studentin Sofie Branth, die als Touristin in Israel gewesen war. Die beiden verliebten sich auf den ersten Blick. Motti blieb zum Kummer seiner in Ramat Gan, einem Vorort von Tel Aviv, zurückgebliebenen Eltern in München, heiratete Sofie und besuchte mit ihr jede Woche seine in Harlaching wohnenden Schwiegereltern.
Mottis Vater kannte München: Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren er und knapp tausend weitere Gefangene aus einem Konzentrationslager in Polen von SS-Männern nach Westen getrieben worden. Der Todesmarsch endete am Starnberger See, wo die SS-Männer über Nacht verschwanden und die überlebenden, halb verhungerten KZ-Häftlinge – es waren nur noch ein paar Dutzend – sich selbst überließen.
Nachdem Motti seinen Jeans-Laden in der Ledererstraße in München wieder schließen musste, nützte er die Tage bis zum Antritt einer Stelle beim Sicherheitsdienst der jüdischen Gemeinde, um mit Sofie nach Wien zu reisen. Dort zeugten sie ihre Tochter Nurit.
Weil Sofie es nicht über sich brachte, das Kind zu stillen, musste sie sich monatelang mehrmals am Tag die Milch abpumpen. Sie hortete in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Amalienstraße Schlaftabletten und drohte mehrmals mit Selbstmord.
Während ihrer mündlichen Magisterprüfung wurde Sofie von Professor Kindermann eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft angeboten, doch als der von Kindermann editierte Sammelband über Frauenliteratur in der Weimarer Republik herauskam, stellte Sofie fest, dass über dem Essay, den sie dazu geschrieben hatte, der Name ihres Professors stand und nur in den Anmerkungen vermerkt war, der Artikel sei unter ihrer Mitwirkung entstanden. Kindermann hatte Sofie ausgenutzt. Später bekam sie eine Stelle in einem Verlag in der Georgenstraße. Sie arbeitete immer bis in den späten Abend hinein und begleitete ihren Chef, Dr. Goerdt, häufig auf Reisen, aber zwei Kolleginnen mobbten sie und erreichten schließlich durch Intrigen, dass Dr. Goerdt ihr wegen eines verlustreichen Vertragsabschlusses kündigte.
Sofie trat zum Judentum über und nahm den Namen Sarah an.
Den dafür erforderlichen Unterricht nahm sie bei Motti, der nach der vorübergehenden Beschäftigung beim Sicherheitsdienst der jüdischen Gemeinde in München als Religionslehrer arbeitete.
Die Tochter
Einmal reisten Motti und Sarah für zwei Wochen mit Nurit nach Israel und vertrauten das in sich gekehrte Kind der jungen Delphin-Trainerin Tali an. Als der Delphin Paschok das Mädchen auf den Rücken nahm und mit ihm durch die Wellen schwamm, hörte Motti seine Tochter zum ersten Mal lachen. Nurit schien aus ihrem jahrelangen Tiefschlaf zu erwachen, und Motti plante bereits einen weiteren Versuch mit der Delphin-Trainerin in naher Zukunft. Aber nach der Rückkehr aus Israel kam Nurit jede Woche mit einer neuen Verrücktheit an. Anfangs waren die Verhaltensweisen zumeist harmlos. Dann alarmierte der inzwischen verwitwete Dr. Heinrich Branth seine Tochter und seinen Schwiegersohn: „Sie hat sich schon hingehockt!“ Motti rannte aus der Küche ins Wohnzimmer.
Die Buba hatte sich völlig ausgezogen und hockte wie ein Hündchen mit gespreizten Beinen auf Sofies weißem Ledersofa. Ihre Sachen hatte sie überall im Zimmer verstreut […] Nurit wirkte ruhig, sie hatte aufgehört zu zucken, sie zählte auch nicht mehr stumpf vor sich hin […] (Seite 313)
Unter sich hatte Nurit „einen großen stinkenden braunen Haufen“. Als Motti ausholte, um seine Tochter zu schlagen, hielt ihm Sarah von hinten den Arm fest. Das nackte, nach Scheiße stinkende Kind stand vom Sofa auf, spielte zwischen den Beinen und mit den Brustwarzen, tänzelte auf Motti zu und an ihm vorbei zu ihrem Großvater und ihrer weinenden Mutter.
Das Einzige, was Nurit mit ihrem peinlichen, widerlichen, kranken Auftritt erreichte war nur, dass sie ihn vor Sofie bloßstellte und vor deren Vater, diesem alten introvertierten Feigling, der erst auf den Tod seiner Frau warten musste, um wieder er selbst zu werden – dass sie also aus Motti ausgerechnet vor diesen beiden Eisblöcken von Menschen jemand machte, der unfähig war, seine angeblich so heißgeliebte Tochter richtig zu erziehen und die Verantwortung für sie zu übernehmen […] (Seite 324)
Keuchend prügelte Motti auf das Kind ein.
Wohl auf die Intiative von jemand aus der Nachbarschaft schaute einmal eine Frau Rackwill vom Jugendamt vorbei und unterhielt sich einige Zeit unter vier Augen mit Nurit.
Gegenwart
All die Erinnerungsfetzen jagen Motti durch den Kopf. Er war inzwischen aufgestanden, hatte sich den Bauch abgewischt, das Porno-Video zurückgebracht und in der Videothek die leere Kassette des Films aus dem Regal gestohlen. Neben dem nackten Mädchen auf dem Cover steht zwar der Name Jessy Jazz, aber dabei handelt es sich selbstverständlich um ein Pseudonym. Motti nimmt ein Taxi zum Flughafen, um Deutschland ohne Gepäck zu verlassen, tut es dann aber doch nicht, und weil er kein Geld mehr hat, fährt er mit der S-Bahn nach München zurück, wo er weiter durch die Straßen irrt. Dann beschließt er, zur Amalienstraße zu gehen und Nurit zu holen, der Frau zu entreißen, die sie als Pornodarstellerin auftreten lässt und nichts dagegen unternahm, dass er seine Tochter jahrelang fickte.
„Wenn ich will, kann ich alles“, murmelte Motti leise, während er – den Kopf tief vorgeschoben, die Arme hinter dem Rücken verschränkt – müde und nervös vor dem Haus in der Amalienstraße auf und ab ging. „Wenn-ich-will, wenn-ich-will, wenn-ich-will! Wenn ich will, läute ich so wie früher, einmal kurz, zweimal lang, damit sie weiß, dass ich es bin, und sollte sie darum erst recht nicht aufmachen, trete ich eben die Tür ein – wenn ich will. Wenn ich will, sage ich ‚Guten Tag‘ und ‚Wie geht’s?‘ oder einfach nur ‚Fotze!‘. Wenn ich will, bin ich vielleicht höflich zu ihr […] Ich werde ihr das Foto auf der Videoschachtel zeigen und – wenn ich will – höchstens mit ein, zwei knappen Sätzen erklären, wie unangenehm die Sache für sie werden könnte, sollte sie Nurit nicht mit mir gehen lassen, auf der Stelle, sofort […] (Seite 332)
Es verwirrt Motti, dass die Frau darauf besteht, nicht Sofie, sondern Sarah zu heißen. Sie bittet ihn, gleich seine Eltern in Israel anzurufen, die sich Sorgen machen. Die Video-Hülle hat Motti plötzlich nicht mehr bei sich, und Sofie oder Sarah versteht offenbar nicht, was er meint, als er sagt, es sei jetzt Schluss mit den Pornofilmen und er sei gekommen, um Nurit mitzunehmen. Verzweifelt schreit Sarah, Motti könne seine Tochter in der Garchinger Straße abholen. Dann begreift sie: „Du hast schon wieder gedacht, du hättest sie gesehen!“ In diesem Augenblick hört Motti einen Mann und ein Kind kommen, die hebräisch miteinander reden. Es handelt sich um Mottis früheren Chef Itai, der sich von seiner ersten Frau hatte scheiden lassen, und eine aufgeweckte Fünf- oder Sechsjährige, die Lola heißt und den Gast als „Onkel Motti“ begrüßt.
Der Autor
An dieser Stelle (Seite 367) meldet sich der jüdische Autor, der bisher nur zwei- oder dreimal kurz auftauchte, als Ich-Erzähler zu Wort. Seine deutsche Frau Marie hatte zur Vorbereitung ihres Übertritts zum Judentum auf Empfehlung eines Rabbiners Religionsunterricht bei Motti genommen. Den Übertritt zum Judentum vollzog Marie in New York. Ein paar Wochen später verriet sie ihrem Mann, sie sei schwanger, habe seit einiger Zeit ein Verhältnis und wisse nicht, wer der Vater sei. Der Ich-Erzähler war entrüstet, vor allem, weil Marie sich als Liebhaber ausgerechnet einen Goj ausgesucht hatte. Ein Gentest ergab schließlich, dass Maries Tochter Leonie von diesem Nichtjuden gezeugt worden war. Seit der Trennung von Marie will der Ich-Erzähler aus Deutschland fort, aber vorher noch dieses Buch über Motti fertig schreiben. Angefangen habe er damit vor drei Jahren, schreibt er, an dem Tag, als Marie nach New York flog. Damals traf er Motti am Bahnhof und ließ sich von ihm zum Essen in der Bahnhofsgaststätte einladen. Anders als sonst war Motti richtig aufgekratzt.
[…] er zog aus der Manteltasche eine leere Videoschachtel und legte sie vor mir auf den Tisch. Dann fuhr er mit dem Finger über die aufgequollenen Brüste und die ausrasierte Scham des jungen Mädchens, das auf dem Umschlag zu sehen war, und begann, mir lauter wirre Geschichten über Kindersex und Verletzung der Aufsichtspflicht zu erzählen. Während er redete, hörte ich ihm immer weniger zu, ich ersetzte in Gedanken seine Worte mehr und mehr durch meine eigenen, und das war es dann also, der Anfang meiner Motti-Geschichte.
Das ist natürlich nicht wahr. Angefangen hatte sie schon viel früher, vor über zehn Jahren, als ich Marie noch gar nicht kannte, an einem etwas zu warmen, verhangenen Wintermorgen […] (Seite 407)
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
überspringen Sie bitte vorerst den Rest der Inhaltsangabe.
Das tote Mädchen
Vor über zehn Jahren, an einem Februarmorgen, ging der Autor in München spazieren und sah in der Amalienstraße ein fünf oder sechs Jahre altes Mädchen inmitten einer Menge von Gaffern mit verrenkten Beinen und Armen tot auf dem Pflaster liegen. Ein Mann hämmerte mit seinem bereits blutüberströmten Kopf unaufhörlich gegen die Haustür, und zwei Polizisten schafften es nicht, ihn davon abzuhalten. Dann kam eine ernste junge Frau aus der Tür, beugte sich über das tote Kind und ging nach ein paar Sekunden, ohne es berührt oder ein Wort gesprochen zu haben, langsam wieder zurück ins Haus, während der Mann schrie: „Sie hätte einmal auf sie aufpassen können, ein einziges Mal …“
Ich habe wieder den Tag in der Wohnung verbracht, bei geschlossenen Fenstern und zugezogenen Gardinen, ich war wieder stundenlang allein mit all diesem fremden, erfundenen Unglück und Irrsinn, und darum will ich jetzt auch sofort, solange es draußen noch ein wenig hell ist, raus, einen von meinen Abschiedsspaziergängen machen, damit ich schnell wieder auf bessere Gedanken komme. Heute, glaube ich, werde ich ins Lehel gehen […] (Seite 412f)
Motti
Nach diesem Einschub des Ich-Erzählers wendet sich die Geschichte wieder Motti zu:
Also sprach er zu sich selbst: Ich werde sie retten vor ihr und vor mir […] Und sie sprach in ihrem fünften Lenz noch nicht einmal die Sprache ihres Volks. Und weil also in all den Wochen und Monaten und Jahren nichts geschehen war, wurde Mordechais Angst groß, dass es nichts und niemanden über und unter ihm gab, nicht links und nicht rechts und auch nicht hinter der orangegelben Sonne und der weißen Scheibe des Monds, und darum sah er, dass er allein etwas tun müsse […] nahm er Nurit bei der Hand und führte sie wie eine Schlafwandlerin zum Fenster im Wohnzimmer, und dort hob er sie auf die Fensterbank, und er zeigte hinaus und redete eine Weile so auf sie ein wie eh […] doch sie blieb stumm und stumpf wie immer […] Dann erst öffnete er das Fenster […] Und so lockerte er den Griff seiner Finger, denn er wollte ihr gut, und dann ließ er sie ganz los, worauf sie nun allein am Rand des Abgrunds stand, aber sie schwankte nicht, sie verharrte eine lange Weile vollkommen still, und endlich, ohne dass er sie berührt oder gestoßen oder es ihr befohlen hätte, begann sie zu fallen […] (Seite 414ff)
Der Roman endet mit den Sätzen:
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Als Motti die Augen aufmachte, begann es draußen bereits wieder dunkel zu werden […] Bloß nicht umdrehen, dachte er, und er fuhr mit der Hand unter die Decke und berührte sein nacktes Bein. Die Hand zuckte zurück, so schnell, als hätte er sich verbrannt, und danach lag er wieder eine Weile ganz still da. Schließlich, fast ohne sein Zutun, begann die Hand erneut unter die Decke zu wandern, sie schob sich forschend über Bein und Hüfte, und als sie seinen samenverklebten Bauch erreichte, zuckte sie abermals wie von selbst zurück. Schade, dachte er, wirklich schade, denn er hatte einen Moment lang tatsächlich geglaubt, es sei alles gut. Dann richtete er sich im Bett auf, er stopfte sich das Kissen hinter den Rücken und sah auf den Bildschirm. Das Standbild zitterte leicht, aber er konnte sie genau erkennen – er sah ihr schmales polnisches Gesicht, die eng zusammenstehenden Augenbrauen, die dunkle, lange Nase, die blassen Lippen. Alles war wie vorhin, bevor er eingeschlafen war, nur ihr Haar kam ihm heller, lockiger vor, und dann schob Motti die Bettdecke leicht zur Seite, er nahm die Fernbedienung und drückte auf Start. (Seite 425f)
Der vom Libanonkrieg traumatisierte und im November 1982 – vor siebzehn Jahren – nach München gezogene Israeli Motti liegt masturbierend vor dem Fernsehgerät im Bett, schaut sich ein Porno-Video an und glaubt, in der Hauptdarstellerin seine Tochter Nurit zu erkennen, die er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Von seinen quälenden Erinnerungen umgetrieben, irrt er einen Tag lang durch München.
Maxim Billers Debütroman trägt den Titel „Die Tochter“: Das geistig behinderte Mädchen ist der Mittelpunkt in Mottis Vorstellungswelt. In der von ihm als kalt und herzlos empfundenen deutschen Gesellschaft liebt er seine Tochter abgöttisch und inzestuös. Als sie nicht mehr da ist, verfällt er vor Verzweiflung einem Wahn.
Die eigentliche Geschichte wird durch die des Ich-Erzählers gespiegelt, der zunächst nur zwei- oder dreimal Motti kurz begegnet und sich erst auf den Seiten 367 bis 413 durchgehend an die Leser wendet.
Die folgende, surreal wirkende Passage (Seiten 413 bis 427) ist in einem pseudobiblischen Stil geschrieben. Danach glauben wir, die Handlung ganz verstanden zu haben. Doch am Ende (Seiten 424 bis 426) liegt Motti wieder wie am Anfang masturbierend im Bett. War das aus vielen Erinnerungsbruchstücken zusammengesetzte Bild des Protagonisten und seiner Tochter nur ein Traum?
Und ganz besonders schien ihm [Motti] seine Krankheit zuzusetzen, über die er allerdings fast nie etwas zu Marie sagte, außer, dass er bald keine Kraft mehr hätte, sich immer und immer wieder zwingen zu müssen, zwischen den Dingen, die wirklich geschahen, und denen, die er sich nur einbildete, zu unterscheiden. (Seite 374)
„Die Tochter“ ist ein ernster, verzweifelter und verstörender Roman auf hohem Niveau.
Maxim Biller wurde 1960 in Prag geboren. Seit 1970 lebt er in Deutschland. Vor seinem ersten Roman „Die Tochter“ veröffentlichte er die Erzählbände „Wenn ich einmal reich und tot bin“ (1990), „Land der Väter und Verräter“ (1994) und „Harlem Holocaust“ (1998) sowie die Essaysammlung „Die Tempojahre“ (1991).
Maxim Biller […] ist schon allein deswegen eine Ausnahmeerscheinung, weil er als One-Man-Show die jüdische Literatur in Deutschland vertritt. Biller ist die junge jüdische Literatur, an der er stets leidet wie auch an Deutschland selbst. Anfang der Neunzigerjahre war er allerdings vor allem als Journalist bekannt, eher berüchtigt als berühmt ist er durch seine scharfen, bösen und brillanten Texte, vor allem seine Kolumne „Hundert Zeilen Hass“ in der Zeitschrift „Tempo“. Bis heute ist Biller ein Querulant geblieben, ein Provokateur, der zu vielem eine starke Meinung hat, manchmal auch starke Argumente, aber einer der wenigen, die die in Verruf geratene oder vergessene Gattung der Polemik tatsächlich beherrschen. (Richard Kämmerlings: Das kurze Glück der Gegenwart. Deutschsprachige Literatur seit ’89)
Gegen die Veröffentlichung des Romans „Esra“ (2003) klagten eine frühere Geliebte Maxim Billers und deren Mutter. Der Bundesgerichtshof gab ihnen im Juni 2005 Recht, da sie nicht damit hatten rechnen müssen, leicht erkennbar als Esra Adrian und Lale Schöttle in einem Roman dargestellt zu werden. 2006 reichte der Verlag Kiepenheuer & Witsch gegen das Verbot des Romans eine Verfassungsbeschwerde ein, aber das Bundesverfassungsgericht bestätigte im Oktober 2007 zum zweiten Mal in seiner Geschichte das „Gesamtverbot“ eines Romans. (1971 war der Roman „Mephisto“ von Klaus Mann verboten worden.) Über den Fall schrieb Bernhard von Becker das Buch „Fiktion und Wirklichkeit im Roman. Der Schlüsselprozess um das Buch Esra“ (Königshausen & Neumann, 2007).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2005 / 2011
Textauszüge: © Verlag Kiepenheuer & Witsch
Maxim Biller: Sechs Koffer
Maxim Biller: Der falsche Gruß
Maxim Biller: Mama Odessa