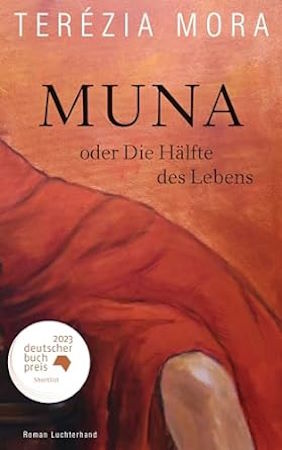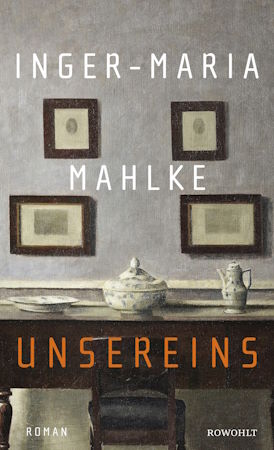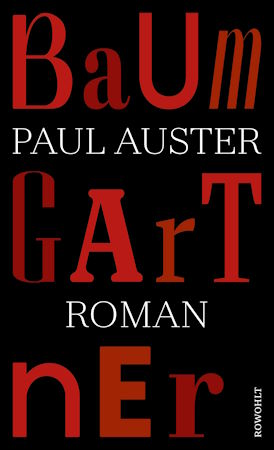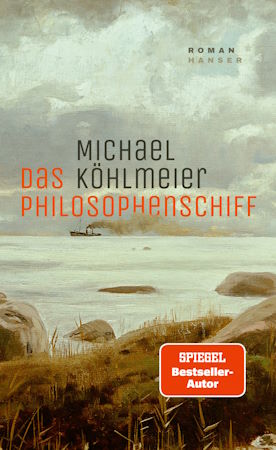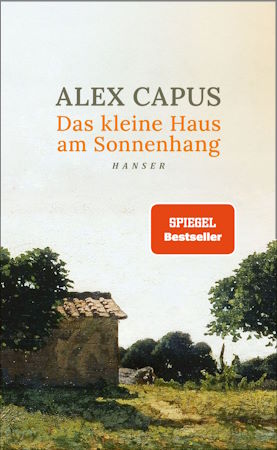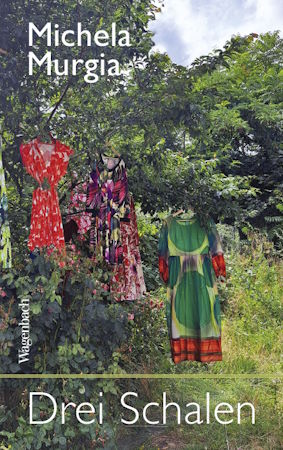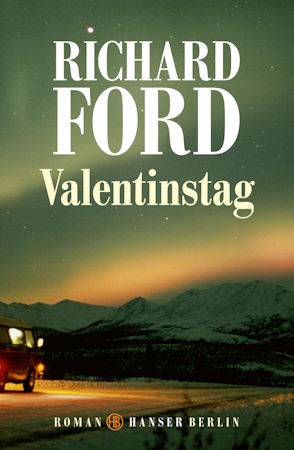Matthias Politycki : Herr der Hörner
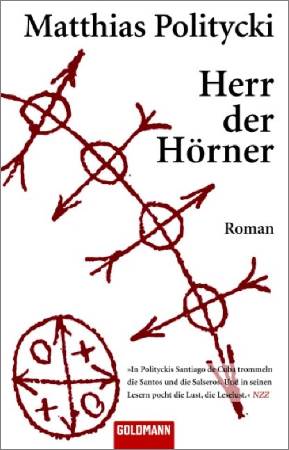
Inhaltsangabe
Kritik
Dr. Broder Broschkus und seine Ehefrau Kristina verbringen einen Urlaub in Santiago de Cuba. Ihre Tochter Sarah blieb in Hamburg, wo Broschkus als Prokurist und Spezialist für „Abwärtsspekulation und Leerverkauf“ (Seite 15) der Bank „Hase & Hase“ tätig ist.
Das Helle vergeht,
doch das Dunkle, das bleibt. Als Broder Broschkus, erklärter Feind allen karibischen Frohsinns, die Stufen zur „Casa de las tradiciones“ hochschwitzte, hinter sich eine Frau, die er in dreizehn wunderbaren Ehejahren so gut wie vergessen hatte, beherrschte er nach wie vor nur zwei spanische Vokabeln, „adiós“ und „caramba“ – ja/nein, links/rechts und die Ziffern von eins bis zehn mal nicht mitgezählt. In stummer Empörung die Blechfanfaren registrierend, die ihm auch hier entgegenfuhren, überschlug er die Stunden, die bis zum Heimflug noch zu überstehen waren, keine geringe Lust verspürend, dem Türsteher anstelle des geforderten Touristendollars einen Tritt zu verpassen, dass er sich auf dieser Treppe knapp zwei Stunden später seinem Tod entgegenstürzen sollte, konnte er ja nicht ahnen. Am Ende eines Pauschalurlaubs war’s, die Koffer bereits gepackt und kurz vor zwölf, an einem Samstagmittag unter farblosem Himmel. (Seite 9)
In der „Casa de las tradiciones“, einer von den Einheimischen kurz „Casona“ genannten schäbigen Kneipe, fällt ihm eine junge Kubanerin auf, die mit einer anderen am Tresen sitzt. Bei der Älteren handelt es sich um eine große, muskulöse und breitschultrige Frau; das armselig gekleidete Mädchen ist dagegen zierlich. Während die Frau mit Kristina Salsa tanzt, fordert die Jüngere Broschkus auf.
Da entdeckte er ihn: den feinen Riss in all dem Glanz, mitten im Grün der Iris ein farblos fahles Einsprengsel, millimeterbreit ein Strich im linken Auge, vom äußern Rand der Iris bis zur Pupille, vielmehr im rechten Auge, jaja, im rechten, ein Fleck.
Gleich!, dachte Broschkus nicht etwa, fühlte’s freilich desto stärker: Gleich! tut sich die Erde auf und ich fahr‘ zur Hölle. (Seite 15)
Als Broder und Kristina Broschkus aufbrechen, steht die junge Kubanerin am Ausgang.
Während er bereits die Schuhspitze auf die erste Stufe setzte – welch Kühle mit einem Mal auch hier draußen! –, dachte er „caramba!“ und sagte, nein: flüsterte, nein: wisperte, denn die Zunge blieb ihm am Gaumen kleben: „adiós“. Dann stürzte er treppab und zu Tode.
Nunja,
um ein Haar. Was ihn gerettet hatte, jedenfalls für diesmal, war seine Frau; als er zehn Stufen tiefer angekommen, mit einem verknacksten Knöchel vermutlich und mit Kristina, die er im Schwung des Hinabstolperns mitgerissen hatte, war der Himmel weiß. (Seite 17)
Das Mädchen läuft Broschkus nach und bittet ihn, ihr einen Zehn-Peso-Schein in zwei Fünfer zu wechseln.
Auf dem Weg zum Hotel kauft er an einem Getränkestand ein Bananensaftmilchzuckerwasser auf Eis und bezahlt mit dem Zehn-Peso-Schein. Minuten später schießt ihm der Gedanke durch den Kopf, dass die Unbekannte ihre Telefonnummer oder eine andere Notiz auf die Banknote geschrieben haben könnte. Also läuft Broschkus zurück und tauscht die Zehn-Peso-Scheine der Getränkeverkäuferin in Dollar.
Als sie erst einmal kapiert hatte, wie diesem Verrückten geholfen werden konnte, war die Frau durchaus einverstanden, geistesgegenwärtig holte sie weitere Banknoten aus weiteren Zimmern, stets dabei nach Unterstützung rufend, am Schluss erhielt Broschkus sämtliche Zehnpesoscheine, die sie und ihre Nachbarn und die Nachbarn der Nachbarn auf die Schnelle hatten beibringen können. (Seite 19)
In der Flugzeug-Toilette nimmt Broschkus das Geldbündel heraus. Auf drei Scheinen entdeckt er Handschriftliches. Einer davon könnte von seiner Tanzpartnerin in Santiago de Cuba stammen. Die unbeschriebenen wirft er ins WC.
Die Begegnung mit der jungen Kubanerin hat Dr. Broder Broschkus verändert: In den siebzehn Jahren seiner Tätigkeit bei der Bank in Hamburg hatte er sich stets korrekt verhalten und war als zu konservativ kritisiert worden. Unvermittelt überredet er seine Kunden nun zum Kauf von „Turbo-Zertifikaten“ und chinesischen Optionsscheinen.
„Ein Mal im Leben unlimitiert agieren, verstehen Sie?“ (Seite 16f)
Dadurch verlieren die Bankkunden viel Geld – und Broschkus seinen Job. Aber das macht ihm nichts aus, denn mit Hilfe eines verschwiegenen Kollegen transferierte er inzwischen sein gesamtes Barvermögen auf ein Schweizer Nummernkonto, und einige Tage nach seinem fünfzigsten Geburtstag fliegt er – ohne seiner Frau etwas zu erklären oder sich von ihr zu verabschieden – erneut nach Santiago de Cuba.
Dort mietet er von Luis Felix Reinosa („Luisito“) die „Casa el Tivolí“ und bezahlt dafür 6205 Dollar für ein Jahr im Voraus. Im Preis inbegriffen ist der zahnlose Greis Papito, ein früherer Schiffskoch, der für Broschkus‘ leibliches Wohl sorgen soll. Luisito ist angeblich als Abteilungsleiter des staatlichen Fernsehens tätig, aber Broschkus glaubt, dass es sich auch um einen bestens vernetzten „Spezialist[en] für Nebenerwerb auf Dollarbasis“ (Seite 67) handelt.
In der Nachbarschaft wohnt eine Schwarze, die Broschkus für sich „Lockenwicklerin“ nennt. Angeblich ist sie eine macha, eine cojonua (Hodenträgerin), die im Stehen urinieren und mit bloßen Fingern einen Kloß aus dem kochenden Wasser holen kann. Sie wurde zur Präsidentin des Komitees zur Verteidigung der Revolution gewählt, aber das Ehrenamt dient der Lockenwicklerin nur als Tarnung; in Wirklichkeit führt sie eine kriminelle Bande an.
Zu den Nachbarn gehört auch Papito mit seiner Familie: Seine Tochter Rosalia, deren Ehemann Ulysses und zwei Mädchen. Flor ist Rosalias Tochter; ihre ältere Halbschwester Mercedes stammt aus einem eheähnlichen Verhältnis, das Ulysses mit einer Frau namens Mirta führte. Der Arbeitslose Ulysses verdient mit dem regelmäßigen Austausch von Propangasflaschen ein wenig Geld. Von Rosalia, einer aufdringlichen Mulatin um die vierzig, heißt es, sie nehme ihrem Vater die Rente weg, um sich Rum zu kaufen. Mercedes erinnert Broschkus dagegen an die gesuchte Kubanerin.
Mercedes sah ihn so wortlos an, dass ihr die Nasenflügel bebten, so unmädchenhaft nackt und direkt sah sie ihn an aus ihren Augen, grün lag ein Glanz darin, nicht etwa als heißes Versprechen, sondern als kaltes Verlangen, dass ihm die Luft wegblieb, und da entdeckte er ihn: den feinen Riss in all dem Glanz, den Fleck, vielmehr –
entdeckte ihn nicht,
neinein, der Glanz war vollkommen, von einem Fleck keine Spur. Mercedes war – die Falsche. Im Ausatmen musste er sich eingestehen, dass ihre Augen mitnichten grün waren, sondern braun, dicht und schwarz standen ihr die Brauen darüber. (Seite 86)
Die Schreie, die Broschkus immer wieder hört und die wie die eines Esels klingen, sollen von Mercedes‘ Sohn stammen. Man erzählt ihm, Mercedes habe sich zu wenig um ihr Kind gekümmert. Das habe während ihrer Abwesenheit alle Tabletten im Haus aufgegessen und sei dadurch zum geisteskranken Krüppel geworden. Ob das Gerücht stimmt und ob Mercedes wirklich einen Sohn hat, findet Broschkus nicht heraus.
Jedenfalls sorgt sie als jinetera für den Lebensunterhalt ihrer Familie.
Also die jineteras. Man dürfe sie nicht pauschal verurteilen, die Zeiten seien hart, eine jinetera ernähre in der Regel eine ganze Familie. Natürlich gebe’s solche, die nur schnell mal, Broschkus wisse ja selbst, nur mal für eine Nacht oder noch kürzer. Andrerseits aber, Dochdoch, solche gebe’s auch. Vielleicht wollten sie bloß aus Kuba weggeheiratet werden oder wenigstens in Kuba nie mehr hungern, aber egal: Eine jinetera, die sei nicht nur die Frau für eine Nacht, die koche, putze, kaufe ein und führe den Haushalt […] (Seite 74)
Weil Papito nicht nur für Broschkus kocht, sondern seine ganze Familie auf Kosten des Mieters der „Casa el Tivolí“ mit versorgt, wirft dieser ihn hinaus, als in der Nähe das Restaurant „El Balcón del Tivolí“ eröffnet wird. Besitzer ist Prudencio Cabrera Ocampo; Silvano Ramirez Gonzalez („Cuqui“) fungiert als Koch und Kellner zugleich. Anstatt einer Serviette legt er den Gästen einen aus drei Blättern bestehenden Streifen einlagiges Klopapier neben den Teller.
Zu Essen gibt es jedoch auch auf der Straße.
Zwischen den Bierbuden schlugen andre derweil ihre Imbissstände auf,
Metalltische, auf denen hellbraun glasiert glänzende Schweine lagen, grinsende Komplettbratschweine, deren Fleisch man mit bloßen Fingern abzupfte. Vor einem besonders großen blieb Broschkus stehen, versuchsweise ein Loch in die Luft zu stoßen; der Verkäufer fing gleich an, seine Ware zu rühmen, „Das gibt dir Kraft, Mann! Deine Geliebte wird dir auf Knien danken!“, mit Daumen und Zeigefinger Fasern vom Körper des Schweins pulend, ziehend, reißend und zwischen zwei Brötchenhälften stopfend – dabei war die Schnauze des Tiers blutverschmiert, auch an den Klauen klebte was.
Als ihm der Verkäufer das prall gepackte Brötchen hinhielt, schüttelte Broschkus entschlossen den Kopf. Ging aber auch nicht schweigend weiter, wie’s sonst seine Art war, sondern fragte, eher desinteressiert, nach einer Neonröhre. Der Verkäufer zeigte sich keinesfalls erbost, im Gegenteil, erwog sekundenlang seine Antwort:
Ob Broschkus jemand kenne, der eine Autobatterie verkaufe? Oder einen Kühlschrank brauche? einen Hummer? (Seite 161f)
Was der Deutsche in Kuba suche, fragt Ernesto de la Luz Rivero, der siebzigjährige Zigarrendreher aus der „Casa de las tradiciones“.
Eine Frau, sagte Broschkus.
Das verstand man, das verstand man durchaus. (Seite 52)
Schließlich erzählt Broschkus seinem neuen Freund die ganze Geschichte und vertraut ihm die drei Zehn-Peso-Scheine an. Ernesto verspricht, das Mädchen zu finden.
Als Luisito erfährt, warum sein Mieter in Santiago de Cuba ist, meint er:
Ein Mann ohne Geliebte, das sei schlimm.
Ein Mann ohne Familie, das sei schlimmer.
„Aber ein Mann, der eine Familie hat, der sie verlässt und dann noch nicht mal eine Geliebte will – das ist unverzeihlich.“ (Seite 134)
Einmal gerät Broschkus in einen Pulk schreiender Männer.
Ob alt, ob jung, starrte man gebannt auf zwei magere Hunde, die, ineinander verbissen, am Boden sich wälzten, ein kleiner weißer und ein größerer gelber. Überraschend resolut drängte sich Broschkus ganz nach vorn, wollte aus nächster Nähe sehen, wie die beiden Kämpfenden dalagen, heftig atmend darauf wartend, dass der andre starb. Das dauerte den Zuschauern zu lange, man brach ihnen mit Stöcken die Mäuler auf, während man sie gleichzeitig an den Hinterpfoten auseinanderzerrte, auf dass sie wütend kläffen, erneut gegeneinander anrennen, zuschnappen und sofort umfallen konnten.
Dass es hier um Leben und Tod und Geld ging, erfasste Broschkus auch ohne ausdrückliche Erklärung, am liebsten hätte er gleich ein paar Dollars gesetzt, so sehr fieberte er, der erklärte Pazifist und Gegner von Tierversuchen, fieberte dem finalen Biss entgegen […]
Kaum regte sich einer der beiden [Hunde], um eine neue, wirkungsvollere Bissstelle zu suchen, gerieten die umstehenden Männer in Freude oder Panik, schließlich zerrte man sie wieder auseinander, die Hunde, ließ sie wieder aufeinander zurennen und umfallen, anscheinend fehlte ihnen schon die Kraft, um auf den Beinen zu bleiben. Und dann – stand der gelbe Hund nicht mehr auf, wie hatte das passieren können, Tod durch Erschöpfung, die Hälfte der Zuschauer konnte’s nicht fassen: Ausgerechnet er! der bereits fünf Gegner totgebissen und auch in diesem Kampf seine Überlegenheit gezeigt hatte.
Was denn mit dem Verlierer passiere, wollte Broschkus fragen, während in großer Eile um ihn herum Banknotenbündel hin- und hergereicht wurden, aber da sah er, wie ihn sein wütender Besitzer aus dem Staub klaubte und den anderen Hunden, die sich am Wegesrand zusammengefunden, zum Fraß vorwarf. (Seite 108f)
Weil sein Touristenvisum nach einem Monat abgelaufen ist, geht Broschkus zum Innenministerium.
Im Grunde brauche er nur deshalb einen weiteren Monat, weil er – die Schönheit Kubas? nein, die Schönheit ener bestimmten Frau, weil er sie bislang noch nicht gefunden.
Das verstand der Offizier.
Das verstand er sogar sehr gut: Ob sie auch einen Leberfleck zwischen den Brüsten? Das seien nämlich die besten, wenn er hier mal von Mann zu Mann; die seien, aaah, ja, hm, uyuyuyuy. (Seite 198)
Broschkus denkt:
So würde’s nicht mehr weitergehen können,
das war hiermit entschieden. Um eines bloßen Flecks willen, eines Fehlers gewissermaßen, der ihr [Mercedes] fehlte, der Enkelin eines Säufers, der Tochter einer Säuferin, konnte er nicht so tun, als verspüre er lediglich Hunger. Glich sie dem Mädchen von einst nicht aufs Haar, war nicht alles an ihr ganz genau so, wie er’s von seinem Tanz her in Erinnerung hatte, fast ganz genau so? […]
War er denn eines Flecks oder einer Frau wegen hierhergekommen? (Seite 152)
Aber da glaubt Ernesto, die Gesuchte gefunden zu haben. Sie heiße Alina, erklärt er seinem Duz-Freund und begleitet ihn zu der ermittelten Adresse.
Broschkus wurde der Ehrenplatz unter einer an der Wand hängenden Machete zugewiesen: in einem rotlackierten Schaukelstuhl aus Eisen, offensichtlich das Ergebnis anhaltender Materialunterschlagung in Tateinheit mit Heimwerkerei, hauptsächlich aus zwei umgeschmiedeten Pferdewagenrädern bestehend, die freilich so unregelmäßig vor- und zurückruckelten, dass sich Broschkus, zur Erheiterung aller Anwesenden, stets erschrocken an die schmalen Armlehnen klammerte. (Seite 182)
Eine Alina gebe es hier nicht, behaupten die Leute, die hier wohnen. Als Ernesto und der Deutsche gehen, stoßen sie im Treppenhaus auf einen zwergwüchsigen mulato, der ein strampelndes und quiekendes Ferkel trägt.
Überrascht hielt der Zwergwüchsige inne, ein vielleicht Zwanzigjähriger in Hausschlappen, mit der versoffen knarrenden Stimme eines Sechzigjährigen gurgelte sich ein „Buenas!“ vom anderen Ende der Welt bis in seinen Hals hinauf, wo’s auf halber Höhe steckenblieb. (Seite 183)
Er verrät den beiden Fremden, dass Alina von hier verschwinden musste, weil man ihr „dunkle Machenschaften“ nachsagte.
„Ich glaube, diese Frau, die war kein normaler Mensch.“ (Seite 184)
Alina lebe jetzt in einem Gebirgsdorf in der Nähe von Chivirico in der Sierra Maestra, dessen Namen er nicht kenne, aber sie soll bei Hahnenkämpfen Brot und Käse verkaufen. Ob sie einen Fleck im Auge habe, fragt Ernesto, und der Zwergwüchsige nickt stumm.
Als Broschkus in die „Casa el Tivolí“ zurückkommt, sind Luisito und Papito gerade dabei, den viel zu niedrigen Türstock des Badezimmers herauszuschlagen. Es sei ihm nämlich gelungen, eine neue Türe zu beschaffen, erklärt der Hausbesitzer.
In der Wohnung, es war ja kein Wunder, die reine Baustelle: Dort, wo sonst bei Regen oder überlaufenden Tanks das Wasser zusammenfloß, ein Haufen Steine und überall sonst: Staub. Verstreut ein paar leere Cristal-Dosen, genaugenommen alle, die Broschkus eingelagert hatte, selbst sein Notvorrat an Ron Mulata war den beiden nicht entgangen.
Es sei heiß gewesen, entschuldigte sich Luisito nicht etwa, sondern beschwerte sich sogar, der Kühlschrank kühle die Biere nicht ordentlich, der gehöre dringend abgetaut. (Seite 187)
Ernesto vertraut Broschkus an, dass er zur Santería gehöre und behauptet, einer der vierhundertfünfzig Heiligen dieser afroamerikanischen Religion zu sein. Bei Alina handele es sich um eine mambo, eine Voodoo-Priesterin, vermutet er, die mit Hilfe der zwei eingetauschten Fünf-Peso-Scheine aus der Ferne auf Broschkus einwirke.
Luisitos Schwager, Señor Planas, besitzt ein Auto. Damit soll Broschkus in die Sierra Maestra gebracht werden. Weil es unterwegs keine Tankstellen gibt, muss ausreichend Benzin in Mineralwasserflaschen mitgenommen werden. Diese von den Touristen weggeworfenen Plastikflaschen sind in Kuba sehr begehrt und werden vielseitig verwendet.
Nachdem Luisito eine Nachbarin herausgerufen hatte,
er selber verfügte über kein eignes Telefon, wusste man, dass Señor Planas heute überhaupt nicht mehr kommen – Angelegenheiten! –, immerhin aber einen Chauffeur schicken würde, seinen Lieblingscousin. Der freilich das Auto erst mal abholen müsse. Broschkus blieb so locker wie ein Einheimischer, während Luisito fast so nervös wie ein Deutscher wurde, nichts klappe in diesem verrotteten Land, alle faul und unzuverlässig, kein Wunder, dass es nirgends vorangehe, Kuba sei eine richtige Scheiße, una mierda! (Seite 213)
Bei Planas‘ Lieblingscousin handelt es sich um den Weiberhelden Ramón.
Der Lada war in Wirklichkeit
ein Moskwitsch oder jedenfalls in seinem vorderen Drittel, ein kaffeebohnenbraun gestrichner Luxuskleinwagen, keine zwanzig Jahre alt. Ein Sprung in der Windschutzscheibe verästelte sich zum Glück erst auf der Beifahrerseite; die Heckscheibe fehlte ganz. Auf den schwarzen Plastiksitzen schwitzte man sich sofort fest, und weil’s kein Autoradio gab, sang Luisito, eine erste Lage Rum in abgeschnittenen Plastikflaschen reichend. (Seite 214)
Luisito begleitet Broschkus zwar, bleibt jedoch unter einem Vorwand in der Ortschaft El Mazo zurück, als der Deutsche und Ramón den Berg Perico besteigen, bis sie auf einen Hahnenkampf stoßen.
Unter wechselseitigen Verdächtigungen, dass die jeweils andre Partei längere, spitzere Kampfsporen zum Einsatz bringen wolle – mehrfach brachte man die gewählten Paare zum Vergleich –, bereitete man die beiden Hähne auf den Kampf vor: Deren eigne krumm und kurz gewachsne Sporen wurden mit einem Taschenmesser weggeschnitzt, das Blut mit Zigarettenglut gestillt, dann setzt man an den Schnittstellen weit längere, kunstvoll geschliffne Kampfsporen auf, befestigte sie mit Klebstoff, Bindfaden und violettem Band, klaglos hingenommen von den beiden Kontrahenten. (Seite 226)
Wie erhofft, taucht die Käseverkäuferin Alina auf, aber sie sieht dem von Broschkus gesuchten Mädchen überhaupt nicht ähnlich.
Zurück in Santiago de Cuba, entdeckt Broschkus die kräftige Frau, die vor einigen Monaten in der „Casa de las tradiciones“ mit Kristina getanzt hatte. Die einunddreißigjährige jinetera nennt sich Iliana Castillo Pulgarón oder auch Anita. Er fragt sie nach ihrer Freundin, aber darauf geht sie nicht ein. Stattdessen drängt sie sich ihm auf, und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sie mit in die „Casa el Tivolí“ zu nehmen, wo sie erst einmal den Kühlschrank leer isst, bevor sie ihn ins Bett zerrt.
Danach ist Broschkus Interesse an dem Mädchen mit dem Fleck im Auge deutlich gesunken.
„Ach, lieber noch mal die Falsche.“ (Seite 248)
Trotzdem sucht Ernesto weiter.
Dass Iliana erklärt, sie hasse Neger schon allein wegen ihres Gestanks, verblüfft Broschkus, denn sie ist schwarz. Aber sie besteht darauf, viel heller als beispielsweise Luisito zu sein. Prudencio Cabrera Ocampo behauptet, Iliana habe ihrem Ehemann vor Jahren das Gemächt ausgerissen. Broschkus will unbedingt ihre Mutter kennen lernen. Iliana sträubt sich zunächst, aber schließlich nimmt sie ihn mit zu Mirta, die in dem armseligen Stadtteil Chicharrones wohnt. Nachdem er seine Geschenke abgegeben hat, ahnt er, dass die beiden Frauen ihn betrügen, und einige Zeit später findet er heraus, dass Mirta und Iliana gar nicht verwandt sind.
Ein Kubaner äfft nach, wie unbeholfen Broschkus sich anfangs verhielt.
[…] ein echter teutón eben, überall Verrat, Beschiss, Abzockerei witternd und trotzdem bestens übers Ohr zu hauen. (Seite 400)
Auf Balkonen und in Verschlägen auf dem Dach mästen die Kubaner Schweine. Als Ernestos Bruder Reinaldo schlachtet, schaut Broschkus zu. Das zweihundertfünfzig Pfund schwere Tier wird durchs Treppenhaus hinunter gezerrt und an einen Baum gebunden. Dort sticht Reinaldo das Schwein ab, und es wird an Ort und Stelle ausgeweidet bzw. zerteilt.
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
überspringen Sie bitte vorerst den Rest der Inhaltsangabe.
Nach einem weiteren Monat wird Ernesto erneut fündig: Diesmal weiß er nur, dass die Gesuchte in Dos Caminos lebt und einen Halbbruder namens Alfredo hat, der als Putzmann in der Ortskirche beschäftigt ist.
Inzwischen hat Broschkus sich mit Iliana versöhnt. Sie wohnt jetzt bei ihm und führt ihm den Haushalt. Ihre kleine Tochter Claudia zerquetscht gern Käfer und quält auch andere Tiere. Broschkus versichert Iliana, er werde höchstens zwei Tage wegbleiben, und zum Abschied lädt er sie in ein Restaurant ein.
Während man im „Balcón“ Dollar-Schwein oder –Huhn servierte,
auf Vorbestellung auch mal etwas Illegales, war das „Ranchón“ ein ausgewiesenes Fischlokal. Allerdings eines, in dem man seit Anbruch der Spezialperiode keinerlei Fisch mehr bekam. Auf einer Schiebetafel neben dem Eingang bot man „spaguetty“ an, eine 290-Gramm-Portion zu fünf Peso, die’s ebensowenig gab. Dafür Peso-Huhn, was für ein Abschiedsessen allemal reichte […] (Seite 409)Uy, mamita, ich wär‘ gern deine Unterhose!“, flehte sie allen Ernstes einer an, der zwischen den Tischen tanzte.
„Da würdest du dir aber die Nase zuhalten müssen, Kleiner“, fertigte ihn Iliana ab. (Seite 409)
In Dos Caminos fragt Broschkus sich zu Alfredos Haus durch. Eine alte Frau erklärt dem unerwarteten Besucher, Alicia sei zu ihrem Vater geritten und werde erst am Abend zurückkommen. Alfredo misstraut dem Weißen, der behauptet, Sarabanda Mañunga zu heißen und dem afrokubanischen Kult Palo Monte anzugehören, und Mirta habe ihn geschickt, weil Lugambe – der Herr der Hörner – ein Opfer verlange. Die Schweine seien noch viel zu klein, klagt Alfredo, aber als Broschkus dafür bezahlt, bereitet er eine Opferung in der Kirche vor. Broschkus muss das Tier töten, doch nachdem er mehrmals ungeschickt in den Hals des Ferkels gestochen hat, führt Alfredo ihm die Hand. Weil Broschkus das Hemd ausgezogen hat, merkt Alfredo, dass sein Oberkörper keine kultischen Narben aufweist. Der Fremde ist also kein Mitglied des Palo Monte. Kurz nachdem Alicia auftaucht und Broschkus feststellt, dass es sich nicht um die Gesuchte, sondern um ein kleines Mädchen handelt, verliert er das Bewusstsein.
Als er in die „Casa el Tivolí“ zurückkommt, steht dort ein ein hüfthoher, heftig mit bunten Elektrokerzen blinkender Plastikchristbaum, und Luisito meint, es sei doch schon der 30. Oktober, da könne man sich langsam auf Weihnachten freuen. Broschkus sei vier Monate fort gewesen, behauptet Luisito und verspricht, das Geld zurückzubringen, das er sicherheitshalber aus der Kommode genommen habe. Iliana lebt inzwischen mit einem Belgier namens Eric zusammen.
In Dos Caminos wurde Broschkus auch seiner Visa-Karte beraubt. Durch einen 30 Dollar teuren Telefonanruf bei dem Unternehmen erfährt er, dass die Kreditkarte wegen ungewöhnlich hoher Abbuchungen zu seinem Schutz gesperrt wurde. Erst nach Rücksprache mit seiner Bank könne man eine neue Karte ausstellen. Weil auf Kuba keine anderen Kreditkarten akzeptiert werden, bleiben Broschkus nur noch 70 Dollar. Luisito organisiert deshalb, dass der Deutsche von Dollar auf Pesos umgestellt wird. Dabei bleibt im Grunde alles wie bisher, aber Broschkus braucht nur noch einen Bruchteil der früheren Preise zu bezahlen.
Ernesto rät seinem Freund zur Abreise:
„Du solltest nach Hause fahren, sir, du bist zu schwach für unser Klima, dir setzt die Hitze zu. Und auch, tut mir leid, das Land selbst und seine Leute, wir haben einfach eine stärkere Kultur.“ (Seite 514)
Aber Broschkus lässt sich nicht einschüchtern. Stattdessen lauert er Mirta in Chicharrones auf, setzt ihr ein Messer an die Kehle und zwingt sie, ihm zu verraten, wo am Heiligen Abend das Fest für Lugambe stattfinden wird: In der Schwarzen Kapelle in den Bergen bei Baracoa.
Cuqui hält es für möglich, dass Lugambe mit Iliana identisch sei. Broschkus wundert sich, dass der Herr der Hörner auch eine Frau sein könne.
Nach und nach erfährt er, dass der in der Santería als Heiliger und Erster Krieger verehrte Armandito Elegguá im Lauf der Zeit Menschen aller Hautfarben geopfert habe: trigeños, criollos, mulatos, jabaos, coloraos, negro moro, negro casi indio, mulato casi negro. Auch ein china sei unter den Geopferten gewesen, heißt es; nur eine rein weiße Haut fehle noch.
Als Ulysses verhaftet wird, weil er die verbotene Teilnahme von Kubanern am US-Lotto organisierte, hofft Flor, endlich ein eigenes Bett zu bekommen.
Kuba sei ein freies Land, widersprach sie [Flor] Broschkus‘ Erwägungen noch schnell, an der Leiter verharrend: Es habe die Freiheit, seine Bürger ins Gefängnis zu werfen, wann immer es beliebe. (Seite 607)
Am 13. Dezember lässt Broschkus sich in einer feierlichen Zeremonie die Schnittwunden beibringen, die ihn zu einem Mitglied des Palo Monte machen. Danach bricht er bewusstlos zusammen, und als er wieder zu sich kommt, heißt es, er habe einem Huhn in den Hals gebissen und das Blut des Tieres getrunken.
Zehn Tage später, als von den Schnittwunden nur noch Narben zu sehen sind, fährt Broschkus mit Ernesto nach Baracoa, aber das geliehene Auto bleibt unterwegs liegen, und Broschkus muss allein weiter. In Baracoa erkundigt er sich nach „Felicidad“, bis ihn das schwule Paar Angel und Wilfredo darüber aufklärt, dass der Ort inzwischen La Prueba genannt werde. Am nächsten Tag macht Broschkus sich auf den Weg. Ein Rudel Hunde verfolgt ihn. La Prueba ist ausgestorben. Broschkus findet nur einen Greis namens Humberto, der ihm erklärt, dass die anderen Bewohner in der Schwarzen Kapelle auf dem Pico del Gato das Fest zu Ehren des Herrn der Hörner feierten. Sie seien am Morgen aufgebrochen; wegen des weiten Weges gebe es nun keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig hinzukommen.
Broschkus geht am anderen Morgen los und begegnet bald den Bewohnern von La Prueba, die von der Schwarzen Kapelle zurückkommen.
Endlich erreicht er sein Ziel. In der Nähe der Kapelle hängt die Leiche einer nackten, enthaupteten Frau in einem Baum. Man hat sie gekreuzigt, ihr die Brüste abgeschnitten; aus ihrem Bauch und Unterleib sind die Eingeweide hervorgequollen. In die Haut wurden Zeichen geritzt. Vögel haben auf die Leiche eingehackt. Als Broschkus den abgetrennten Kopf findet und feststellt, dass es sich bei der Geopferten um Iliana handelt, bricht er tot zusammen.
Denn das Helle vergeht, doch das Dunkle, das bleibt. (Seite 727)
Matthias Politycki (* 1955) präsentiert uns in seinem fulminanten Monumentalroman „Herr der Hörner“ eine Welt von Armut, Improvisation und Überlebenskunst, Gier und Gewalt, Betrug, Täuschung und Korruption, in der die katholische Religion eng mit archaischen Riten verbunden ist.
Das einzige, das man hier wirklich nicht ertrug, war Stille, das einzige, das man nicht tolerierte, war jemand, der allein sein wollte. (Seite 298)
Der Zivilisation überdrüssig, verschreibt sich ein Hamburger Bankmanager der kubanischen Vitalität und afrokubanischen Kulten. Bei seinem Versuch, neue Wurzeln zu schlagen, gerät er immer stärker in den Bann des Irrationalen und kann kaum noch zwischen Realität und Traum, Illusion und Täuschung unterscheiden. „Herr der Hörner“ ist gewissermaßen ein umgekehrter Bildungs-, ein Verwilderungsroman.
„Ihr habt alle keinen Bezug mehr zum Wesentlichen, ihr Weißen. Kein Wunder, dass ihr jetzt untergeht.“ (Seite 562)
Psychologische Entwicklungen scheinen Matthias Politycki jedoch nicht zu interessieren; wir erfahren denn auch kaum etwas über die Vorgeschichte des Protagonisten und nur wenig über seine Motive. Die Figuren sind zwar farbig, aber Matthias Politycki hat keine facettenreichen, widersprüchlichen Charaktere geschaffen, eher schon Karikaturen.
Obwohl die Handlung des Romans „Herr der Hörner“ auch nicht besonders komplex oder vielschichtig ist, halten einprägsame Episoden, eine kraftvolle Darstellung und eine dichte Atmosphäre das Interesse des Lesers über mehr als 700 Seiten wach. Es gibt tragikomische Szenen und viel Ironie. Die Sprache ist manieriert, und Matthias Politycki zeigt einen ausgeprägten Willen zur Form, zu der auch bewusste Wiederholungen beitragen. So beginnt und endet der Roman „Herr der Hörner“ mit dem Satz „Das Helle vergeht, doch das Dunkle, das bleibt.“ Zwischendurch variiert Matthias Politycki zum Beispiel des Öfteren eine Treppensturz-Szene (Seite 17, 61, 157, 175, 358, 650, 699).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2009
Textauszüge: © Hoffmann & Campe
Matthias Politycki (kurze Biografie / Bibliografie)
Matthias Politycki: Weiberroman
Matthias Politycki: Jenseitsnovelle