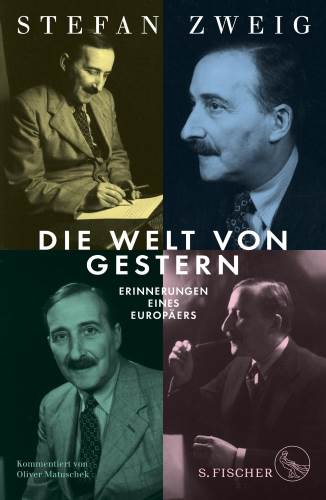Mein letzter Film

Mein letzter Film
Inhaltsangabe
Kritik
Die berühmte Film- und Fernsehschauspielerin Marie Lorenz (Hannelore Elsner) hat sich mit einem jungen Mann (Wanja Mues) in einem Café in Berlin verabredet. Sie schiebt ihm ein Geldkuvert über den Tisch, trinkt einen Espresso und schlägt dann vor, gemeinsam in ihre Wohnung zu gehen.
Was auf den ersten Blick wie das Treffen einer älteren Frau mit einem Callboy aussieht, ist tatsächlich nicht harmlos: Der junge Mann hat eine Videokamera dabei und soll Maries „letzten Film“ aufnehmen. In der geschmackvoll eingerichteten Altbauwohnung, die sie früher mit ihrem Ehemann und Regisseur Richard teilte, soll er filmen, wie sie einen Koffer packt und dabei mit den vier Menschen abrechnet, die ihr wichtig waren.
In ihrem „letzten Film“ wendet die 56-Jährige sich an ihren sieben Jahre älteren Ehemann, der sie vor gut einem Jahr verließ und aus der Wohnung auszog. Zu Beginn der Siebzigerjahre hatte er sie für den Film entdeckt und bald darauf geheiratet. Als sie ihm vor 17 Jahren sagte, dass sie schwanger war, reagierte er darauf, als ob es sich um Missgeschick gehandelt hätte. In den Monaten der Schwangerschaft dachte Marie sich immer neue Namen für das Mädchen aus, das in ihrem Bauch heranwuchs, aber als es dann an ihrer Brust lag und die Schwester fragte, welchen Namen sie auf das Plastikarmbändchen schreiben solle, wusste sie keinen mehr. Drei Tage später starb das namenlose Neugeborene. Es hatte einfach aufgehört zu atmen. Später fand Marie heraus, dass Richard sie mit Jüngeren aus dem Filmteam betrog.
Nachdem er sie verlassen hatte, fand Marie für kurze Zeit Trost bei dem enthusiastischen Fußballtrainer Tomas. Sie wundert sich noch heute darüber, dass die Medien zwar „sie hat einen Jüngeren“ schrieben, nicht aber „er hat eine Ältere“.
Zuletzt traf sie sich gelegentlich mit dem verheirateten Politiker Paul in einem Hotelzimmer.
In der Bilanz ihrer Orgasmen (viermal Richard, dreimal Tomas, einmal Paul, zweimal andere Männer) taucht noch ein weiterer Name auf: Christian gehörte Ende der Sechzigerjahre zu den politischen Kaufhausbrandstiftern. Es war der Geliebte ihrer besten Freundin Elisabeth („Beth“), die sich ebenfalls der APO angeschlossen hatte. Als er von der Polizei gesucht wurde, bat Elisabeth ihre Freundin, Christian bei sich zu verstecken. Vier Wochen, so viele Weltverbesserungsideen gebe es gar nicht, dass man 28 Nächte lang darüber diskutieren könne, sagt Marie sarkastisch in die Kamera.
Jeder Gegenstand, den sie aufnimmt, erinnert sie an etwas. Sie schaut noch einmal aus dem Fenster auf die Straße hinunter, läuft durch die Wohnung und zündet sich eine Zigarette nach der anderen an. Der junge Mann hat die Videokamera längst vom Stativ geschraubt und versucht ihr durch die Zimmer zu folgen. Schließlich bittet Marie den Mann, sie allein zu lassen. Den Rest wolle sie allein aufnehmen. Sie schraubt die Kamera wieder aufs Stativ und spricht weiter. Als der junge Mann noch da war, lief sie einmal aus dem Zimmer, weil sie sich vor Erregung übergeben musste. Jetzt eilt sie kurz aus dem Bild, um ihre Wut herauszubrüllen.
Am Ende nimmt Marie die Videokassette aus der Kamera, schreibt für Richard darauf und stellt sie auf den Kaminsims. Dann nimmt sie ihren großen Koffer und fährt mit ihrem Wagen los. Während sie das Fahrzeug durch die Berliner Straßen lenkt, muss sie albern kichern.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Eine berühmte Schauspielerin dreht kurz nach dem Höhepunkt ihrer Karriere ihren „letzten Film“, ein Homevideo für ihren Ehemann und Regisseur, in dem sie Bilanz zieht und verbal mit ihm und den drei anderen Menschen abrechnet, die ihr außer ihm am nähesten standen. Dann verlässt sie die Wohnung, um irgendwo neu anzufangen. „Ich werde in der Form meines Lebens sein“, sagt sie zum Schluss zynisch lächelnd in die Kamera, „und niemand sieht es.“
Leidenschaftlich, witzig, süffisant und sarkastisch, mal zornig, dann wieder melancholisch erinnert Marie sich an ihre beste Freundin, ihren Ehemann und zwei Liebhaber, die sie nach dem Scheitern ihrer Ehe auffingen. Lebensklug reflektiert sie über Männer und Frauen. Auch um das Älterwerden kreisen ihre Gedanken. „Jetzt ist, wenn es wehtut“, pflegte ihr Mann zu sagen. Es schmerzt, wenn Marie sich lange unterdrückten Einsichten stellt.
„Mein letzter Film“ ist ein Einpersonen-Kammerspiel ohne bemühte Intellektualität, „keine aufdringlich virtuose One-Woman-Show“ (Martina Knoben in „Süddeutsche Zeitung“, 28. November 2002), sondern „ein atemberaubendes Gedanken- und Gefühlswerk über die Paradoxien der Liebe zwischen Mann und Frau“ („Der Spiegel“, 25. November 2002).
In den ersten und letzten Minuten hält eine professionelle Filmkamera das Geschehen fest. Dazwischen sehen wir nur durch die Videokamera, mit der Maries „letzter Film“ aufgenommen wird. Das amateurhafte Zoomen, die Probleme mit der Schärfe, das Verreißen der Kamera, die fehlende Ausleuchtung Maries vor dem hellen Fenster: das suggeriert Authentizität.
Es ist also nicht mehr zu sehen als eine Frau, die in ihrer Altbauwohnung herumgeht, ihren Koffer packt, sich hin und wieder setzt und dabei in die Kamera spricht. Das klingt schrecklich langweilig, ist es aber nicht, im Gegenteil: Es ist unglaublich spannend, anregend, auch unterhaltsam. Das liegt nicht nur am dramaturgisch geschickten Wechsel der Stimmungen und am Spiel mit der Neugier des Publikums auf Klatschgeschichten, sondern ganz besonders am Text von Bodo Kirchhoff (*1948). Es ist erstaunlich, wie dieser Mann sich in eine alternde, lebenskluge Frau hineindenkt. Aber vor allem stellt der Film eine schauspielerische Meisterleistung Hannelore Elsners dar. Sie hält die Zuschauer mit ihrer Mimik und Gestik in Bann und spricht den ausgefeilten Text so, als entstehe er gerade erst spontan in ihrem Kopf.
Die Dreharbeiten dauerten nur zwei Wochen, und das Schneiden nahm gerade mal eine weitere Woche in Anspruch. Damit ist bewiesen, dass auch mit einem kleinen Budget ein Kunstwerk geschaffen werden kann.
2005 drehte Oliver Hirschbiegel ein weiteres Einpersonen-Kammerspiel:
„Ein ganz gewöhnlicher Jude“.
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002