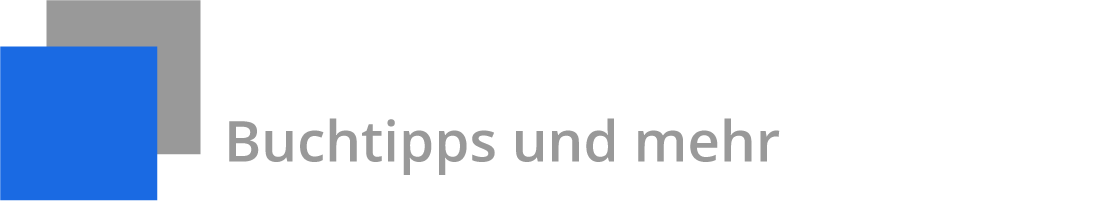Hammerklavier, Pianoforte
Als im ausgehenden Mittelalter das von der Orgel bekannte Prinzip der Tasten erstmals auf ein Saiteninstrument übertragen wurde, entstand das Klavichord. Etwa zur gleichen Zeit kamen weitere Tasteninstrumente auf: das Spinett und das Cembalo. Diese beiden Musikinstrumente, deren Saiten nicht wie die des Klavichords angeschlagen, sondern mit einem Federkiel angerissen wurden, unterschieden sich durch die Anordnung der Saiten: Beim Cembalo verliefen sie parallel zu den Tasten, beim Spinett schräg dazu. Das Cembalo verfügte über eine größere Lautstärke als das Klavichord, das jedoch nuancenreicher gespielt werden konnte, weil die Lautstärke mit der Kraft des Anschlags variierte
und der Kontakt zur Saite erhalten blieb bis die entsprechende Taste losgelassen wurde.
Um die Lautstärke des Klavichords zu erhöhen, ohne seine Vorzüge aufzugeben, erfand der Italiener Bartolomeo Cristofori 1698 in Florenz das Hammerklavier („gravicembalo col piano e forte“). Dessen wesentliche Neuerung war die Anschlagtechnik: Beim Hammerklavier oder Pianoforte wurde die Saite durch einen von unten hochgestoßenen mit Leder überzogenen Hammer angeschlagen, der sofort wieder zurückfiel und die Saite freigab. Mittels besonderer Hebel – die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu den heute üblichen Pedalen weiterentwickelt wurden – konnte die Schwingung auch nach dem Anschlag beeinflusst werden.
Die Florentiner blieben dem Pianoforte gegenüber reserviert. Der Durchbruch erfolgte erst, als Gottfried Silbermann um 1720 nach demselben Prinzip Klaviere baute, König Friedrich II. von Preußen fünfzehn dieser neuartigen Musikinstrumente kaufte und Mitte des 18. Jahrhunderts „der Musikgeschmack nach einem Tasteninstrument verlangte, das sowohl ein großes Klangvolumen aufbieten als auch ausdrucksvolle melodische Linien darstellen konnte“ (Michael Raeburn und Alan Kendall (Hg.): Geschichte der Musik)
© Dieter Wunderlich 2007