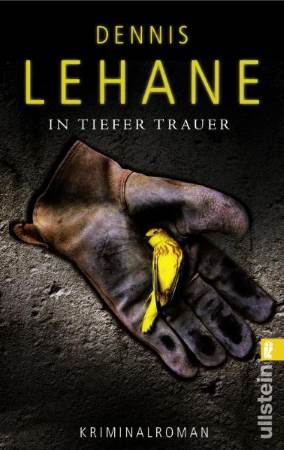Heidi Marks
Heidi S. wurde am 25. Februar 1957 als Tochter eines Schreiners und dessen Ehefrau geboren, die drei Jahre zuvor geheiratet hatten. Als Heidi zwei Jahre alt war, zogen die Eltern mit ihr nach Eschenau südwestlich von Knetzgau am Nordrand des Steigerwalds. Weil es in dem aus etwa dreißig Bauernhöfen bestehenden Dorf mit rund einhundertfünfzig Einwohnern kein Geschäft gab, musste man zum Einkaufen mit dem alle zwei Wochen verkehrenden Bus in die nächste Stadt fahren. Über ein Auto verfügte noch kaum jemand. Nahrungsmittel brauchten die meisten Bewohner nicht zu kaufen; damit versorgten sie sich selbst: Auch Heidis Eltern bauten Gemüse und Kartoffeln an, hielten ein Schwein, Stallhasen und Geflügel.
Im Alter von vier Jahren bekam Heidi im Mai 1961 eine Schwester. Kurz darauf wurde sie beim Erdbeerpflücken im eigenen Garten von einem vierzehnjährigen Nachbarjungen überfallen, in eine Reisighütte gezerrt und zur Fellatio gezwungen. Von da an nutzte der Heranwachsende jede Gelegenheit, dem verschreckten Mädchen unter den Rock zu greifen und es sexuell zu
missbrauchen. Den Eltern erzählte Heidi nichts, denn der Junge schärfte ihr ein, die Mutter würde sie dann nicht mehr mögen: »Sie hat ja auch schon ein neues Mädchen.« Außerdem drohte er damit, dass die Dorfbewohner die zugezogene Familie aus dem Ort jagen würden, wenn sie das Geheimnis erführen. »Mir war als Vierjähriger schon bewusst, dass es sehr wichtig war, was die Leute von uns dachten«, erinnert sich Heidi Marks in ihrem Buch »Als der Mann kam und mich mitnahm«. Sie begann zu lügen, um die Vorfälle zu vertuschen, hielt sich für ein verdorbenes Kind und zog sich immer stärker in sich selbst zurück. »Manchmal, wenn Mutter mich nicht beim Lügen erwischte, stellte ich extra etwas an, damit sie mich bestrafte. Ich dachte, dann würde ich mich nicht so schlecht fühlen, ich hätte ja schließlich für meine Tat gebüßt.« Die Mutter, die nicht ahnte, was Heidi durchmachte, erklärte sich deren Verhaltensänderung als Folge der Eifersucht auf ihre jüngere Tochter.
Heidi versuchte, dem Nachbarjungen aus dem Weg zu gehen, aber er lauerte ihr immer wieder auf; einmal missbrauchte er sie sogar auf dem Friedhof neben der Kirche, wo sie das Familiengrab goss.
In der Schule gehörte Heidi zwar zu den Außenseiterinnen, aber der Lehrer schlug ihren Eltern vor, sie von der vierten Klasse aufs Gymnasium wechseln zu lassen. Heidi sträubte sich dagegen, und die Eltern versuchten vergeblich, ihr zu erklären, welche Chancen sie sich damit eröffnen würde. »Ich war als Zehnjährige noch genauso naiv wie mit vier, konnte weder mit anderen Kindern umgehen noch ihre Reaktionen einschätzen […] Kinder verstand ich nicht und Erwachsene auch nicht […] Ich fühlte mich minderwertig und unverstanden.« Sie wollte sterben. Wenn sie tot wäre, würden alle um sie trauern und ein schlechtes Gewissen haben. »Als Kind ist man verwundert, warum man böse sein muss und gezwungen wird, etwas zu tun, was man gar nicht will. Warum ein Erwachsener will, dass man etwas Böses tut, wenn doch die Mama immer gesagt hat, man darf nicht böse sein. Das lässt einem kleinen Kopf einfach keine Ruhe. Man weiß nicht mehr, was man machen soll, ist völlig durcheinander.« Anfangs war sie noch zu klein gewesen, um zu verstehen, was der Nachbarjunge mit ihr gemacht hatte, dann schwieg sie wegen seiner Drohungen, schließlich aus Scham und aus Furcht vor dem Gerede.
Um mehr Geld zu verdienen und sich mit Hilfe von Freunden und Bekannten ein größeres Haus in Eschenau bauen zu können, gab der Vater das Schreinerhandwerk auf und nahm eine besser bezahlte Stelle in einem Gipswerk an. Alle halfen mit auf der Baustelle. Heidi wurde losgeschickt, um Essen zu holen. Doch als sie einen benachbarten Bauernhof durchquerte, packte sie ein drei Jahre älterer Mitschüler, der hier wohnte und zerrte sie in die Scheune. Dort vergewaltigte er die Zehnjährige. Heidi Marks erinnert sich, dass sie schrie und sein Vater hereinschaute, sich aber gleich wieder umdrehte und hinausging. »Sag bloß nichts oder ihr werdet mit Schimpf und Schande vertrieben«, drohte der Bauernsohn. »Huren sind im Dorf nicht beliebt!« Heidi wusste noch nicht, was eine Hure ist, aber das Wort hatte sie schon gehört, und sie ahnte, dass es etwas Schlimmes bedeutet. – Erst als es dunkel war, schlich sie nach Hause. Die Schwester hatte überall im Dorf vergeblich nach ihr gesucht. Wo sie gewesen sei, wurde Heidi gefragt. »Nirgends«, antwortete sie kleinlaut. Da gab es Schläge.
Der andere Junge, der sie seit ihrem vierten Lebensjahr missbraucht hatte, war inzwischen bei der Bundeswehr, aber nun musste Heidi an jeder Ecke damit rechnen, dass der Bauernsohn auftauchte und mit ihr ausprobierte, was er in Magazinen gelesen hatte. Vermutlich erzählte er auch seinen Freunden, was er mit ihr anstellte, denn sie blickten Heidi hämisch an, hielten das hübsche Mädchen für ein Flittchen. Einer von ihnen fuhr mit ihr auf seinem neuen Moped auf einen Feldweg, begann sie zu begrabschen und war verwundert, als sie sich wehrte. »Nicht noch einer, dachte ich.«
Unbeschwert war Heidi nur, wenn sie zum Beispiel Nachbarn bei der Feldarbeit half und wusste, dass sie in Sicherheit war. Die ratlose Mutter konsultierte mit ihr schließlich den Hausarzt. Der erklärte, das Kind sei ein »ungezogener Fratz […], und damit war die Sache erledigt«.
Im letzten Schuljahr drängte Heidi ihre Eltern, sie in der diakonischen Anstalt im hundert Kilometer entfernten Neuendettelsau eine Hauswirtschaftslehre machen zu lassen. Ohne zu wissen, warum die Fünfzehnjährige unbedingt aus Eschenau fort wollte, stimmten die Eltern zu. Im August 1972 traf Heidi in Neuendettelsau ein. »Dort kannte mich niemand, und ich konnte ganz von vorne anfangen.«
Nach der Ausbildung verschaffte eine Tante ihr eine Stelle in einer Großküche in München. Für das Kellerzimmer, das Heidi bei den Verwandten bezog, musste sie allerdings mehr als sechzig Prozent ihres Lohnes bezahlen. Nach ein paar Monaten wurde ihr die Anstellung gekündigt, auf Betreiben ihrer Tante, glaubt Heidi Marks, die verärgert gewesen sei, weil sie sich ein anderes Zimmer genommen hatte. Kurze Zeit arbeitete sie als Hausangestellte, dann als Vertreterin für Enzyklopädien. Nichts glückte. Erneut wurde sie von dem Gefühl niedergedrückt, eine Versagerin zu sein. In ihrer Verzweiflung schluckte die Achtzehnjährige eines Abends alle verfügbaren Tabletten. Zwölf Tage nach dem [Suizidversuch] kam sie in einem Krankenbett wieder zu sich: Ihre Vermieterin hatte gerade noch rechtzeitig nach ihr gesehen. Als sie das Krankenhaus verlassen konnte, holte ihr Vater sie ab und brachte sie nach Eschenau.
Ein Onkel vermittelte Heidi eine Stelle als Bedienung in einem Hotel im Schwarzwald, und mit einundzwanzig ließ sie sich überreden, die Gaststätte des Sportvereins im Nachbarort Eckenhaid zu übernehmen. Doch als sie mit ihrem ersten Auto verunglückte und wochenlang nicht arbeiten konnte, endete ihre Tätigkeit als Wirtin. Daraufhin kehrte sie in den Schwarzwald zurück. Wieder ging es nicht lange gut.
Unvermittelt, ohne lang darüber nachzudenken, kaufte sie sich 1981 einen Flugschein nach San Francisco und fuhr zu einer Freundin ins Rheinland, um dort auf den beantragten Reisepass zu warten. Auf dem Weg nach Frankfurt am Main ließ sie unterwegs ihr Auto stehen und fuhr mit dem Zug weiter, damit sie von ihren Eltern und Schwestern nicht so leicht aufgespürt werden konnte. Die Vierundzwanzigjährige, die einen radikalen Neuanfang anstrebte, traf am 3. Dezember 1981 in San Francisco ein.
Heidi kannte die Telefonnummern von drei US-Soldaten, die nach einem Manöver ihres Bataillons in den Wäldern am Nordrand des Steigerwalds einen Sportplatz für den SC Eckenhaid angelegt hatten, während sie die Wirtin der Vereinsgaststätte gewesen war. Die ersten beiden Nummern wählte sie vergeblich, doch beim dritten Versuch meldete sich die Mutter eines der Soldaten. Rick Marks, so hieß der Offizier, lud sie ein, Weihnachten mit ihm, einem Onkel, einer Tante und deren acht Kindern in Tacoma, Washington, zu verbringen. Als Ricks Cousine Lisa erfuhr, dass Heidi in den USA bleiben wollte, besorgte sie ihr eine Stelle als Kellnerin in einer Gaststätte in Seattle. Einige Wochen später, am Valentinstag, machte Rick ihr einen Heiratsantrag; am 2. April 1982 heiratete das Paar standesamtlich in Tacoma und ein Jahr später kirchlich in Fort Wayne, Indiana, wo Ricks Eltern lebten.
Im November 1984 rief Heidi Marks ihre Mutter an und gratulierte ihr zum 50. Geburtstag. Erst jetzt erfuhren die Eltern und Schwestern, wo sie sich aufhielt. Allerdings verriet Heidi immer noch nicht, warum sie ohne ein Wort verschwunden war.
Heidi Marks erwarb ein High-School-Diplom, arbeitete ehrenamtlich beim Roten Kreuz, absolvierte eine Ausbildung zur Lehrerin für Datenverarbeitung und begann, Soldaten und Zivilangestellten der Armee im Umgang mit dem Computer zu schulen.
Als sie nach fünf Jahren Ehe noch kein Kind hatte, kamen die Schuldgefühle und Depressionen zurück. Heidi hatte Rick vor der Hochzeit von dem jahrelangen Missbrauch in ihrer Kindheit erzählt, aber darüber redeten sie nicht weiter.
1993 wurde Rick Marks nach Wiesbaden versetzt. Heidi begleitete ihn und schulte US-Soldaten in Süddeutschland, Belgien, Holland und Norditalien in verschiedenen Software-Anwendungen, bis sie und ihr Mann nach drei Jahren wieder nach Tacoma zurückkehrten, wo sie seit acht Jahren ein Haus besaßen. Mit Ricks Einsatz in Europa endete auch seine Dienstzeit bei der Armee. Die Untätigkeit machte ihm schwer zu schaffen, und weil er in dieser Zeit mit sich selbst beschäftigt war, konnte er seiner Frau nicht beistehen, die noch immer von Depressionen niedergedrückt wurde. Ihr Zustand verbesserte sich zwar, nachdem ihr eine Ärztin Antidepressiva verordnet hatte, aber die Ehekrise hielt an, bis Heidi, die inzwischen als Lehrerin an einem Business College arbeitete, Anfang 2000 eine Beförderung annahm, die mit einer Versetzung nach Oregon verbunden war. Da merkten die beiden, wie sie sich vermissten. Nachdem Rick ebenfalls eine Stelle in Oregon bekommen hatte, vermieteten sie ihr Haus in Tacoma, und er zog im Mai 2000 zu seiner Frau nach Oregon.
Im Sommer 2000 erfuhr Heidi Marks, dass ihre jüngste Schwester in Eschenau schwanger war. Müsste sie ihre Schwester nicht warnen, falls diese ein Mädchen zur Welt brachte? Und warum hatte sie selbst keine Kinder bekommen? Plötzlich kam alles wieder hoch. »Ich habe ein Leben lang Schuldgefühle aufgebaut, hatte nie Selbstvertrauen, kämpfte mit Minderwertigkeits- und Schuldkomplexen.« Im Juni 2001 musste sie ihre Arbeit aufgeben. »Ich ging nach Hause, zog mich um und legte mich auf das Sofa. Da verbrachte ich – mit Unterbrechungen – die nächsten zwei Jahre, hatte immer den Fernseher laufen, damit ich ja nicht denken musste. Ich ging nicht mehr aus dem Haus, mein Mann erledigte alle Einkäufe […] Ich verfiel immer tiefer in dieses stumpfe Dasein, ich schämte mich, dass mein Mann alles tun musste, was dann hieß, dass ich noch depressiver wurde.« Heidi Marks nahm fünfzehn Kilogramm zu. Ein Teufelskreis!
Im März 2007 kam Heidi Marks mit ihrem Mann – mit dem sie im Jahr zuvor nach Fort Wayne, Indiana, gezogen war – für vier Wochen nach Deutschland, um ihren 50. Geburtstag und die Silberne Hochzeit mit den Eltern, ihren beiden Schwestern und deren Familien in ihrem Heimatort zu feiern. Fünf Tage vor dem geplanten Rückflug saß sie mit ihrem Mann und einer Freundin zusammen. Die in Eschenau wohnende Frau erwähnte einen Zeitungsartikel über die Zunahme von Sexualdelikten in Bayern. Daraufhin meinte Heidi Marks: »Das glaub ich nicht! Diese Straftaten gab es schon immer, nur jetzt werden sie endlich angezeigt!« Ein Wort ergab das andere, und plötzlich erzählte die Freundin, ihre Schwester habe im Januar des Vorjahrs einen Eschenauer angezeigt und beschuldigt, sie 1973 vergewaltigt zu haben. Sie war damals vierzehn, er neunzehn. Die Anzeige hatte allerdings wegen Verjährung keine Folgen. Die Freundin zögerte, den Namen des Beschuldigten zu nennen, aber Heidi Marks erriet ihn. Da erzählte Heidi Marks schluchzend, was ihr selbst als Kind widerfahren war.
Nachdem Heidi Marks nun wusste, dass sie nicht das einzige Opfer war, wollte sie nicht länger schweigen. Das bedeutete aber auch, dass sie ihren Eltern wehtun musste. Wie würden sie es verkraften, zu erfahren, dass ihre älteste Tochter jahrelang vor ihren Augen missbraucht worden war? Als erstes vertraute sich Heidi Marks ihrer jüngsten Schwester an, die mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Söhnen noch in Eschenau lebte, während die andere Schwester nach Ansbach geheiratet hatte. Obwohl ihr klar war, dass die Taten verjährt waren, ging sie am 28. März zur Polizei und gab ihre Erinnerungen zu Protokoll. Für den nächsten Tag war die Abreise geplant, aber Rick Marks schlug vor, den Rückflug um zehn Tage auf den 8. April zu verschieben. Das gab Heidi Zeit, ihren Eltern zu erzählen, was vor mehr als fünfunddreißig Jahren geschehen war.
Mit ihrer Aussage löste Heidi Marks in ihrer Heimatgemeinde ein Beben aus:
Der Fall Eschenau.
Heidi Marks beschrieb die Vorgänge in einem Buch mit dem Titel »Als der Mann kam und mich mitnahm. Die Geschichte eines Missbrauchs«.
© Dieter Wunderlich 2007 / 2008
Die meisten Zitate stammen aus dem Buch
„‚Als der Mann kam und mich mitnahm‘. Die Geschichte eines Missbrauchs“
von Heidi Marks, © Fackelträger Verlag, Köln 2008
Der Fall Eschenau
Heidi Marks: „Als der Mann kam und mich mitnahm“. Die Geschichte eines Missbrauchs