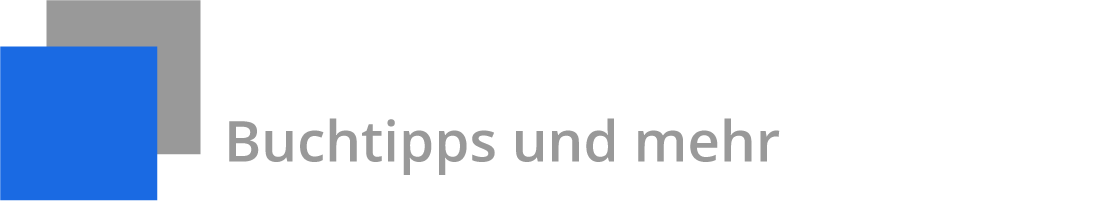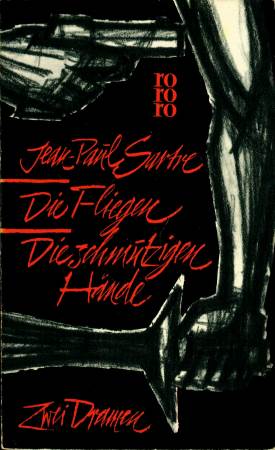Erster Weltkrieg: Friedenssondierungen
Am 12. Dezember 1916 bot Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg der Entente im Namen der Mittelmächte förmlich Friedensverhandlungen an. US-Präsident Woodrow Wilson (1856 – 1924) war am 7. November wieder gewählt worden; und sowohl Wien als auch Berlin wollten einer von ihm nun erwarteten Friedensinitiative zuvorkommen. Das Deutsche Reich und seine Verbündeten schlugen den Gegnern vor, über einen Friedensvertrag zu verhandeln.
Konkrete Friedensbedingungen nannten sie nicht, betonten aber ihre „unüberwindliche Kraft“, die „gewaltigen Erfolge“ und ihren Willen, „den ihnen aufgezwungenen Kampf nötigenfalls bis zum Äußersten fortzusetzen“. Die Deutschen waren noch immer zuversichtlich; sie glaubten, den Krieg gewinnen zu können, wenn sie nur alle Kräfte anspannten. Paris und London wären jedoch auf keinen Fall bereit gewesen, auf den Vorschlag einzugehen: Obwohl deutsche Truppen noch immer tief in Frankreich standen und die alliierten Vorstöße an allen Fronten gescheitert waren, meinten die Westmächte, dass die Zeit für sie arbeitete. In einer gemeinsamen Note lehnte die Entente deshalb am 10. Januar 1917 das Angebot der Mittelmächte ab.
Woodrow Wilson sprach sich in seiner Jahresbotschaft an den Senat für einen „Frieden ohne Sieg“ aus (22. Januar 1917).
Am 21. November 1916 war Kaiser Franz Joseph I. gestorben, und sein Großneffe, Kaiser Karl I., wollte den Krieg so rasch wie möglich beenden. Im Frühjahr 1917 versuchte er heimlich, mit der Entente ins Gespräch zu kommen und nutzte dafür die Familienbeziehungen seiner Frau Zita, deren Bruder Sixtus von Bourbon-Parma (1886 – 1934) als Offizier in der belgischen Armee diente. In einem Brief an Raymond Poincaré versicherte Karl I. am 24. März 1917, er werde sich für die Rückgabe von Elsass-Lothringen an Frankreich und die Wiederherstellung Belgiens einsetzen. Aber die Italiener wären nicht bereit gewesen, einem Sonderfrieden mit Österreich-Ungarn zuzustimmen (Konferenz von St. Jean de Maurienne, April 1917). Als das Schreiben später veröffentlicht wurde, geriet der österreichische Kaiser in eine peinliche Situation (Sixtus-Affäre, April 1918).
© Dieter Wunderlich 2006
Erster Weltkrieg: Inhaltsverzeichnis