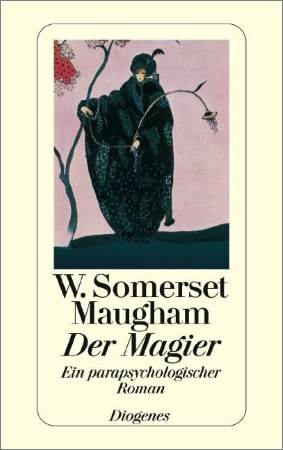Herbert Rosendorfer : Briefe in die chinesische Vergangenheit

Inhaltsangabe
Kritik
Der etwa 50 Jahre alte Mandarin Kao-tai ist Präsident der kaiserlichen Dichterakademie „Neunundzwanzig moosbewachsene Felswände“. Um 985 konstruieren er und sein Freund, der Mandarin Dji-gu, eine Zeitreisemaschine. Damit katapultiert sich Kao-tai 1000 Jahre in die Zukunft. Eigentlich sollte er auch wieder am Ausgangspunkt landen, weil die beiden Chinesen aber in ihren Berechnungen die Erdumdrehung aus Unkenntnis nicht berücksichtigten, findet er sich an einem fremden Ort wieder.
Mit Hilfe einer kleineren Zeitmaschine schickt er Dji-gu 37 Briefe und beschreibt darin die (Un-)Sitten, die er beobachtet. Seine ersten Zeilen lauten: „Die Zukunft ist ein Abgrund. Ich würde die Reise nicht noch einmal machen. Nicht das schwärzeste Chaos ist mit dem zu vergleichen, was unserem bedauernswerten Menschengeschlecht bevorsteht. Wenn ich könnte, würde ich sofort zurückkehren. Ich fühle mich in eine Fremde von unbeschreiblicher Kälte hinausgeworfen. (Obwohl es auch hier Sommer ist.)“
Noch bevor Kao-tai herausfindet, dass er sich in Min-chen, einer Stadt in Ba Yan, befindet,
erschrickt er über ein Ungetüm – später lernt er, dass es sich um ein A-tao handelt –, das ein schreckliches Geräusch ausstößt, ihn beinahe getötet hätte, dann aber auf einen Baum klettert. Bei genauerem Hinsehen merkt er, dass es sich am Stamm festgebissen hat. Grün gekleidete Schergen nehmen ihn mit. Als er seinen Namen nennt, sagt einer von ihnen: „Aha, ein Ki-Neng-Se!“ Kao-tai berichtet weiter: „Ich musste meine Finger in schwarze Tusche tauchen und dann ein Papier berühren. Vermutlich Dämonen-Abwehr. Dann kam ich in einen Raum, in dem ein Scherge mit einem unverständlichen Gerät hantierte, das kleine Blitze von sich gab. Ich musste mich auf einen bestimmten Hocker setzen, einmal geradeaus, einmal links, einmal rechts schauen. Jedesmal blitzte es im Kasten, es geschah mir aber nichts. Vielleicht handelte es sich um einen Reinigungszauber. Zur Vorsicht verbeugte ich mich vor dem Blitz-Kästchen dreimal mit einer Zwei-Drittel-Verbeugung.“
Keiner versteht die „Sprache der Menschen“; alle brüllen in einem unverständlichen Idiom. So laut wie die Leute reden, so grob sind ihre Sitten. Nicht selten – besonders wenn sie in einem A-tao sitzen – fordern sich die Großnasen gegenseitig dazu auf, den zum Sitzen bestimmten Körperteil mit der Zunge zu benetzen.
Anfangs hält er alle Menschen, denen er auf der Straße begegnet, für Männer, weil sie so große Füße haben. Nur bei Regenwetter kann er sie unterscheiden: „An den Schirmen erkennt man mühelos Männer und Weiber auseinander, die Weiber tragen nämlich verschiedenfarbige Schirme, die Männer ausschließlich schwarze. Warum das so ist, weiß ich natürlich nicht.“
Ein Richter namens Shi-shmi nimmt sich seiner an. („Herr Shi-shmi, um das hier einzuflechten, hat weder Frau noch Konkubine. Sehr merkwürdig. Dabei ist er weder Bettler noch Mönch, noch Säufer.“) Der besorgt ihm einen An-tsu und nimmt ihn mit zu einer Fahrt mit dem Ta-mam, einem fahrbaren schmutzigen Haus, in dem es nach schwitzenden Menschen riecht. „Ab und zu hielt das Eisenhaus, wobei alle Bewohner und Gäste durcheinandergeschüttelt wurden. Es ist wie bei einem ständigen Erdbeben. Die Sache scheint mir nicht ganz sorgfältig durchdacht. Immer, wenn der Ta-mam hielt, wälzten sich Massen von Leuten hinaus und andere gleichzeitig herein. Keiner grüßt oder verbeugt sich. Die Höflichkeit, sah ich wieder einmal, ist gänzlich abgekommen. Ich bin ganz, nun schon fast ganz sicher, dass diese ruhelos ständig herumschweifenden, in A-tao-Wägen rasenden, im Ta-mam-Eisenhaus hin- und herfahrenden Großnasen nicht unsere Enkel sind. Warum sie ständig unterwegs sind, ist restlos unklar. Ich kann keinen Grund erkennen. Ich vermute, die Großnasen kennen ihn selber nicht.“
Das Essen wird glühend heiß verzehrt. „Die Geschmacksorgane verschließen sich vor der Hitze sofort. Kein Mensch kann so feinere Nuancen unterscheiden.“ Kao-tai wundert sich, dass Hundefleisch als ungenießbar gilt und man nirgendwo Pekinesenleber bekommt. Dafür essen die Menschen hier Fleisch von Kühen und Ochsen. „Sollte das der Grund für ihre dumpfe Verrohung sein?“ Sie trinken Milch von Kühen und nehmen auch Milchderivate wie Bu-ta, Kai’ße und Yo-kou zu sich. Da dreht sich ihm der Magen um. Auch das schäumende Getränk, das mit Vorliebe in speziellen Gärten getrunken wird und je nach Größe Ma-‚ßa oder Hal-bal heißt, findet Kao-tai abscheulich. Da trinkt er sehr viel lieber perlenden Mo-te Shang-dong.
Kao-tai lernt sehr unterschiedliche Gaststätten kennen. In manchen Restaurants, in denen die servierten Gerichte mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen sind, darf nur ganz leise gesprochen werden. Um so lauter geht es in einfachen Schänken zu, bei denen er wegen des unerträglichen Qualms annimmt, es handele sich um Andachtsstätten für Brandopfer, zumal sich die Großnasen fortwährend kleine weiße Gebetsröllchen für ihren Rauchdämon in den Mund stecken.
Im Herbst nimmt Herr Shi-shmi seinen Gast mit zu einem besonderen Fest in Min-chen. „Schon von weitem leuchtete der Himmel über den Häusern, als ob eine Feuersbrunst ausgebrochen sei. Tosender Lärm hüllt einen ein, je näher man kommt.“ Kao-tai ist froh, dass sein Begleiter nicht darauf besteht, dass er sich in eines der rasenden oder rotierenden Ungetüme schnallen lässt und mit ihm stattdessen eines der gigantischen Zelte aufsucht. Aber da ist es noch lauter. Was die Kapelle spielt, hat mit der Musik des Meisters We-to-feng nicht das Geringste zu tun! Männer mit Haarbüscheln am Hut unterhalten sich brüllend, schütten sich das Ma-‚ßa-Getränk in den Schlund, gröhlen dazu „Wan-tswa-xu-fa“ und raufen dann auch noch. Auf dem Heimweg gesteht Herr Shi-shmi, dass ihm dieses Fest auch nicht gefalle, aber man zeige es üblicherweise den Fremden.
„Überall Nummern, Nummern“, stöhnt Kao-tai in einem seiner Briefe. „Die Großnasen führen ständig Kästchen und Zettelchen mit Nummern mit sich, haben kleine Büchlein mit unübersehbaren vielen Nummern, in denen sie ständig blättern. Überall, wo du hinsiehst: Nummern.“
Kao-tai findet unerklärliche Widersprüche in den Sitten der Großnasen. Einerseits gehört es sich nicht, eine Konkubine zu haben, und wenn jemand eine hat, dann verheimlicht er es. Andererseits liegen Männer und Frauen splitternackt im Gras der Parkanlagen. Da staunt er dann auch über die Brüste der Großnasenfrauen, die gebirgsartige Ausmaße haben. Auch in der Sao-na („Wer sie erfunden hat, und was in einem Hirn vorgeht, das solches gebiert, ist mir ein Rätsel“) entkleiden sich die Frauen ohne Scheu vor ihm und anderen Männern. Nach einigen Gläsern Mo-te Shang-dong verbeugt er sich beim Verabschieden vor der Gastgeberin und sagt: „Ich bin dankbar für das großartige Essen, das Sie an einen so unwürdigen Zwerg wie mich vergeudet haben, für das hervorragende Schwitzen sowie für den freundlichen Anblick ihres so über die Maßen umfangreichen Busens, der mich an die Formen des heiligen Berges T’ai-shan erinnert hat und den ich als kostbaren Schatz in immerwährender Erinnerung behalten werde.“ Da stutzt Frau Da-ch’ma und tritt einen Schritt zurück. Offenbar hat er etwas Unpassendes zu ihr gesagt.
Über seinen ersten Konzertbesuch berichtet er Dji-gu: „Meister Hai-ting verbeugte sich artig, dann drehte er ganz unhöflich dem Publikum den Rücken zu und drohte den Musikern mit einem Stock. Sie ließen es sich ohne weiteres gesagt sein und begannen zu spielen.“ Später erlebt er eine 7 Stunden lange Aufführung des „Pang-sing-fan“ in Bayreuth. „Die Handlung des Singspiels verstand ich nicht, obwohl sich die Darsteller bemühten, laut zu deklamieren, aber eine eher breite Musik tönte immer dazwischen. Ich wundere mich, dass der Enkel des Meisters nicht Mittel und Wege zu finden versteht, die störende Musik zu unterbinden.“ Er glaubt, dass er mit seiner Kritik nicht allein sei: „Den Leuten behagte die ganze Sache, scheint mir, nicht, denn sie tobten und wüteten, nachdem ein großer Vorhang vor der Bühne herniedergesunken war, sie verursachten Lärm durch Aneinanderschlagen der Hände (wahrscheinlich um anzudeuten, dass sie die Darsteller – oder den Meister? – ohrfeigen wollen), und als die Darsteller kleinmütig vor den Vorhang traten, wohl um Entschuldigung bittend, ließ keiner sie zu Wort kommen.“
Fünfzehn Jahre nach seiner Rückkehr ins Reich der Mitte fällt Kao-tai durch eine Hofintrige in Ungnade und kann sich nur retten, indem er sich erneut seiner Zeitmaschine anvertraut. Dieses Mal landet er in Kö-leng, und weil da alle Leute verkleidet herumlaufen, fällt er gar nicht auf. Immer wieder brüllen ihm fremde Menschen etwas wie „Kö-leng-ang-laf“ ins Ohr.
Er möchte nach Min-chen zu Herrn Shi-shmi. Ein LKW-Fahrer aus Ho-lan, der runde rote Früchte geladen hat, die offenbar Wasser enthalten, nimmt ihn mit. Aus einem Kästchen dröhnt ein Lärm, den der Fahrer wohl für Musik hält, und immer wenn Kao-tai die Augen zu öffnen wagt, versucht die Großnase gerade, mittels seines Riesen-A-tao kleinere A-tao zu zerquetschen.
Im Krankenhausbett wacht Kao-tai wieder auf. Sofort steckt ihm eine weiß gekleidete Frau von den Ausmaßen eines Pferdes ein kleines Gerät aus Glas in den Mund. Ein Arzt tritt ans Bett: „Dann machen wir einmal den Mund auf“, sagte er. Ich machte den Mund auf. Er nicht.“
Kao-tai hält es für paradox, dass man die Ärzte hier nicht entlohnt, solange man gesund ist, sondern wenn man krank ist. Wie soll da ein Arzt noch daran interessiert sein, jemand zu heilen? Aber hier ist das ohnehin nicht so wichtig, denn die Arzt- und Krankenhausrechnungen werden im Normalfall von mächtigen Institutionen wie zum Beispiel der Ao-Ka bezahlt. Ob die es aus Menschenfreundlichkeit tun, „oder ob – was ich eher annehme – irgendein Schwindel dahintersteckt, den ich noch nicht durchschaue, weiß ich nicht.“
Schließlich kann er mit der Bahn weiter nach Min-chen reisen. Dort kennt er sich kaum noch aus. „So sind die Großnasen. Sie verrücken Häuser wie wir allenfalls Möbel. Kein Haus ist für die Dauer gebaut, ununterbrochen werden Häuser abgerissen, um an deren Stelle andere zu bauen (warum? sind die neuen schöner?), die alsbald ihrerseits abgerissen werden. Man kann fast sagen, es ist ein Kommen und Gehen der Häuser…“ Dabei werden die Häuser nicht aus Holz gebaut, sondern aus einem Steinbrei gegossen.
Eine Gemüsehändlerin erkennt ihn wieder. „In einem nicht enden wollenden Redeschwall fragte sie nach meinem Wohlergehen. Ich brauchte nicht zu antworten, denn sie redete weiter, ohne eine Antwort abzuwarten, erzählte – zum Teil verstand ich es – von verschiedenen Erkrankungen ihrer selbst, ihrer Verwandten auf- und absteigender Linie und ihrer Kunden.“ Von ihr erfährt er, dass Herr Shi-shmi seit der großen Umwendung in Lip-tsing tätig sei. „Wo die Stadt Lip-tsing sei, fragte ich. ‚Im Osten‘, sagte sie, deutete aber nach Norden.“
Wieder fährt Kao-tai mit der Bahn. Doch Herr Shi-shmi befindet sich inzwischen in der Stadt Großer Apfel. Also setzt sich Kao-tai in einen Flug-Drachen. In den Ju-xä staunt er über die Kunst der Großnasen, das Innere von Autos und Gebäuden kalt zu machen. Selbst seinen Mo-te Shang-dong wollen sie ihm mit Eiswürfeln servieren! Das Hauptgetränk in den Ju-xä ist ein unbeschreibbar scheußliches Getränk, das wie ausgepresster Hund mit Zucker schmeckt und auch so braun ist. Von der vielen Rindsmilch, die sie trinken, haben die Großnasen wohl die vielen, großen weißen Zähne, die sie immerfort blecken. Und das Essen ist offenbar selbst für die Einheimischen ohne Ke-tschu ungenießbar.
Beim Rückflug nach Min-chen sitzt bereits eine Dame auf seinem Platz, die nicht weichen will, „schon gar nicht wegen eines krummbeinigen Jap-seng“. In höflichstem Ton entgegnet Kao-tai: „Oh Sonne des Goldenen Apfels, ich würde Ihnen die Krätze ins Gesicht wünschen, wenn ich nicht wüsste, dass Sie dadurch eher schöner würden.“
Eine der Servier-Zofen führt ihn schließlich zu einem freien Platz in der Ersten Klasse. Dort sitzt er neben Herrn Fung-si-bang, dessen Gesicht Kao-tai an das Gesäß eines Kleinkinds erinnert. Der lädt ihn nach Ki-tsi-bü ein, erzählt ihm, er werde Kaiser genannt, schwärmt ihm vom Spong vor und versichert lächelnd, das sei „die wichtigste Nebensache der Welt“. Erst später findet Kao-tai heraus, was Spong bedeutet: „ohne Not einem hüpfenden Ball aus Leder nachlaufen, … mit heraushängender Zunge laufen, über Stöcke springen, sich ins Wasser begeben, ohne schiffbrüchig zu sein“.
Herr Shi-shmi kommt erst einige Zeit später aus der Stadt Großer Apfel zurück. Vergeblich wartet Kao-tai am Flughafen von Min-chen auf seinen Freund.
Der wird nach seiner Ankunft sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. Als Kao-tai ihn besucht, merkt er, dass der Patient sterben wird. Aber die Ärzte und das Pflegepersonal wollen den Tod nicht wahrhaben und sie teilen diese Einstellung mit der übrigen Bevölkerung. „Ich habe das Gefühl, sie genieren sich zu sterben“, schreibt Kao-tai über die Großnasen. Am übelsten, findet er, sind die Angehörigen: Kaum ist jemand ernsthaft krank, wird er so schnell wie möglich ins Hospital abgeschoben.
Die Odyssee führt Kao-tai auch nach Nü-leng, Bo-tseng und in die Ewige Stadt Lom, wo der Ober-Priester der Religion des an kreuzweise angeordneten Balken genagelten Gottes Ye-su residiert, und zwar im Palast Wa-kang, einer Art verbotenen Stadt. Dort findet er einen Gelehrten, der mit seiner Zeitmaschine für zwei Tage 1000 Jahre zurück ins Land der Mitte reist, um zu prüfen, wie sich die Lage dort entwickelt hat. Als er danach berichtet, der erhabene Fußtritt der Kaiserlichen Majestät habe Kao-tais Widersacher aus der Sonne des (unverdienten) Ruhmes in den (verdienten) Moder eines Kerkerloches befördert, kann der Mandarin endlich wieder in seine Heimat zurückkehren. „Leb wohl, du wirre Welt der Großnasen. Ich werde nicht mehr hierher zurückkehren.“
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)In seinen Büchern „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ und „Die große Umwendung. Neue Briefe in die chinesische Vergangenheit“ zeigt Herbert Rosendorfer unser Leben aus der Perspektive eines Fremden. Da wirkt vieles, was wir für selbstverständlich halten, sehr merkwürdig. Die eine oder andere Beobachtung könnte uns nachdenklich stimmen, obwohl es in den beiden originellen Büchern mehr ums Vergnügen als um scharfe Gesellschaftskritik geht.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangaben und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Herbert Rosendorfer (Kurzbiografie)
Herbert Rosendorfer: Die Kellnerin Anni
Herbert Rosendorfer: Der Mann mit den goldenen Ohren
Herbert Rosendorfer: Der Meister