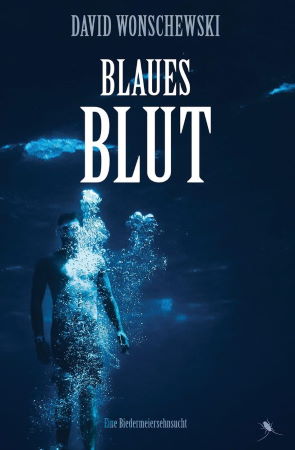César Aira : Die nächtliche Erleuchtung des Staatsdieners Varamo
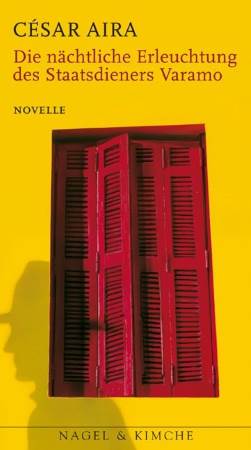
Inhaltsangabe
Kritik
Der etwa fünfzigjährige Junggeselle Varamo arbeitet in einem Ministerium der Stadt Colón (Panama) als drittrangiger Schreiber. Als er sein Gehalt ausbezahlt bekommt, bemerkt er, dass die zwei Hundert-Peso-Scheine Falschgeld sind. Er reagiert aber zu spät, um den Irrtum zu reklamieren.
Diese Episode habe den Anlass gegeben, so unterstellt der auktoriale Erzähler, dass Varamo ein Gedicht verfasste, das künftig als Meisterwerk der modernen mittelamerikanischen Lyrik gerühmt werden wird. Das Gedicht mit dem Titel Der Gesang des jungfräulichen Kindes schreibt Varamo nachts innerhalb weniger Stunden. Schon einige Tage später erscheint das „rätselhafte Gedicht“ als Buch, um „den Mythos des Plötzlichen“ und als „Ausgangs- und Höhepunkt der gewagtesten experimentellen Sprachavantgarde“ zu manifestieren.
„Wie alle Angestellten des öffentlichen Dienstes“ tut Varamo seine Arbeit ohne Elan und Ehrgeiz, und so sieht er sein bescheidenes Gehalt folgerichtig als Geschenk an. Deshalb freut er sich, wenn er manchmal beim Glücksspiel gewinnt. Meistens hat er aber Spielschulden, an die er sich erinnert, als er dem Chauffeur des Wirtschaftsministers begegnet, der insgeheim als Mittelsmann für ein Lotteriespiel agiert, an dem sich einige Beamte beteiligen.
Im Moment beschäftigt Varamo aber mehr der Gedanke, wie er die falschen Geldscheine unauffällig tauschen kann.
Diese blöden falschen Geldscheine. Sie waren nichts wert und konnten sich in Nichts auflösen. Im Realitätskontinuum der Welt, in einer unendlich weit zurückliegenden Epoche, hatte sich eine radikale Heterogenität zwischen zwei beliebigen Dingen gebildet. Eine Art von Differenz, die so unüberbrückbar war, dass es keinen Begriff gab, um beide Dinge zu umfassen. Keinen Terminus außer dem Sein. Damals entstand das Sein, und seither gab es das Denken und die Philosophie, zumindest bis zu diesem Nachmittag in Panama. Die beiden falschen Geldscheine hatten nun erneut eine solche Heterogenität verursacht. Womöglich hatte das letzte Stündlein des Denkens geschlagen. Aber wenn man nicht dachte, womit sollte man dann seine Zeit füllen?
Weil Varamo an diesem Nachmittag zu nervös für seinen Nachmittagsschlaf ist, versucht er sich abzulenken.
Varamos Hobby ist das Ausstopfen von kleinen Tieren. Die Szenerie, die er sich diesmal ausgedacht hat, soll einen Klavier spielenden Fisch darstellen. Die Nachbildung des Klaviers ist ihm bisher noch nicht gelungen, deshalb widmet er sich zunächst dem Fisch. Er hantiert mit kleinen Messern und Pinselchen, achtet auf die genaue Dosierung der chemischen Substanzen und versucht, den Ausdruck der Augen so natürlich wie möglich zu gestalten. Als er fast fertig ist, bemerkt er, dass er ein wesentliches Detail nicht beachtete: Ein Fisch hat keine Hände, wie soll er da Klavierspielen!? Die Überlegung, dem Fisch Froschärmchen zu transplantieren, verwirft er jedoch. Den präparierten Fisch setzt er zurück ins Glas.
In sein Geheimlabor dringt plötzlich ohrenbetäubendes Geschrei. Als er dem Lärm nachgeht, sieht er seine Mutter mitten auf der Straße. Ihr Zornesausbruch gilt den Nachbarn, die sie angeblich wieder einmal respektlos behandelten. Varamo packt die kleine Frau am Arm – sie reicht ihm gerade bis zur Hüfte – und führt sie ins Haus. Sie bemerkt sofort den üblen Geruch im Zimmer, den Varamo mit den chemischen Substanzen erklärt, die er für seine Experimente benötigt. Der Gestank schnürt auch ihm die Kehle ab, und was er ihr weiter zu erklären versucht, wird vom lauten Planschen des Fisches in der Schüssel übertönt.
Eine vernünftige Verständigung mit seiner Mutter ist generell kaum möglich. Immer versucht sie, sich zu rechtfertigen und greift dabei in „ihrer senilen Verwirrtheit“ zu einer weit zurückliegenden Geschichte zurück, die vor einem halben Jahrhundert passierte, in einer Welt, die sie nicht kannte. Sie war aus China an den Isthmus gekommen, allein und hilflos. In ihrer Sehnsucht nach einem Baby lächelte sie alle Kleinkinder an oder streichelte sie. Einmal hob sie ein Baby kurz hoch. Mit dem Kind in den Armen war sie abgelenkt, und als sie es den Eltern zurückgeben wollte, war das Paar verschwunden. Der Junge war zwischen neun und zwölf Monaten alt, gesund, fröhlich und unruhig. Zunächst wusste sie nicht, wie sie die Aufgabe bewältigen sollte, ihn aufzuziehen. Und jetzt behaupten böse Zungen, dass ihr Sohn gar nicht ihr Sohn sei, klagt sie, und beschuldigen sie sogar, ihn gestohlen zu haben.
Varamo nahm diese Geschichte als eine Art Metapher, die die vielen Widrigkeiten im Leben einer schlecht assimilierten, ungebildeten und fatalistischen armen Immigrantin zu einer Fabel verdichtete.
Wenn die Mutterschaft seiner Mutter hartnäckig als Beginn fungierte, dann fungierte die Witwenschaft als das Ende, das gleichzeitig eine Prämisse war; sie war Witwe, richtig, aber vorher war sie verheiratet gewesen.
Nun ist es Zeit fürs Abendessen. Varamo spielt eine Partie Domino für sich allein, und die Mutter kocht.
Sie bereitete den Fisch zu, der in merkwürdigen Farben schillerte und verdächtig schmeckte. Es war eine Art Selbstmordessen, und wenn sie sich nicht vergifteten, dann aus Glück, dennoch geschah irgendetwas mit ihnen, denn Varamo litt an Halluzinationen und Fieber.
In diesem Zustand wälzt er das Problem mit dem Falschgeld wieder hin und her. Sollte er den Unschuldigen spielen, so tun als ob er nichts bemerkt hätte? Wie soll er es anstellen, dass er die Scheine, ohne aufzufallen, umgetauscht bekommt? Wie er es dreht und wendet, es fällt ihm keine Lösung ein.
Wer konnte sich mit irgendeiner Erfolgswahrscheinlichkeit auf eine solche Aufgabe stürzen? Er bestimmt nicht. Er am allerwenigsten. Wie alle öffentlichen Angestellten schreckte er vor jeder schwierigen Aufgabe zurück, und es war zu seiner zweiten Natur geworden, den leichtesten Weg zu suchen, wenn möglich den des Delegierens. Er fragte sich, ob es […] nicht eine Vorgehensweise gab, einen Automatismus, der ihm die Umstände aufzeigt, ohne dass er sie suchen musste.
Jedenfalls hätte jeder wie auch immer geartete Akt seines Verhaltens ein unveränderliches Merkmal:
Er käme nach dem vorigen und vor dem folgenden. Diese Abfolge war das Einzige, was die in der Gegenwart erlebte Situation mit der gleichen Situation im Rückblick, als vergangene, gemeinsam hatte. […] In der Gegenwart war sie das Eigene, im Rückblick war sie das Fremde. Ein Richter, sollte es überhaupt einen Richter geben, sprang von Zweiterem zu Ersterem. Wodurch die so furchterregende Figur des Richters die nur dem Anschein nach harmlosere Gestalt des Erzählers annahm.
Damit gelangen wir zu dem, was die Meditation nach Tisch, während Varamo mit sich selbst Domino spielt, so bedeutend macht.
Sie ist so bedeutend, dass sie irgendwie alles erklärt.
Der Leser wird nunmehr darauf hingewiesen, dass es sich beim vorliegenden Buch um eine Literaturgeschichte handele, auch wenn sie als Roman daherkomme. Es sei keine Fiktion, da es den Protagonisten wirklich gegeben habe und er der Urheber des bereits erwähnten berühmten Gedichts war. Warum werden dann aber seine Gedanken mit der Methode der „erlebten Rede“ dargestellt?
„Dafür gibt es eine Erklärung“, [argumentiert der Erzähler] „die keineswegs im Widerspruch dazu steht, dass es sich bei dem vorliegenden Band um ein in striktem Sinne historisches Dokument handelt. Wenn hier etwas erdichtet wird, dann unabsichtlich und zufällig; und eine Überprüfung des bisher Geschriebenen […] in diesem Moment stattfindet […], gestattet uns die Versicherung, dass hier keine Erfindung vorliegt.“
Das Eindringen in Varamos Bewusstsein sei „nicht magisch, nicht einmal phantasievoll oder hypothetisch“. Damit aber die „historische Rekonstruktion“ nicht zu trocken wirkt, habe man die Tatsachen romanhaft geschildert. Über mehrere Seiten hinweg hebt der Erzähler, der sich jetzt Kritiker nennt, begeistert die Einzigartigkeit des Gedichts und dessen Bedeutung für die avantgardistische Literatur hervor.
Dann fährt der Erzähler mit der Beschreibung des restlichen Tages fort:
Varamo hat seine Partie Domino beendet und die Teller gespült; nun ist es Zeit für seinen täglichen Abendspazierung, der immer mit einem Besuch in seinem bevorzugten Café endet. Auf dem Weg dorthin widerfährt ihm auch heute, wie jedes Mal, wenn er an einer bestimmten Stelle vorbeikommt, dass er „Stimmen“ hört. Es sind verständliche Sätze, Formeln und Wörter, die aber keinen Sinn ergeben. Früher empfand er dieses unerklärliche Phänomen bedrohlich, mittlerweile macht es ihm nichts mehr aus.
Heute Abend erlebt er etwas Außergewöhnliches. Er wird Zeuge, wie zwei Autos zusammenstoßen. Eines überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Aus dem vorderen Seitenfenster zwängt sich ein Mann, er scheint unverletzt, und winkt sogleich Varamo zu. Es ist der Chauffeur des Ministeriums, mit dem Varamo heute Morgen schon zu tun hatte. Der dunkelhäutige Fahrer zieht den bewusstlosen Fahrgast – es ist der Wirtschaftsminister – aus dem Auto und weckt die Bewohner des nächstgelegenen Hauses, um dort bei dem Verletzten Erste Hilfe zu leisten. Der Chauffeur, den man Schwarzer Zigarillo nennt (weil er zusätzlich zu seinem Lotteriegeschäft auch mit Schmuggelzigarren handelt), hat den Verdacht, dass der Unfall von Terroristen geplant war, die ein für diesen Abend angesetztes Autorennen (mit etwas ungewöhnlichen Regeln) für einen Anschlag nutzten. Anhand der Zeitvorgaben und anderer Daten für das Rennen, wäre es möglich, den Standpunkt eines jeden Autos und somit auch der Flüchtigen herauszufinden, behauptet er. Varamo wundert sich, dass der Schwarze einen Zettel mit diesen geheimen Daten hat, noch dazu in dessen Handschrift; vermutlich fertigte er heimlich Kopien an, um sie an die Rennfahrer zu verkaufen.
In welchem Haus befinden sie sich eigentlich? Es ist das Haus der Góngoras, über deren Bewohner viel Geheimnisvolles erzählt wird. Varamo weiß nichts darüber, nur fällt ihm jetzt ein, dass ihn jedes Mal, wenn er hier vorbeigeht, die „Stimmen“ attackieren. Varamo kommt mit den Góngoras ins Gespräch. Die beiden fülligen Kreolinnen, um die sechzig Jahre alt, sind Schwestern. Eine verlor bei einem Unfall ein Bein; beide blieben unverheiratet. Die Haushaltshilfe Carmen Caricias Luna, die sie wie eine Tochter behandeln, wohnt bei ihnen. Varamo müsste sie eigentlich kennen, meint eine der Schwestern, denn Caricias sei die Braut seines Freundes Zigarillo. Der Schwarze Zigarillo ist zwar nicht sein Freund, erwähnte jedoch schon mehrmals eine Frau namens Caricias, erinnert sich Varamo.
Die beiden Schwestern leben zurückgezogen. Das schließt aber nicht aus, dass sie einträgliche Geschäfte betreiben. Sie handeln mit Golfschlägern, die auf Schiffen aus Haiti angeliefert werden. Die schlauen Damen gehen dabei folgendermaßen vor: Um die hohen Gebühren für den Zoll zu umgehen, deklarieren sie die Golfschläger als Krücken, die weniger hoch besteuert sind. Wenn die Ware ausgeladen wird, benützt diejenige, die nur ein Bein hat, beim Verlassen des Schiffes einen Golfschläger als Krücke und demonstriert damit die scheinbare Legalität des Geschäfts.
Mittlerweile ist der Polizeichef bei den Góngoras eingetroffen. Der bewusstlose Minister sei behelfsweise in der Übertragungskabine untergebracht, dort könne er Seine Exzellenz finden, erfährt er von den Damen.
Diese Situation nützt Varamo aus, um sich davonzuschleichen. Da er sich im Haus jedoch nicht auskennt, irrt er durch den Flur. Aus einem der Zimmer hört er Geräusche, die ihn neugierig machen. Der winzige Raum, den er betritt, muss wohl die Übertragungskabine sein, von der die Góngoras sprachen. Überall liegen Kabel herum; er sieht Sprechtrichter, Telegrafenkonsolen und allerlei andere Geräte, deren Verwendungszweck Varamo nicht durchschaut. Am Boden liegt auf einer Luftmatratze der Minister. Auf seinem Kopf sitzen Ohrenklappen, die mit einer Konsole verkabelt sind. Aus diesen Ohrenklappen dringt ein leises Murmeln, das Varamo bei näherem Hinhören als die ihm unerklärlichen „Stimmen“ identifiziert. Er begreift, dass die Góngoras diese Apparate benötigen, um sich mit den Schiffen in Verbindung zu setzen, die die Schmuggelware liefern. Da Colóns Stromnetz schadhaft ist, dringt aufgrund eines elektrischen Lecks ein Teil der Übertragung oder ein Echo davon in die Atmosphäre rund um das Haus. Nichts anderes sind also die „Stimmen“, die Varamo immer auf seinen Spaziergängen zum Café hört!
Der Arzt verschaffte dem Bewusstlosen die akustische Berieselung, weil bei komatösen Patienten der Eindruck entstehen soll, dass man mit ihnen spricht – so reimt sich Varamo das zusammen. Dann kommt Caricias hereingestürmt. Sie wolle nur die Tonbänder wechseln, erklärt sie. Der verdutzte Eindringling gesteht, dass er schon seit einer Weile die Übertragungen belausche, deren Sinn ihm aber rätselhaft bleibe. Das wundere sie nicht, sagt Caricias; jemand, der den Code nicht kenne, mit dem sie verschlüsselt sind, dem müssten sie wie Unsinn vorkommen. Sie blättert in einem Heft und zeigt ihm Eintragungen. „Das sind die Schlüssel“, sagt sie. Und der Auslöser für die nächtlichen Übertragungen sei er, verrät sie ihm. Die beiden Damen seien durch Gäste abends oft abgelenkt und weil die Botschaften immer zur gleichen Zeit gesendet werden müssen, wählten sie ihn als „Zünder“ aus, da er zuverlässig und pünktlich bei ihnen am Haus vorbeigeht. Wenn er in das vorher auf der Straße eingerichtete Magnetfeld trete, erklärt sie ihm, setze seine Körpermasse den automatischen Mechanismus in Gang.
Caricias vertraut Varamo darüber hinaus an: Sie habe Zigarillos im Verdacht, den Unfall vorausgeplant zu haben und befürchte, dass er sich zum Anführer einer Revolution aufschwingen und die schwarze Rasse an die Macht führen wolle. Er habe sie benutzt, um Zugang zu dem Kommunikationssystem zu bekommen. Er müsse aufgehalten werden, beschwört sie Varamo. Er und sie seien dazu in der Lage, indem sie die Codes änderten, sodass es Zigarillo verwehrt wird, sich mit den Schiffen aus Haiti zu verständigen. Caricias drückt ihm die Kladde in die Hand, er solle schon mal mit den Änderungen anfangen, später würden sie die Aufgabe gemeinsam zu Ende bringen.
Varamo verlässt das Haus unauffällig und schlendert wie jeden Abend die Straße entlang. Der Gedanke, dass er sozusagen den Rosetta–Stein in der Hosentasche hat, stimmt ihn ebenso heiter wie der Auftrag, mit dem Caricias ihn betraute: „die Schlüssel zu vermischen, die Codes durcheinander zu bringen, um sie unentzifferbar zu machen“. Die Aufgabe kann warten, beschließt er, jetzt hat das Café Vorrang. Drei Herren, die er hier schon öfter sah, laden Varamo zu sich an den Tisch ein. Es stellt sich heraus, dass alle drei Buchverleger sind. Unter diesem Beruf kann Varamo sich nichts vorstellen.
Die drei waren redliche Vertreter eines Geschäfts, das mit dem Land geboren worden und inzwischen so stark gewachsen war, dass es den Hauptdevisenbringer darstellte: das Herausgeben von Raubdrucken. Illegal, aber toleriert, hatte es sich zu einer legendären Tätigkeit entwickelt, und Colón war ihr historisches Zentrum […] Sehr bescheidene Bücher, die gedruckt auf dem billigsten Papier, eingebunden in einen grellen, geschmacklosen Umschlag, ebenfalls aus Papier, also insgesamt nicht sonderlich haltbar war. Gewinn erzielte man nur dann, wenn man am Rande jeglicher Urheberrechte operierte, die sowieso noch nirgends gesichert waren […]
Dem Fachsimpeln der Geschäftsleute kann Varamo nicht folgen, und um der Unterhaltung eine andere Wendung zu geben, erkundigt er sich, ob sie nur Übersetzungen veröffentlichen würden. Aus der Frage schließen sie auf sein praktisches Interesse. Ob er denn schreibe? Sie seien „offen für die heimische Produktion, wenn sie von intelligenten und gebildeten Menschen wie Ihnen kommt“. Den Einwand, dass er noch nie etwas geschrieben habe, geschweige denn die Grundbegriffe des Schriftstellerberufs beherrsche, lassen sie nicht gelten. Allerdings, behauptet Varamo heuchlerisch, habe er seit einiger Zeit Lust, ein Buch zu schreiben, in das er seine Erfahrungen als Hobby-Einbalsamierer einbringen möchte. Den Titel wisse er auch schon: Wie man kleine Tiere einbalsamiert. Die Verleger sind begeistert. Sie besprechen bereits die Auflagenhöhe und ob das Buch als Hardcover erscheinen soll, eventuell mit Illustrationen. Varamo bringt einen anderen Titel ins Gespräch, den er noch spannender findet: Wie man kleine mutierende Tiere einbalsamiert.
Varamo traut sich die Aufgabe jetzt zu. Vor allem sieht er eine unerwartete Lösung für seine finanziellen Engpässe. Vorsichtig bringt er die Frage der Bezahlung zur Sprache. Zweihundert Pesos Honorar schlagen die Herren vor. Allerdings müsse er sofort mit dem Schreiben beginnen. Seine Bedenken, zum Schreiben viel Zeit zu benötigen, reden sie ihm aus. Wenn er sich konzentriere, könne er in drei bis vier Minuten eine Seite füllen, und in vier oder fünf Stunden wäre ein „anständiges Büchlein“ fertig. Die Buchproduzenten raten ihm außerdem, den Text nicht zu sorgfältig auszuarbeiten, das verderbe die Unmittelbarkeit, auch um die Rechtschreibung brauche er sich nicht zu kümmern, dafür seien die Setzer da.
Obwohl Varamo sich nicht besonders wohlfühlt (der Fisch vom Abendessen fällt ihm ein), ist er entschlossen, sich zu Hause sofort ans Schreiben zu machen. Vorher läuft er aber noch durch die Stadt, die er heute mit ganz anderen Augen sieht. „Das sind die Privilegien des Schriftstellers“, denkt er sich. Sonst habe er nachts immer geschlafen.
Alles war jetzt irgendwie schriftstellerisch.[…] was immer er auch war, dieser Tagesrest im abenteuerlichen Leben eines Schriftstellers, der nicht wusste, dass er ein Schriftsteller war, eines Fälschers malgré lui, der seine verschlüsselten Spuren hinterließ.
Um Mitternacht geht Varamo nach Hause. Er setzt sich hin und schreibt. „Richtig ist allerdings, dass das Verb ’schreiben‘, was seine praktische Umsetzung betrifft, viele Variationen erlaubt.“ Bei Varamo bedeutet das, dass er alle Papiere abschreibt, die er nach Verlassen des Ministeriums an diesem Nachmittag in die Tasche steckte.
Er wählte dafür ein rein akkumulierendes Verfahren, ohne Zeichensetzung oder Trennungsstriche, nur einem Ordnungsprinzip folgend, dem Nacheinander, in unregelmäßigen Zeilen (die Idee der Prosa, diese Kulturleistung der alten Zivilisation, war ihm vollkommen fremd). Das Ordnungsprinzip war der Zufall.
Als Grundmuster dient ihm das Heft mit den Codes, in das er die wörtliche Wiedergabe der anderen Notizen einfügt.
Er profitierte davon, dass er zwei widersprüchliche Anweisungen erhalten hatte, an die er sich mit dem gottergebenen Gehorsam eines Anfängers hielt: die von Caricias, dass er die Schlüssel bis zur Unkenntlichkeit verändern, und die der Verleger, dass er das vorgegebene Material respektieren solle.
Das Ergebnis war sein berühmtes Gedicht; nur dass es nicht wirklich ein Ergebnis war, sondern vielmehr das zum Ergebnis wurde, was ihm vorangegangen war.
Der Leser begleitet den seltsamen Amtsschreiber Varamo einen ganzen Tag lang. Pausenlos beschäftigt den Sonderling die Frage, auf welchem Weg er das Falschgeld, zwei Einhundert-Peso-Scheine, die ihm als Gehalt ausbezahlt wurden, unauffällig tauschen könnte. Wir erfahren unter anderem von seinem ausgefallenen Hobby, dem Ausstopfen von kleinen Tieren, und welche Schwierigkeiten er mit seiner kleinwüchsigen Mutter hat. Als er Zeuge eines Autounfalls wird, gerät er in das geheimnisvolle Haus eines Schwesternpaars und wird mit einer Situation konfrontiert, die er zunächst nicht durchschaut. Durch die gewitzte junge Haushaltshilfe gelangt er an kryptische Notizen. Da ahnt er noch nicht, dass diese Aufzeichnungen der Ausgangspunkt für seinen literarischem Ruhm sein werden. Eine zufällige Begegnung mit Buchverlegern führt dazu, dass er sich zu einer schriftstellerischen Tätigkeit überreden lässt. Dafür wird ihm ein Honorar versprochen: zweihundert Pesos! Ein paar Stunden in der Nacht genügen ihm, ein Gedicht zu verfassen, das nach der Veröffentlichung als „Ausgangs- und Höhepunkt der gewagtesten experimentellen Sprachavantgarde“ gilt und als „Meisterwerk der modernen mittelamerikanischen Lyrik“ gelobt wird.
Die Marotten des absonderlichen Schreiberlings Varamo sowie auch die Eigentümlichkeiten der anderen kauzigen Figuren sind in „Die nächtliche Erleuchtung des Staatsdieners Varamo“ amüsant geschildert. Geschickt zieht César Aira das Bemühen um den Falschgeld-Umtausch als roten Faden durch den gesamten Plot. Und wer Skurriles schätzt, kommt in „Die nächtliche Erleuchtung des Staatsdieners Varamo“ sowieso auf seine Kosten. Darüber hinaus spart der Autor nicht mit süffisanter Kritik am Literaturbetrieb im Allgemeinen und an Rezensenten, die kuriose Schriftsteller hochjubeln, im Besonderen.
Nach etwa der Hälfte der Handlung macht der Erzähler darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Buch, das als Roman angelegt sei, eigentlich um eine Literaturgeschichte handele. Damit die „historische Rekonstruktion“ jedoch nicht zu trocken wirkt, habe man die Tatsachen romanhaft geschildert. Über mehrere Seiten hinweg lobt er enthusiastisch die Einzigartigkeit des Gedichts und dessen Bedeutung für die avantgardistische Literatur. Dieser lange Exkurs und auch einige andere, sind (bewusst?) kompliziert in gewundenem Philosophen-Fachjargon und deshalb (jedenfalls für mich) schwer verständlich.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Irene Wunderlich 2011
Textauszüge: © Verlag Klaus Wagenbach