Wolfgang Hildesheimer : Tynset
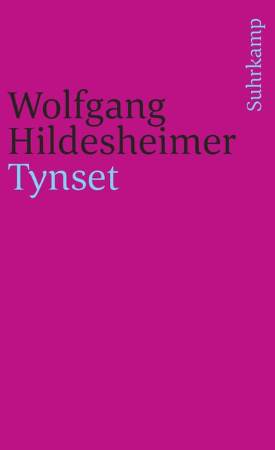
Inhaltsangabe
Kritik
Ich liege im Bett, in meinem Winterbett. Es ist Schlafenszeit. Aber wann wäre es das nicht? Es ist still, beinah still. Nachts weht hier meist ein Wind, und es krähen ein oder zwei Hähne. Aber jetzt weht kein Wind, und es kräht kein Hahn, noch nicht. Dafür knackt es hin und wieder im Holz der Täfelung meiner Wände, irgendwo spaltet sich eine Füllung, wirft sich und löst sich schrumpfend aus dem Rahmen, uralter Leim bröckelt in Perlen ab oder rieselt als Mehl, oder ein Riss huscht entlang einem Balken der Zimmerdecke, von einer Ecke bis tief in die andere, und darüber hinaus, durch die hölzerne Wand, weiter dem Balken entlang, in das nächste Zimmer, das leere Zimmer, wo er versickert und verklingt.
So beginnt das Buch, von dem Wolfgang Hildesheimer ausdrücklich meinte, es sei kein Roman.
Vom Erzähler erfahren wir weder wie alt er ist noch wie er aussieht oder wie er heißt. Es ist ein offenbar älterer Mann, der vor elf Jahren in das alte, weitläufige Haus gezogen ist, das er von einem „Cousin seiner Mutter oder deren Mutter“ geerbt hatte. Der unverheiratete, unabhängige Onkel übte keinen Beruf aus und hatte auch keine Lust dazu. Er besaß ein astronomisches Fernrohr, und in jedem Zimmer stellte er Messinstrumente auf: Uhren, Barometer, Hygrometer, Thermometer. Seine Haushälterin Celestina musste alle paar Stunden die Daten aufschreiben, aber mehr machte er damit nicht.
Als der Erzähler in das Haus einzog, übernahm er auch die Haushälterin Celestina. („Celestina trinkt viel, und sie betet viel. Sie trinkt weil sie trinkt, und sie betet, weil sie an Gott glaubt und fromm ist …“)
Er leidet unter Schlaflosigkeit. Während der Nacht steht er immer wieder auf und geht durch das Labyrinth des Hauses. So auch in einer Nacht im späten November.
Ja, ich bin im wahren Sinne des Wortes ein Nachtwandler. Nur schlafe ich beim Wandeln nicht, ich bin ein wacher Wandler, hellhörig, wie man es nur im Dunkeln ist. So gehe ich denn durch das Haus, klopfe auf die Scheiben der Barometer, hinter denen es aber ewig veränderlich bleibt, besehe mir in Schränken und Fächern und Regalen stumme Portraits oder beredte Reliquien, entdecke im Staub eine Haarlocke – aber von wem? –, in einem Gefäß den Schlüssel einer Uhr – aber von welcher Uhr? Wann ist sie stehen geblieben? – ich prüfe eine Landschaft an der Wand, und plötzlich bannt sie mich …
Das Buch besteht aus dem inneren Monolog dieser einen Nacht. Ein Geruch, Geräusch oder der Blick auf einen Gegenstand löst eine Kette von Assoziationen aus. Er erinnert sich an etwas, bricht ab, setzt noch einmal an.
Vor Jahren feierte er zum letzten Mal ein Fest. Kaum hatte er die Einladungen verschickt, schneite es so heftig, dass die Gäste nur mit Mühe bis zu ihm durchkamen. Ein Prediger aus Chicago, der sich unter sie gemischt hatte, verteilte plötzlich Gesangbücher. Die Gäste – allesamt Katholiken – verjagten ihn und verließen dann auch selbst das Haus. Als der Erzähler einige Zeit später sein Auto benutzte, kam er auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und schürfte an einem abgestellten anderen Wagen vorbei. In dem saß der Prediger aus Chicago – erfroren.
Der Erzähler erinnert sich, wie er bei einer Autofahrt in Deutschland in eine Umleitung geriet. („Ich war damals noch bereit, dem Ersuchen jeglicher anonymen Behörde bis zu einem Punkt innerhalb sinnvoller Grenzen zu folgen, nicht aber, wie andere, bis zum extremen Grad des Gehorsams schlechthin.“) Er folgte den Schildern und verlor bald die Orientierung.
Ich sah den Schädel hinter dem Fleisch, das Verlangen nach Ungeschehen hinter dem Geschehen wurde damals in mir sehnlich, die Hoffnung, es zu befriedigen, begann zu entschwinden.
Seither hat er sich immer stärker von der Welt zurückgezogen und das Haus nicht mehr verlassen. Eines Nachts stieß er im Telefonbuch auf den Namen des Bewohners eines schräg gegenüberliegenden Hauses. Den rief er an, ohne sich vorzustellen, fragte ihn unvermittelt, ob er sich schuldig fühle, warnte ihn: „Herr Huncke, hören Sie mir jetzt bitte gut zu: es ist alles entdeckt. Alles, verstehen Sie? Ich möchte Ihnen daher raten: fliehen Sie, solange Ihnen noch Zeit bleibt!“ Danach beobachtete er, wie in dem Haus die Lichter angingen und der Mann mit einigen Koffern in ein Taxi stieg.
Schließlich benutzte er das Telefon bloß noch, um die automatische Wettervorhersage anzurufen. Nur mit Partikeln der Wirklichkeit kommt er noch in Kontakt. Wenn es kein Telefonbuch ist, dann vielleicht ein Kursbuch, etwa „das Kursbuch der norwegischen Staatsbahnen, und zwar die Ausgabe von 1963“. Darin findet er eine Nebenstrecke, „die führt von Hamar nach Stören, und zwar über Elverum, Tynset und Röros“. Tynset – das Y in diesem Wort fasziniert ihn. Der Ort wird zum Zentrum seiner Sehnsucht, aus der Isolation auszubrechen. „Ich will nach Tynset fahren, mein Wunsch versteift sich, ich komme nicht davon los …“
„Ja, alle Hintergründe meines Lebens kann ich beim Namen nennen, es sind die Vordergründe, die mir entschwinden.“
Er nimmt ein Buch aus dem Regal. Ein Blatt fällt heraus. Er liest es, kann sich nicht erinnern, wie es in das Buch gekommen ist, weiß auch nicht, wer es geschrieben hat und was es bedeutet.
Als er sich eine neue Flasche Wein aus der Küche holen möchte, trifft er dort auf Celestina. Sie sitzt am Tisch, trinkt und ist so betrunken, dass sie ihn für Gott hält, auf den Knien zu ihm rutscht und seinen Segen erfleht.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Ein von Schlaflosigkeit und angstvoller Unruhe gepeinigter Mann geht in dem Haus umher, in das er sich zurückgezogen hat. Seine Assoziationen führen ihn über das Hier und Jetzt hinaus. Er ist ein melancholischer Misanthrop: „Wahrhaftig, das Bessere im Menschen ist immer noch schlimm genug.“ Als er in einem Kursbuch auf den Ortsnamen Tynset stößt, flackert noch einmal der Gedanke an einen Ausbruch aus der Selbstisolation auf, doch im Morgengrauen nimmt er sich resignierend vor, Tynset zu vergessen und zu verdrängen.
Die Erzählstruktur ist wie ein Musikstück kunstvoll aufgebaut, mit Tynset als Leitmotiv. Innerhalb des Gesamtwerkes lassen sich auch kleinere musikalische Einheiten ausmachen, wie etwa eine Fuge, von der ich abschließend das erste Fünftel zitiere:
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Hier liege ich in meinen Sommernächten, in diesem Bett, das sieben Schläfern Platz bot –, in dem aber schon lange, lange keine sieben Schläfer mehr gelegen haben, nicht seit jener Nacht im späten Frühling oder sagen wir im frühen Sommer des Jahres 1522, da lagen vielleicht sieben Schläfer in diesem Bett, zum letzten Mal – da kam früh abends ein Mann, vielleicht ein Mönch, schmächtig und dünn bis auf seine großen, breitgetretenen, auf entsagungsvollen Wegen erhärteten Barfüße, vor die Herberge, in der dieses Bett stand, er kam müde, er war vielleicht schon wochenlang unterwegs, kam von St. Gallen, und sein Ziel war Irland – betrat das Gasthaus, erbettelte dort einen Eintopf aus Resten, den ihm die Wirtin gern gab, da sie mit der Speisung von dieserart Gästen ihren Platz im Jenseits zu halten hoffte, der ihr aus mancherlei Gründen nicht sicher zu sein schien –, er, der Mönch, isst, verrichtet schnell sein Gebet und seine anderen kärglichen Bedürfnisse, steigt hinauf zum Schlafraum, wo dieses Bett stand, entledigt sich seines Skapuliers, des Zingulum, während sich unten vielleicht schon ein weiterer, diesmal weiblicher Wanderer der Nacht der Haustür nähert –, die Kutte behält er an, dieser Mönch, den Rosenkranz wickelt er fester um das Handgelenk, damit die Devotionalie auch in seiner schlafenden Abwesenheit für ihn bete, er geht zum Bett, schlägt den Belag zurück, um sich an den äußersten Rand zu legen, denn er will der erste sein, der aufstehe, nicht um sich Peinlichkeit zu ersparen, Peinlichkeit gab es damals noch nicht, sondern weil er einen weiten Weg vor sich hat. An Versuchungen denkt er nicht. Schien der Mond? Ja – oder sagen wir, er schien noch nicht, aber er war im Aufgehen, ein Dreiviertelmond vielleicht, er hat das Fenster noch nicht erreicht, hinter dem der Mönch liegt, dafür legt er einen langen Schatten neben den zweiten Gast, die Gästin, die, während der Mönch sich auszieht, vor der Tür steht, während der Mönch sich hinlegt, das Haus betritt und damit den Mondschatten ablegt, eine Dame, die bessere Nächte gekannt hat und schlechtere kennen zu lernen fürchtet, aber nicht mehr kennen lernen wird, eine Courtisane, nenne ich sie Anne. Anne ist am Altern, hat daher die Gunst ihres letzten Galans, des alten Herzogs von Northumberland verloren – falls damals dieser Titel besetzt war –, der hat plötzlich Gefallen an minderjährigen Pächterstöchtern entdeckt, an Jungfernhäutchen, und das ius primae noctis wachgerüttelt –, aber das wäre eine andere Geschichte, wahrscheinlich eine schlechte. Anne ist auf dem Weg von den Gütern des Nordens zur Gosse des Südens, London oder Frankreich, ihre Hoffnung ist zwar nicht groß, aber noch nicht erloschen, noch ist sie stattlich, üppig, aber unter der Stattlichkeit fault es, ihre Haut wirft keine Hügel mehr sondern Falten, Runzeln, und die Seide darauf wird matt, der Samt darauf glänzend und alles fadenscheinig. Während oben, noch nicht beleuchtet vom steigenden Mond, der Mönch den Bettbelag über sich legt und die Hände zwischen dem Rosenkranz faltet, zu einem letzten, ich sage letzten, Gebet – inzwischen weiß ich, auf was ich hinaus will – leert unten Anne mit der Wirtin einen Krug mit Ale, sie erzählt, während der Mond schon kürzere Schatten wirft – einen davon vielleicht über ein Ehepaar, ein Müllerpaar, im Staub der Straße, dem Gasthaus noch nicht nah, aber ihm zustrebend – erzählt der Wirtin, im unverhohlenen Grundwörterschatz der Zeit, vom Geschehen in großen weichen spiegelverschalten Räumen, die sie nun für immer hinter sich gelassen hat. Die Wirtin hört zu und schweigt und verschweigt den gegensätzlichen Gast dort oben, dessen Abdruck auf dem Bettbelag der Mond nun in einem schmalen Streifen, einem Strich erreicht. Da liegt er, an fremde und – wahrhaftig! – an schlimmere Schlafstätten gewöhnt, dennoch in eine unheilvolle Ahnung gehüllt – Anne unten zerlegt ein Täubchen, lutscht an ihren Fingern, er oben versucht seine nächtlich gelockerten schweifenden Gedanken auf der Bahn der Mitte zu halten, die geraden Weges zu Gott führt, er hält den Blick seines schmalen Geistes von Seitenpfaden ab, obgleich er sie seltsam spürt –, unten sitzt also die Wirtin, sitzt Anne, knackt, schlürft, schluckt, schleckt sich die Lippen, spült einen Krug Ale der Mahlzeit nach, oben liegt der Mönch, müde, draußen gehen Wanderer, waltet die Nacht, scheint der Mond und bescheint inzwischen ein größeres Stück Bett, in dem der Mönch einschläft, und Anne wischt sich den Mund mit dem Arm, schürzt ihre Röcke, wünscht der Wirtin eine gute Nacht und steigt langsam die Treppe empor, der Mond beleuchtet die Treppe nicht, beleuchtet auch die Küche nicht, in der nun wieder die Wirtin steht, um für kommende Gäste eine Mahlzeit – die letzte Mahlzeit – zu bereiten –; beleuchtet aber das Müllerpaar, das dem Gasthaus nun näher ist, beleuchtet nicht oder kaum einen, der sich mühsam dahinschleppend schon die Gasthaustür erreicht – denn jetzt wird es Zeit für die dritte Stimme der Fuge – einen jungen Soldaten, der kommt – aus welcher Schlacht? – er kommt aus der Schlacht von Padua, derselben, in der Marthe Schwerdtleins Gatte gefallen ist und sich Herzog Maximilian von Bayern eine ehrenhafte Schwertwunde erworben hat. Er ist erst neunzehn, aber sein Körper altert seit Tagen unheilvoll, er wirft kaum noch einen Schatten, obgleich der Mond ihn sieht, Anne auf der Treppe und die Wirtin in der Küche sieht er nicht, der Mond, sieht und beleuchtet dafür einen Traum, der auf den Mönch zuflattert, einen frommen Traum, der aber bei heutiger Betrachtung weniger fromme Deutung zuläßt, der setzt sich auf seinen schmächtigen Träumer, um Besitz von ihm zu ergreifen – wie steht die Fuge? Anne oben, der Soldat vor der Gasthaustür, das Müllerpaar schon nahe, ein anderer Wanderer noch weit, ein weiteres Paar noch weiter, Traum im Mönch, Mönch im Bett, Mond am Himmel, und Anne beginnt sich auszuziehen …
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag
Wolfgang Hildesheimer: Marbot. Eine Biographie



















