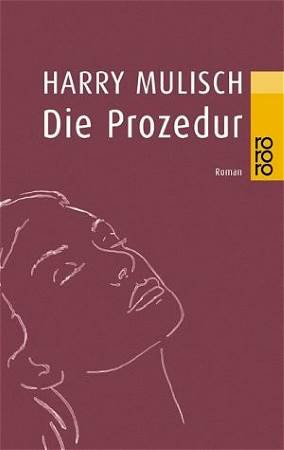A. Alberts : Die Inseln
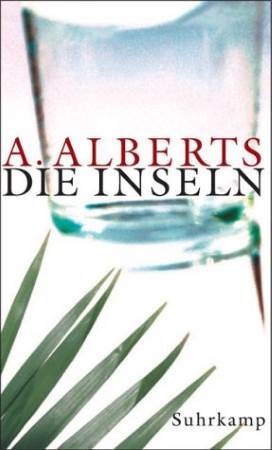
Inhaltsangabe
Kritik
„Die Inseln“, das sind elf Erzählungen in der ersten Person Singular. Bei dem Ich-Erzähler handelt es sich um einen niederländischen Kolonialbeamten vor dem Zweiten Weltkrieg auf Inseln im damaligen Niederländisch-Ostindien (Indonesien).
In der ersten Erzählung („Grün“) wird er mit einem Tragsessel – einem ausgedienten, abgewetzten Schreibtischstuhl – vom Schiff abgeholt und an den Strand getragen. Peereboom, ein Kollege, dessen Standort hundert Kilometer weiter westlich auf derselben Insel liegt, ist gekommen, um ihn zu begrüßen. Am nächsten Morgen reist Peereboom wieder ab. Einmal im Monat legt ein niederländisches Versorgungsschiff an; sonst trifft man hier keine Europäer. Statt seinen Kollegen, wie versprochen, zu besuchen, setzt der Erzähler sehr zum Erschrecken des Dorfvorstehers alles daran, den hundert Kilometer tiefen Wald nach Norden hin zu durchqueren. Nachdem er es geschafft hat und in sein Haus zurückkehrt, findet er dort Peereboom vor: Der Kollege hat sich erhängt.
Als ich im November auf die Insel kam, war der König zweiundachtzig. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass es den König gab. Ich hatte schon genug damit zu tun, mich daran zu gewöhnen, dass ich ein Büro hatte, ein hohes, weißgetünchtes Zimmer mit Landkarten an den Wänden. Karten unserer Insel und der Inseln ringsum. Und dass hinter mir in genau so einem Raum mein Schreiber saß, mein freundlicher Schreiber, der eigentlich alles viel besser wusste als ich, mich das aber nie spüren ließ. (Seite 40)
So beginnt die zweite Erzählung („Der König ist tot“). Die dritte („Das Haus des Großvaters“) handelt von dem bedeutenden Großhändler Taronggi III., der behauptet, sein Großvater habe in Tarragona ein Haus gehabt. Dabei sah Taronggi III. das Haus nur zufällig auf einer Ansichtskarte. Tatsächlich war sein Großvater Taronggi I. vor siebzig Jahren als Schiffbrüchiger hierhergekommen. Der Erzähler stellt sich vor, wie das damals gewesen sein könnte:
Er wird sich aufgerichtet haben, als er festen Boden unter den Füßen spürte. Wahrscheinlich stand er benommen da, während ihm das Wasser vom Körper, von dem zerfetzten Hemd und der zerfransten Hose tropfte, wie ein Malermodell für einen Schiffbrüchigen. Und die Bewohner der Insel werden ihm gegenüber gestanden haben. An einem Strand sind immer Menschen. Immer sind dort Leute, die aufs Meer hinausschauen. Es wird sehr still gewesen sein. Niemand wird etwas gerufen haben. Taronggi hat nicht gefragt: Bin ich hier auf dieser oder jener Insel gelandet? Und die Leute sind nicht auf ihn zugetreten und haben auch nicht zu ihm gesagt: Willkommen. Wir werden Ihnen helfen. Vermutlich standen sie einander totenstill gegenüber, und schließlich wird Taronggi mit stockenden Schritten das Wasser verlassen haben. Stockende Schritte wegen des saugenden Sandes. (Seite 49f)
In der Erzählung „Das Mahl“ vermittelt Mijnheer Zeinal einen Besuch des Erzählers in einem der Häuser des alten Fürsten. Als sie in die dunkle Empfangshalle treten, hört der Erzähler das Geschrei vieler Vögel. Und was er für einen weichen Teppich hält, ist eine vierzig Zentimeter dicke Schicht Vogeldünger. Den verkauft der Fürst einmal im Jahr.
Hauptmann Florines war ein Rebell. Warum, wusste vielleicht nicht einmal er selbst. Ich in meiner Funktion als Regierungsbeamter wusste es jedenfalls nicht. Zumindest, als alles anfing. (Seite 84)
So lauten die ersten Sätze der Erzählung „Die Jagd“. Es kursieren Gerüchte, Florines habe zwei Dörfer auf der Insel niedergebrannt, doch der Kolonialbeamte weigert sich, es zu glauben.
Sie haben noch nie Dörfer niedergebrannt – sagte ich zu meinem Schreiber. Nein – sagte mein Schreiber, aber er sagte es zögernd. (Seite 85)
Nachmittags ruft sein Chef aus der Hauptstadt an, will wissen, warum er noch nichts unternommen hat und fordert ihn auf, hinzufahren und nachzusehen. Eigentlich wollte er jetzt nach Hause gehen. Aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die fraglichen Dörfer zu inspizieren.
Ich blickte auf die Karte an der Wand meines Büros. Die beiden Dörfer, die möglicherweise ja doch niedergebrannt waren, lagen vierzig bis fünfzig Kilometer von meinem Standort entfernt. Vierzig bis fünfzig Kilometer. Ich schaute auf die Uhr und begann mit Hilfe meiner Finger zu rechnen. Ich würde eine halbe Stunde brauchen, um eine Abteilung der Polizeitruppen marschfertig antreten zu lassen. Dann wäre es drei Uhr. Viertel nach drei Aufbruch. Wir würden nämlich zwei Lastwagen benötigen, und mindestens einer davon würde garantiert nicht anspringen, sodass nach zehn Minuten durchdringendem Winseln des Anlassers der Motor mit der Kurbel in Gang gebracht werden müsste. Gut. Um Viertel nach drei würden wir also losfahren. […]
Gleich würden sechsundzwanzig kräftige Burschen, alle mit einem Karabiner über der Schulter und einem Revolver im Halfter, hier vor meinem Büro antreten, ach ja, und noch mit einem Säbel an der Seite. Sie würden die Hacken zusammenschlagen, und ihr Kommandant würde sie bei mir melden. Ach du meine Güte, ich hatte ganz vergessen, den Kommandanten zu benachrichten.
Ich rief den Kommandanten an und erklärte ihm die Sache. […]
Alles klappte hervorragend. Als ich nach draußen kam, schlugen sie alle die Hacken zusammen. Sie hatten die Motoren der Lastwagen einfach laufen lassen, haha, gewiefte Burschen, schlaue Kerle. […] (Seite 88ff)
Hauptmann Florines hat die Dörfer tatsächlich niedergebrannt und außerdem einen Weiler. Während der Verfolgung des Rebellen erinnert der Erzähler sich an seine Jugend in Veluwe südlich der Krondomäne. Dort hatten Wildschweine so viel Schaden angerichtet, dass Treibjagden veranstaltet wurden, um sie zu dezimieren.
Sie gehörten zum Wald wie das Knarren der Bäume. Sie hatten nichts Beängstigendes, die Wildschweine. Einem Förster zu begegnen wäre viel schlimmer gewesen. Ein Förster rief: Halt! Absteigen!, und dann stellte er sein Rad provokant quer über den Weg, und dann musste man absteigen, und dann zog er ein Notizbuch mit Eselsohren aus der Brusttasche seines Mantels, und dann leckte er den stumpfen Bleistift an und schrieb, und die ganze Zeit stank er nach Kord. Ein Wildschwein machte das alles nicht. (Seite 102)
Schließlich spürt der Kolonialbeamte den Gesuchten auf, der sich gerade ahnungslos an einem runden, gemauerten Brunnen hinter einem Haus wäscht. Erst will er ihn warnen, aber der Rebell hört ihn wegen des Wassers in seinen Ohren nicht rufen. Als Florines sich umdreht, schießt der Kolonialbeamte und trifft ihn mitten in den Kopf.
John, Clarence, Ducky, Spike, David, Louie und der Erzähler müssen mit ihrem Wasserflugzeug vor dem Strand einer kleinen unbekannten Insel notlanden („Die unbekannte Insel. Ein Fremder erzählt“).
Der Strand war etwa fünfzig Meter breit. John hatte eine fabelhafte Landung hingelegt. Wenn das Korallenriff nicht das Fahrwerk zertrümmert hätte und wenn der Strand hart gewesen wäre statt weich und wenn es dann noch Benzin auf der Insel gegeben hätte, hätten wir sogar wieder weggekonnt. (Seite 136)
Vergeblich versuchen die Männer, den Inselbewohnern zu erklären, dass ihr Flugzeug kaputt ist und sie nicht wissen, wo sie sind.
John fragte: Wie heißt das hier? Name dieser Insel? Name! Und er stampfte dabei mit dem Fuß auf.
Vorsicht, sagte Louie. Sonst stampfst du ihr Fürstentum noch unter den Wasserspiegel.
Aber die Männer schwiegen. (Seite 137)
Die Sprachschwierigkeiten sind unüberwindlich. Mühsam machen die Gestrandeten den Inselbewohnern mit Gebärden klar, dass sie Wasser benötigen. Einer der Einheimischen bringt daraufhin eine schmutzige, stinkende, mit Wasser gefüllt Blechbüchse. Um Eier zu bekommen, imitiert Louie ein gackerndes Huhn und hockt sich mit gequälter Miene hin. Da bringt ihm jemand statt der gewünschten Eier ein Huhn. Auch recht. Davon macht Louie eine Suppe. Um herauszufinden, auf welcher Insel sie sich befinden, zeigen die Europäer den Einheimischen ihre Karten, aber so kommen sie auch nicht weiter. Wenn sie nur auf einer Insel mit einem Telefonanschluss wären! Louie tritt auf einen Einheimischen zu und ahmt das Geräusch eines Telefons nach: „Rrrrring, rrrring, rrrring.“ Der Mann lacht verständnislos. Daraufhin versucht der Erzähler es mit einer ausführlichen Pantomime: Er tut als wähle er eine Nummer, nimmt den Hörer von der Gabel und führt ein kurzes Gespräch. Der Mann kichert verlegen. Am sechsten Tag fällt dem Erzähler plötzlich das Telefon seines Großvaters ein.
Ein altmodischer Holzkasten mit einer Kurbel und einem Trichter an der Vorderseite, in den man hineinsprach.
Er wiederholt seine Pantomime, jetzt aber mit diesem alten Apparat. Da sagt einer der Inselbewohner klar und deutlich: „Tilpun“. Das ist es! „Tilpun“ muss das Wort für Telefon sein. Zwei Einheimische rudern den Erzähler zu einer größeren Insel und bringen ihn zu einem Büro, in dem so ein altes Telefon an der Wand hängt. Damit fordert er Hilfe an.
Die letzte Erzählung („Hinter dem Horizont“) handelt davon, dass der Erzähler die Inseln für immer verlassen hat und nach Hause zurückkehrt.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Durch einen Kanal gelangen wir in den großen Hafen. Fahrräder und Autos fahren am Kanal entlang. Die Leute, die darauf oder darin sitzen, sind hiergeblieben. Sie waren nicht auf den Inseln. Sie sind in diesem Land geblieben und nun Fremde für uns geworden. Für uns. […] Und wir sind Fremde für sie geworden […] (Seite 148)
Der Niederländer A. Alberts (1911 – 1995) studierte Indologie und promovierte mit einer Arbeit über Kolonialpolitik. Als achtundzwanzigjähriger Regierungsbeamter kam er nach Java, das damals zu Niederländisch-Ostindien gehörte. Während des Zweiten Weltkriegs internierten ihn die Japanern. 1946 kehrte er in die Niederlande zurück. Dort arbeitete er als Zeitungsredakteur und Übersetzer. 1952 veröffentlichte er unter dem Titel „De Eilanden“ einen Band mit Erzählungen.
Es ist verwunderlich, dass diese elf wunderbaren Erzählungen ein halbes Jahrhundert lang nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Dem Suhrkamp Verlag ist die deutschsprachige Erstausgabe in einem fadengehefteten Bändchen vom September 2003 zu verdanken.
Bei dem Ich-Erzähler handelt es sich um einen niederländischen Kolonialbeamten vor dem Zweiten Weltkrieg auf Inseln im damaligen Niederländisch-Ostindien (Indonesien). Er führt kein pompöses Herrenleben, sondern fühlt sich fremd, einsam und isoliert unter den Inselbewohnern. Auch die wenigen anderen Europäer, denen er begegnet, sehnen sich nach zwischenmenschlichen Kontakten und sind doch unfähig, engere Beziehungen aufzubauen. Als der Erzähler nach Jahren in die Heimat zurückkehrt, sind ihm Leute und Gewohnheiten dort fremd geworden.
A. Alberts erzählt komische, groteske, dann wieder ganz realistische Geschichten. Seine Sprache ist bewusst einfach. Wie die Zitate in der Inhaltsangabe oben zeigen, glänzt dabei trotz der vorwiegend traurigen Grundstimmung immer wieder sein Humor auf, und er versteht es, seine subtilen Beobachtungen über das Zusammenleben der Fremden und der Einheimischen differenziert wiederzugeben. Eine faszinierende Lektüre.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2003
Textauszüge: © Suhrkamp Verlag