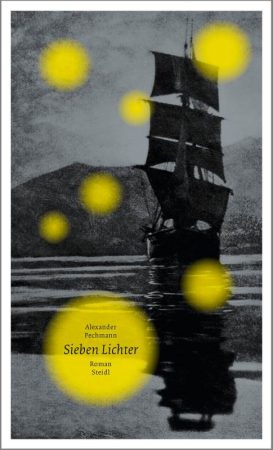Thomas Steinfeld : Der Sprachverführer
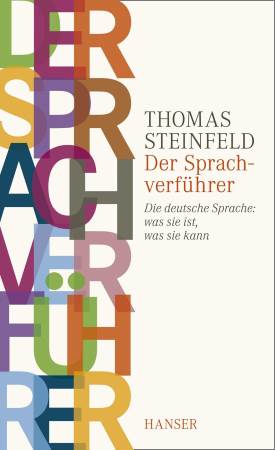
Inhaltsangabe
Kritik
Thomas Steinfeld hebt die kaum zu überschätzende Leistung hervor, die Martin Luther in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des 16. Jahrhunderts mit seiner Bibelübersetzung für die deutsche Sprache vollbrachte. Der Reformator schaute dem Volk aufs Maul und schuf mit dem Lutherdeutsch „eine Hochsprache, für alle Teile der Gesellschaft und über die Dialekte hinweg“. Die Lutherbibel sei der einzige Klassiker in der deutschen Literaturgeschichte, meint Thomas Steinfeld (aber dabei übertreibt er ein wenig). Nur die Katholiken, allen voran die Jesuiten, seien der Sprache des Kirchenspalters gegenüber skeptisch geblieben, und deshalb habe es in den katholischen Gebieten Bayern und Österreich vor Ferdinand Raimund und Franz Grillparzer, Karl Valentin und Bertolt Brecht keine überregionalen Dichter gegeben.
Als überregionale Verkehrssprache hatte zunächst das mit dem Humanismus nach Deutschland vorgedrungene Lateinische gedient; im 18. Jahrhundert wurde es in der Aristokratie vom Französischen abgelöst. Anders als etwa das Französische entwickelte sich die deutsche Hochsprache seit Luther ohne die Existenz eines Nationalstaates. Erst als diese vor allem von Predigern, Dramatikern und Schriftstellern geprägte Entwicklung (um 1830) längst abgeschlossen war, gründete Bismarck (1871) das Deutsche Reich.
Das Deutsche hingegen, als es denn eine Sprache für alle Stände, alle Regionen, alle Gegenstände und Ereignisse geben sollte, musste ohne Kaiser und König zurechtkommen. Zwar hatte die Reform eine Grundlage in der protestantischen Predigt-, Lese-, Sing- und Streitkultur (was man auch daran bemerkt, wie eng sich die deutsche Literatur des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts mit dem hohen Ton der Predigten verbindet). Aber es herrschte kein zentralisierendes Prinzip, stattdessen allerhand Di- und Triglossie. Regional und mündlich: die Dialekte, verwaltungstechnisch: die Kanzleisprache, die grammatisch am Lateinischen gebildete deutsche Formelsprache der Händler und Verwalter mit ihren tief ineinander verschachtelten Sätzen; kaufmännisch (plus Gaukler, Schauspieler, Quacksalber): Mischformen aus Dialekten, ständisch: das Französische, die Sprache des Adels, die dem Latein im siebzehnten Jahrhundert als Verkehrssprache der Gebildeten und der Herrschenden gefolgt war und noch bis ins neunzehnte hinein an den großen, vor allem aber an den vielen kleinen deutschen Höfen gesprochen wurde.
Das neue Deutsch entstand in der Literatur, im Gespräch und in der Korrespondenz der Schriftsteller miteinander, auf der Bühne: für eine ganze Gesellschaft.
Zur Zeit Lessings verstand man das Hochdeutsche fast überall zwischen Hamburg und Wien, Zürich und Königsberg. Die größte Ausdehnung der Ökumene der deutschen Sprache macht Thomas Steinfeld Mitte des 19. Jahrhunderts aus.
Anfangs war die Literatur „Lehrmeisterin der Sprache“, dann die Zeitung; inzwischen sind es die elektronischen Medien Fernsehen und Internet.
Nicht erst im Umgang mit elektronischen Medien hat sich das Bewusstsein durchgesetzt, es sei nicht mehr so wichtig, wie man etwas sage oder schreibe, Hauptsache, man werde verstanden.
Es fehlt hier aber, ganz entschieden, ein Bewusstsein der Register, der sprachlichen Möglichkeiten, der Stile und ihrer Vielfalt.
Immer wieder beklagt Thomas Steinfeld, dass die Literatur ihre sprachliche Vorbildfunktion verloren habe.
Seitdem es eine Schriftkultur gibt, hatte jede Zeit ihre klassischen Schriftsteller, und sie waren Vorbilder des Schreibens. Unsere Zeit hat keine. Das sollte sich ändern.
Die Literatur besitzt keine zentrale Bedeutung mehr, weder kulturell noch sozial, und eher, als dass etwas einzelnes anderes an ihre Stelle getreten wäre, wird ihre Funktion von diversen Medien wahrgenommen.
Es gibt schon lange keine Literatur mehr, die eine ganze Gesellschaft mit Mustern des schriftlichen Ausdrucks beliefern könnte.
Aber es gibt, auch heute, eine Literatur, die sprachliches Muster sein könnte: Man findet sie in den Büchern von Brigitte Kronauer und Martin Mosebach, von Sibylle Lewitscharoff und Georg Klein, von Ingo Schulze und Rainald Goetz, von Herta Müller und Wilhelm Genazino.
Günter Grass und Elfriede Jelinek hält Thomas Steinfeld nicht für Vorbilder. Über den Autor der „Blechtrommel“ heißt es in „Der Sprachverführer“:
[Günter Grass] neigt sehr zur bürokratischen Sprache, eben zum Passiv zum Beispiel, aber auch zu einer Konstruktion, die man manchmal „Vorreiter“ nennt. Sie ist das gebräuchlichste Mittel, um etwas zu sagen, sich dann aber der Verantwortung für das Gesagte zu entschlagen: „Fest steht, dass “ ist eine solche Formulierung […] Dieser Schriftsteller relativiert den Sicherheitsgrad einer Aussage in seinen literarischen Arbeiten oft wie ein Politiker.
Und über Elfriede Jeleneks Nobelpreis-Vorlesung „Im Abseits“ meint er:
Und so wird man den Verdacht nicht los, dass diese sogenannte Sprachkritik im Wesentlichen aus einem sehr gut geölten perpetuum mobile zur Verfertigung nicht von Reden, Dramen oder Romanen, sondern von Textflächen besteht. Im Inneren dieser Maschine, die Elfriede Jelinek mit offenkundig großer Souveränität und Virtuosität bedient, arbeiten lauter kleine Rädchen, die nach dem Prinzip des Kalauers funktionieren […] Es ist, als triebe eine fatale Witzelsucht diese Maschine an, ein manischer Zwang, keine Silbe stehenzulassen, ohne zugleich nach ihrer Verwertbarkeit für einen fremden Sinn zu suchen. Bei Elfriede Jelinek generieren die Kalauer sich selbst, sie werden benutzt, um den letzten Rest von Wirklichkeit, von Erfahrung und mit ihr die Phantasie aus jedem beliebigen Text zu entfernen. „Im Abseits“, so der Titel des Vortrags, also grundsätzlich jenseits aller Zeitgenossenschaft, hätte sich Elfriede Jelinek sowieso befunden, und so addiert sich die schiere Masse der Kalauer in all ihrer Kurzatmigkeit zu einer ebenso gigantischen wie theatralischen und offenbar grundlosen Klage.
Thomas Steinfeld weist auf gedankenlose Formulierungen wie „gewünschtes Zielstockwerk“ hin. Seitenlang beschäftigt er sich mit einem Satz, den Josef Ackermann, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, im Sommer 2008 gesagt haben soll:
„Wir werden unseren Kurs der zeitnahen Transparenz fortsetzen und uns unvermindert für zielführende Reformen des Finanzsystems insgesamt einsetzen.“
Dazu schreibt Steinfeld:
Es gibt viele Arten, schlechtes Deutsch zu reden oder zu schreiben. Dieser Satz steht für die gewöhnlichste. Sie entwickelt sich mitten in der modernen Öffentlichkeit, und zwar gegen sie, aus dem Bedürfnis, sich diese Öffentlichkeit so weit wie möglich vom Leib zu halten […] Was dabei aber herauskommt, ist hässlicher und leider auch folgenreicher als alle Anglizismen, die so oft für das Ende des schönen Deutsch gehalten werden.
Die weit verbreitete Abneigung gegen Fremdwörter teilt Thomas Steinfeld nicht.
Aber anstatt die Stärke zu erkennen, die eine Sprache besitzen muss, die das Fremde aufnimmt, ohne es zu unterwerfen, den Enthusiasmus des Lernens, der in jeder dieser Aneignungen steckt, scheint es unter den Sprachverwaltern heute ausgemachte Sache zu sein, die Reinheit der deutschen Sprache bewahren zu wollen, das Ausländische für einen Irrtum und den Respekt vor der fremden Schreibweise, vor der fremden Flexion für Beflissenheit, ja für Unterwürfigkeit zu halten. Rein jedoch ist nur, was sich nicht mehr verändert und also nicht mehr wirkt.
Erst durch die Weigerung, Anglizismen einzudeutschen, kommt es zu „bizarren Mischgewächsen“ wie „Er hat das Programm gedownloadet.“
Selbstverständlich kann man die deutsche Sprache lieben. Aber man sollte sie nicht auf die unfruchtbare Weise lieben, die auf einen bestimmten Zustand insistiert und ihn gegenüber aller Veränderung behaupten will – nicht pedantisch, sondern leicht und mit einem Blick fürs Komische.
Das Englische etwa ist in Angelegenheiten der Vereinfachung grammatischer Formen schon deutlich weiter, und das Deutsche wird sich weiter in diese Richtung entwickeln. Aber es gibt Rettung, und auch sie ist immer da. Denn das Prinzip der Expressivität wirkt der Zerstörung der Formen entgegen, weil es an abgeschliffenen, verfallenen, toten Formen sein Ungenügen hat und diese durch allerhand Extravaganzen zu revitalisieren trachtet.
– – –
Anhand von konkreten Beispielen erläutert Thomas Steinfeld zwischendurch stilistische Fragen und streift Grammatikregeln, wie etwa den Gebrauch der Wörter ist und war, sei und wäre oder die verschiedenen Vergangenheitsformen.
Die Regel lautet: Das Imperfekt ist die Erzählform der Vergangenheit. Sie wird immer dann benutzt, wo ein vergangenes Geschehen oder Verstehen in seinem Entstehen und Vergehen ausgedrückt wird. Daher ihre – und nur ihre – Eignung für das Erzählen. Das Perfekt ist dagegen sozusagen das Präsens der Vergangenheit, die Form, mit welcher der Sprecher das Vergangene in seine eigene Zeit holt. Unklar ist die Unterscheidung also nur, wenn man die Handlungen voneinander trennen will, klar ist sie, wenn man den Aspekt unterscheidet: Die Wahl des Präteritums signalisiert einen Bericht mit einer möglicherweise zeitlichen Distanz des Erzählers, das Perfekt eine Vergangenheit, die in eine präsentische Aussage übernommen wird.
Er erwähnt auch eine für die deutsche Sprache charakteristische Satzbildung, die sogenannte Satzklammer:
So kommt es, dass man erst dann sicher sein kann, deutsche Sätze – darunter alle, in denen ein Hilfsverb benutzt wird, und alle Nebensätze – verstanden zu haben, wenn sie zu Ende sind.
Die Freiheit also, die das Deutsche im Satzbau auszeichnet, ist, in Maßen und wohl wissend, dass es in anderen Sprachen Ähnliches gibt, das Kennzeichen der deutschen Sprache: die Beweglichkeit seiner Fügungen, die Freiheit der Wortstellung, die Möglichkeiten, ein Wort hier- oder dorthin zu stellen und so nicht nur Betonung oder Melodie, sondern auch Spannung und Beruhigung innerhalb eines Satzes zu gestalten. Diese Freiheit aber muss erworben werden, und zwar zum einen durch die Zweitstellung des Verbs im Hauptsatz und die Verbendstellung im Nebensatz, zum anderen durch eine besondere Ausbildung der Flexion, durch die linguistische Feinmechanik mit allen ihren Sicherheitseinrichtungen, ihren parallel eingerichteten Rädchen und doppelt angelegten Halterungssystemen.
Unter den Stilschwächen, auf die Thomas Steinfeld hinweist, sind die Neigung zur Substantivierung bzw. Nominalisierung, die er auf Powerpoint-Präsentationen zurückführt, und der Gebrauch standardisierter Adjektiv-Substantiv-Verbindungen wie feiger Anschlag, tragischer Unfall, fieberhafte Suche.
Über Komposita schreibt Thomas Steinfeld:
Die „Holztür“ ist aus Holz, der „Holzbohrer“ ist es nicht, und „Holzschutz“ ist schon gleich gar eine ganz andere Sache […] Ein „Ledermantel“ ist ein Mantel aus Leder, aber ein „Regenmantel“ ist kein Mantel aus Regen, die „Rinderwurst“ ist vom Rind, die „Kinderwurst“ nicht vom Kind.
Beim Schreiben eines Romans kommt es nicht nur auf eine geschliffene Sprache an, sondern auch auf die Inszenierung des Plots. Esgenügt deshalb nicht, dem Leser mitzuteilen, dass etwas wunderbar, ekelhaft, hinreißend oder anrüchig ist; der Autor muss es stattdessen anschaulich darstellen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Es ist […] falsch, an dieser Stelle einen Gegensatz zu eröffnen: Es kommt nicht darauf an, ob Sätze kurz oder lang sind, gebildet oder scheinbar einfach, ob Adjektive in ihnen vorkommen oder nicht, sondern allein darauf, dass einer die Mittel der Sprache beherrscht, dass er etwas zu sagen hat und dass er dies mit seinen Mitteln tut.
Eine gute Sprache ist mehr, viel mehr als die Einkleidung eines vorhandenen Gedankens in einen möglichst passenden Satz. Wo sie wirklich gelingt, geht die Form ganz in ihrem Inhalt auf, verbindet sich so sehr mit ihm, dass beide Seiten sich gegenseitig vorantreiben und Sachverhalte erkennbar werden lassen, die vorher nicht einmal geahnt wurden.
In seinem Buch „Der Sprachverführer. Die deutsche Sprache: was sie ist, was sie kann“ beleuchtet Thomas Steinfeld die historische Entwicklung und aktuelle Situation unserer Sprache. Anhand von konkreten Beispielen erläutert er die vielfältigen Möglichkeiten des Deutschen – im Guten wie im Schlechten. Dabei kann seine geschliffene Sprache nicht darüber hinwegtäuschen, dass er zumeist an der Oberfläche bleibt. Zur Rechtschreibreform von 1996 fallen ihm nur ein paar Plattitüden ein, und seine Kritik an der Sprache in den neuen Medien beschränkt sich auf das Klischee von „sinnlos dahingestammelten E-Mails“. Wenn Thomas Steinfeld zwischendurch die eine oder andere Grammatikregel erläutert, achtet er mehr auf elegante Formulierungen als auf Verständlichkeit.
Die Hauptüberschriften in „Der Sprachverführer“ lauten: Vom Schreiben, Vom Leben, Vom Üben, Exkurs I, Vom Nennen, Vom Beugen, Exkurs II, Vom Bauen, Vom Schließen. Es ist mir nicht gelungen, bei der Lektüre einen roten Faden zu erkennen. Systematisch ist die Gliederung ohnehin nicht, sondern Thomas Steinfeld pflegt entsprechend seiner Berufstätigkeit als leitender Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung einen feuilletonistischen Stil. „Der Sprachverführer“ ist weder eine stringente Sprachgeschichte noch eine methodische Stilkunde und schon gar kein strukturiertes Lehrbuch. Allerdings gelingt es Thomas Steinfeld, die Wahrnehmung des Lesers für sprachliche Feinheiten zu schärfen. Und er trägt mit „Der Sprachverführer“ hoffentlich dazu bei, dass die Wertschätzung der Deutschen für ihre Sprache nicht weiter abnimmt.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2011
Textauszüge: © Carl Hanser Verlag
Thomas Steinfeld (Hg.): Hundert große Romane des 20. Jahrhunderts