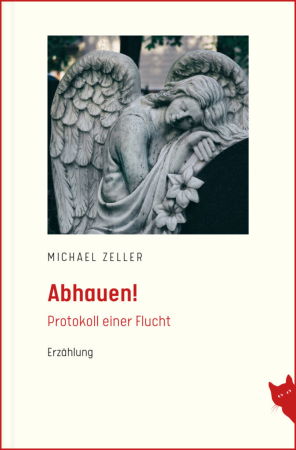Peter Wawerzinek : Rabenliebe
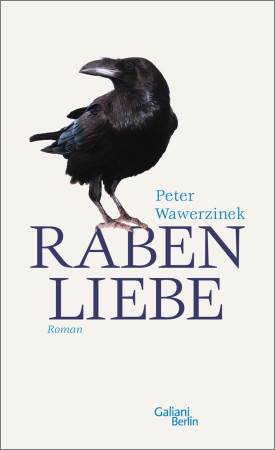
Inhaltsangabe
Kritik
1958 wird der vierjährige Junge von einem Säuglings- in ein Kinderheim in Nienhagen an der Ostsee gebracht.
Ich weiß nicht einmal, dass ich eine Mutter haben muss.
Ich leide am Verlust weiblicher Wärme. Hoffen und Bangen sind als unendliche Aktion auch eine Form von Wärmebildung. Hätte ich nicht Wärme gesammelt, mit Wärme gegeizt, jedwede Form von Hoffnung geheimst, mich an Wärme vergriffen, mir an Zukunft genommen, wo ich ihrer habhaft werden konnte, um nicht zu erfrieren, als Lichtlein nicht auszugehen nach dem Entzünden, Brüder, Schwestern, ich wäre in den Kinderheimen erfroren.
Der Junge spricht nicht. Dennoch gefällt er der Köchin des Heims, und sie nimmt ihn mit nach Hause, aber ihr Mann, ein Busfahrer, lässt es nicht zu, dass sie das Kind aufnimmt. Stattdessen muss sie es am nächsten Tag wieder mit zurück ins Heim nehmen. Einige Monate später ist der ortsansässige Tischler bereit, den Jungen zu adoptieren. Aber als dieser zwei niedlichen Katzen auf den Späneboden nachsteigt, von dort herunterstürzt und beinahe einen Unfall verursacht, scheitert auch dieser Versuch.
Zurück im Heim, beginnt er endlich zu sprechen. Bei der Einschulung wird der Sechsjährige allerdings nach einem Test für ein Jahr zurückgestellt.
Und dann falle ich zum ersten Mal vom Klo. Von nichts anderem als Grübeln dazu verleitet, urplötzlich ausgehebelt […] Ich gehe immer wieder k. o. von meinen Grübeleien.
Im Alter von sieben Jahren wechselt der Junge in ein Schulkinderheim.
Die Hausordnung ist wichtiger als eine Schulfibel.
Im neuen Heim freundet er sich mit zwei Mitschülern an, die ihn mit Süßigkeiten entlohnen, wenn er für sie Liebesbriefe schreibt.
Als er neun Jahre alt ist, schleicht er sich zu der elfjährigen Bianca in die Mädchenetage. Sie sind beide im Nachthemd. Er hat gerade angefangen, Briefmarken zu sammeln und hofft, von ihr eine fehlende Marke eintauschen zu können. Die gewünschte Briefmarke will sie ihm jedoch nur geben, wenn sie seinen inzwischen erigierten Penis anfassen darf. Das lässt er zwar zu, aber als sie ihn auffordert, ihr Geschlecht ebenfalls zu berühren, schreckt er davor zurück.
Im Alter von zehn Jahren wird er von einem Lehrerehepaar adoptiert. Der 56-jährige Adoptivvater könnte altersmäßig sein Großvater sein.
In der Wohnung der Adoptionseltern stehen keine zwanzig Bücher, unter ihnen, auf dem großen Radio, Deine Gesundheit von A bis Z und Ballett A bis Z in trauter Gemeinsamkeit mit dem Operettenführer von A bis Z und einem schmalen Band Goethes Werke, alphabetisch geordnet.
Ich unterstehe den Adoptionseltern, sprich, ich bin einzig für die Adoptionsmutter und ihre hochfahrenden Pläne zur Umerziehung da.
Ich klage ein, von meiner Adoptionsmutter aus egoistischen Gründen für erzieherische Versuche missbraucht worden zu sein. Ich wurde in den vier Jahren der Adoption gegen meine Natur gezwungen. Ich sehe mich gegen meine Talente und das bereits vorhandene individuelle Potenzial fehlerhaft umerzogen. Mir ist während der Adoptionszeit am intensivsten vorenthalten worden, was ich am meisten gebraucht hätte: Zuneigung, Mutterliebe, Wärme, Entdeckung und Ausweitung meiner Talente.
Allemal besser, ich wäre im Heim geblieben und hätte weiterhin als Vollwaise Tag für Tag tapfer mit mir und dem Leben zurechtkommen dürfen.
Aber bist du adoptiert und nicht mehr im Heim, so hast du kein Eigen mehr, bist Teil geworden von einem kleinen Ganzen, der Familie, ein Familienmitglied neben anderen Familienmitgliedern und anderen Familien in der Straße, in der ganzen Stadt.
Nur mit der ebenfalls im Haushalt lebenden und unterdrückten Großmutter versteht er sich halbwegs. Die Adoptiveltern, die er mit „Vati“ und „Mutti“ ansprechen muss, kann er nicht ausstehen.
Sie bleiben fremde Menschen für mich.
Sie veranlassen, dass sein Familienname gegen den der „Adoptionsgewaltigen“ ausgewechselt wird.
Ich werde mein eigen nicht. Ich bleibe ein Pseudonym. Ich bleibe für mich, lebe unter dem falschen Namen der Adoptionseltern, den ich ertragen will, bis ich groß genug bin und in einem Alter, den Adoptionsmantel abzulegen. Mit über fünfzig Jahren erst lege ich den Mantel der Adoptionszeit ab, trage meine künstliche Haut zu Grabe, nehme innerlich den Namen der Mutter, des Vaters an, den Namen, wie er in meiner Geburtsurkunde eingetragen worden ist, von Heim zu Heim getragen, durch die Adoption dann ad acta gelegt, um nicht mehr in der namentlichen Hülle der Adoptionseltern wie in einer Zwangsjacke zu stecken und unter falschem Namen beerdigt zu sein.
Ich spiele in meinem Adoptionskäfig das folgsame Adoptionsvögelchen.
Die Leute um uns herum sind alle angetan von meiner Entwicklung. Sie sehen in der Adoption einen gewagten Schritt. Vor allem die Kollegen des Lehrerehepaares. Das Heimkind, das kein Familienkind sein will, beachtet niemand.
Als die Großmutter ins Haus gegenüber zieht, bekommt der Junge ein eigenes Zimmer.
Die Adoptivmutter erwartet von ihm Dankbarkeit dafür, dass sie und ihr Mann ihn aufgenommen haben. Fragen nach seiner Herkunft empfindet sie als Affront.
Kurz vor seinem 14. Geburtstag fährt sie mit ihm im Bus nach Rostock und von dort mit dem Zug nach Stralsund. Einen Grund nennt sie ihm nicht, murmelt nur vage etwas von einer Verwandten, die sie besuchen wolle. In Stralsund ist ihr Ziel ein Krankenhaus. Wie ein Hund muss er draußen warten, denn angeblich ist das Betreten der Klinik für Kinder unter 14 Jahren verboten. Er hofft auf einen anschließenden Stadtbummel durch Stralsund, aber sie fahren sofort wieder zurück. Erst einige Jahre später findet er heraus, wen seine Adoptivmutter besuchte: seine ein Jahr jüngere Schwester, von deren Existenz er bis dahin nichts ahnte. Sie putzt und wäscht im Krankenhaus.
Durch einen gefälschten Brief sorgt er dafür, dass seine inzwischen 18-jährige Schwester zu ihm und seinen Adoptiveltern kommt. In drei Koffern bringt sie ihre Habseligkeiten mit, und dem Lehrerehepaar bleibt nichts anderes übrig, als sie aufzunehmen.
Kurz nach der Ankunft seiner Schwester muss er zur Nationalen Volksarmee. Da er inzwischen weiß, dass die Mutter ihn und seine Schwester als kleine Kinder in der DDR zurückgelassen hatte und in den Westen gegangen war, plant er während seines Dienstes an der Grenze ebenfalls nach Westdeutschland zu fliehen und nach ihr zu suchen. Aber der Posten, der mit ihm zum Dienst eingeteilt wurde und den er unter einem Vorwand wegschicken wollte, folgt ihm, als er durch ein Loch im ersten Zaun klettert. Will der andere ihn an der Flucht hindern oder ihn begleiten? Unschlüssig bleibt er stehen und uriniert. Der andere macht es ihm nach. Dann kehren sie zurück.
Während er bei der NVA ist, kann er nicht verhindern, dass seine Schwester von den Adoptiveltern als Haushaltshilfe ausgebeutet wird, bis sie von sich aus ins Krankenhaus in Stralsund zurückkehrt.
Von den nächsten Jahrzehnten im Leben des Ich-Erzählers erfahren wir nur wenig.
Ich trage ein Jahr lang Telegramme aus. Ich arbeite über ein Jahr lang in einer Tischlerei, transportiere mit einem rumänischen Tischlereilaster Holzteile, Türen, Fenster, Balken, bin nach dem Job als Kellner in Zügen unterwegs und fasse im zehnten Arbeitsjahr den Entschluss, Schriftsteller zu werden, mit allen Folgen einer freien Existenz, um eines Tages über meine Mutter zu schreiben. Den Titel Rampenwart für meinen letzten Job im Leben haben sie eigens meinetwegen erfunden. Ich werde als halber Rausschmeißer entlöhnt.
Ich habe mich eingeigelt, mich von der Welt abgewandt. Ich bin immer seltener im Freien anzutreffen. Ich habe eine Bude ohne Telefonanschluss in einer abseitigen Straße bezogen. Ich hauste, ich sah mir unendlich viele DVDs an, bedudelte mich mit inszeniertem Leben, um nicht mit dem meinen in Berührung zu kommen; dieselben Filme wieder und wieder. Ich aß Tage hindurch nichts, schlief auf dem Teppich, torkelte aufs Klo, mich zu übergeben, was nicht möglich war.
Bei der Wiedervereinigung ist er 36 Jahre alt. Er fährt er nach Nienhagen und besichtigt das Kinderheim, in dem er einige Jahre verbrachte. Schließlich findet er die Adresse seiner Mutter heraus, aber es dauert Jahre, bis er sich dazu durchringt, Kontakt mit ihr aufzunehmen. 2004 ruft der inzwischen 50-Jährige seine Schwester an und teilt ihr mit, dass er zur Mutter nach Eberbach am Neckar fahren werde. Aber für die Schwester ist die Mutter überhaupt kein Thema.
Mit einem Auto, das ihm ein Freund leiht, fährt er los.
Im Grunde bin ich fahruntauglich. Man müsste mich stoppen und auffordern, das Fahrzeug zu verlassen. Es gibt kein Gerät, das anzeigt, wie hochprozentig mit Erinnerungen ich angereichert bin.
In Eberbach nimmt er sich ein Zimmer in einer Pension und schaut sich erst einmal einige Tage lang um. Schließlich geht er zu der Adresse und liest den Namen der Mutter auf dem Klingelbrett des Wohnblocks. Statt sie unangemeldet zu überfallen, ruft er sie mit dem Handy an, behauptet, er komme morgen in die Stadt und vereinbart mit ihr eine Zeit für seinen Besuch.
Einer seiner Halbbrüder arbeitet bei Lidl an der Kasse. Dort kauft er eine Flasche Wasser, ohne sich zu erkennen zu geben, knipst aber heimlich mit dem Handy ein Foto.
Zur abgesprochenen Zeit klingelt er bei der Mutter.
Das Böse ist ihr ins Gesicht geschrieben. Das Grobe, Gefühllose. Eine Frau wie eine Bulldogge. Klein, stuckig, kräftig, abgestumpft.
Sie setzen sich in die Küche. Alles was er in der Wohnung sieht, findet er hässlich.
Wir haben uns nichts zu erzählen. Es kommt kein Gespräch auf. Wir sitzen wie Leute in einem Wartesaal, die eine Nummer gezogen haben und nun darauf warten, aufgerufen zu werden.
Die Tassen, Teller, Kuchengabeln auf dem Tisch sind aufgeregter als die unter uns weilende Mutter, der Grund meiner Reise hierher, die Mutterfahrt, die so lange Zeit meines Lebens das große Thema war.
Ich betrachte die Mutter und will nicht fassen, dass ich aus ihrem Schoß gekrochen bin, von dieser kalten Frau dort in die Welt geworfen sein soll.
Dann kommt ein 13- oder 14-jähriger Enkel seiner Mutter aus der Schule. Als der Besucher sich als Onkel vorstellt, ruft der Junge seine Mutter an und teilt ihr mit, dass ein bislang unbekannter Verwandter aufgetaucht sei. Seine Mutter verständigt Geschwister, und schließlich kommen vier von ihnen, um ihren Halbbruder zu begrüßen.
Mutter, Sohn, Schwester Nummer zwei, Schwester Nummer drei, Bruder Nummer eins, Bruder Nummer zwei und ein Neffe, sieben auf einen Streich, notiere ich, sieben Verwandte in der kleinen Küche, um den kleinen Tisch herum.
Die Mutter war 19, als sie ihn gebar. Zwei Jahre später ließ sie ihn und seine jüngere Schwester in der Wohnung in Rostock zurück und setzte sich in die Bundesrepublik ab. Mit ihrem bundesdeutschen Ehemann bekam sie weitere acht Kinder, vier Söhne und ebenso viele Töchter. Der Mann war alkoholkrank und kam vor 30 Jahren in ein Heim. Seither blieb die Mutter ohne Lebensgefährten.
Die Geschwister erzählen ihrem Halbbruder, die Mutter, eine „unmenschliche Despotin“, sei oft tage-, manchmal wochenlang weg gewesen. Dann passten die älteren Kinder auf die jüngeren auf, und Nachbarn kümmerten sich um sie. Eine Tante behauptete einmal, die Mutter habe zwei kleine Kinder in der DDR zurückgelassen, aber da würgte diese mit der Erklärung, die Kinder seien gestorben, das Gespräch ab.
Nach drei Stunden kehrt der Ich-Erzähler in die Pension zurück, und am nächsten Morgen fährt er wieder nach Hause. Unterwegs erhält er eine SMS:
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)GUTEN MORGEN. WIR WOLLEN ALLE NICHT, DASS DU UEBER UNSER ELEND FRUEHER SCHREIBST. DU KANNST UEBER DICH UND MAMA SCHREIBEN, DEINE GESCHWISTER NICHT. WIR FREUEN UNS AUF DICH ALS BRUDER, NICHT ALS AUTOR. KANNST DU DAS VERSTEHEN? LASSE UNSERE VERGANGENHEIT AUCH UNSERE SEIN.
„Rabenliebe“ ist ein autobiografischer Roman. Peter Wawerzinek rechnet mit der Mutter ab, die als 21-Jährige ihren zwei Jahre alten Sohn und dessen jüngere Schwester allein in der Wohnung in Rostock zurückließ und sich in den Westen absetzte. Im Alter von 50 Jahren nimmt er Kontakt mit ihr auf, aber der einmalige Besuch bei ihr zementiert nur seine Vorurteile. Frustration, Zorn und Hass führen Peter Wawerzinek die Feder: Er lässt kein gutes Haar an seiner Mutter und schildert auch seine Adoptiveltern mit Abscheu. Die fehlende Distanz und die Einseitigkeit der Darstellung schaden dem erschütternden Roman.
Peter Wawerzinek ist der Ich-Erzähler in „Rabenliebe“, der sich in einem langen stream of consciousness daran erinnert, wie er in Heimen und bei Adoptiveltern aufwuchs.
Die Erinnerung ist ein Bürgersteig. Erinnern ist wie über Gehwegplatten kommen, die groß sind, manche zerbrochen. Die Abstände wachsen. Zwischenräume werden Mühe. Du kannst nicht mehr von der einen zur nächsten Erinnerung treten.
Wenn ich mich erinnere, falle ich auf mich herein. Die Erinnerung ist eine Trickbetrügerin.
Der erste Teil des Romans endet mit dem Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee der DDR. Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht der Besuch des 50-Jährigen bei der Mutter. Über die Jahrzehnte dazwischen erfahren wir so gut wie nichts. Die Episoden in „Rabenliebe“ sind kurz und sprunghaft; nur selten setzt Peter Wawerzinek etwas in Szene, meistens schildert er nur, was geschah. Dabei sind ihm einige brillante Passagen gelungen, aber das Bemühen um Niveau stört eher, und es gibt auch sprachliche Entgleisungen:
Wie beim Hasen, der bei seinem Lauf über den Acker den Igeln nicht davonlaufen kann, ruft der Schnee mir zu: Bin schon da.
Vor allem im ersten Teil schiebt Peter Wawerzinek alle paar Seiten Pressemeldungen, juristische Texte („Annahme an Kindes Statt“), Zitate anderer Autoren wie Friedrich Hölderlin und Jack Kerouac, Volkslieder und Kinderreime ein. In den Meldungen geht es zunächst vor allem um Dutzende von Kindesmisshandlungen, dann aber auch zum Beispiel um einen Vater, der nach seiner Tochter suchte, um eine 54-Jährige, die ein halbes Leben lang ein totes Kind im Bauch trug, über einen Mann und eine Frau, die sich als Überlebende des Holocaust ausgaben und die Öffentlichkeit täuschten. Der zweite Teil von „Rabenliebe“ beginnt mit einem mehr als eine Seite langen Text aus einem Wörterbuch:
Mutter, die; – Mütter / Verkl.: Mütterchen, Mütterlein; / vgl. Mütterchen / Frau, die ein oder mehrere Kinder geboren hat, die Frau im Verhältnis zu ihrem Kind gesehen und bes. im Verhältnis des Kindes zu ihr: M. sein, werden; sie fühlt sich M. (fühlt, dass sie schwanger ist); ist M. geworden; die leibliche M. (Ggs. Stiefmutter; […] bemuttern, Mutter, die; –, -n Teil der Schraube, der das Gewinde drehbar umschließt: die M. (an einer Schraube) lösen, (fester) anziehen, anschrauben; die M. lockert sich, ist locker, lose, dazu Flügel-, Rad-, Schraubenmutter.
Der Titel bezieht sich auf das erzählende Gedicht „Der Rabe“ (1845) von Edgar Allen Poe. Seitenlang geht Peter Wawerzinek auf das Rabenmotiv ein.
Erinnerte Stationen des Glücks, abgelöst von Klagen, gegen seelische Grausamkeit, Schicksal, alles personifiziert in der Gestalt des Raben.
Den Roman „Rabenliebe“ von Peter Wawerzinek gibt es in einer gekürzten Fassung auch als Hörbuch, gelesen von Michael Rotschopf (Regie: Vera Teichmann, Berlin 2011, 620 Min, ISBN 978-3-8398-5077-0).
Peter Wawerzinek wurde unter dem Namen Peter Runkel am 28. September 1954 in Rostock geboren. Die alleinerziehende, bei der Niederkunft 19 Jahre alte Mutter ließ ihn und seine ein Jahr jüngere Schwester zwei Jahre später in der Wohnung in Rostock zurück und setzte sich in die Bundesrepublik ab. Die verwaisten Kinder wurden getrennt und in Heimen untergebracht. Ein Lehrerehepaar in der DDR adoptierte Peter, als er 10 Jahre alt war. Er absolvierte eine Ausbildung als Textilzeichner. Dann musste er zur Nationalen Volksarmee. Nachdem er ein paar Semester an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert hatte, schlug er sich mit verschiedenen Arbeitstätigkeiten durch und versuchte sich als Künstler, bis er 1988 Schriftsteller wurde. Mit seinem Roman „Rabenliebe“ schaffte er es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises, und er bekam dafür den Ingeborg-Bachmann-Preis.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2013
Textauszüge: © Verlag Kiepenheuer & Witsch