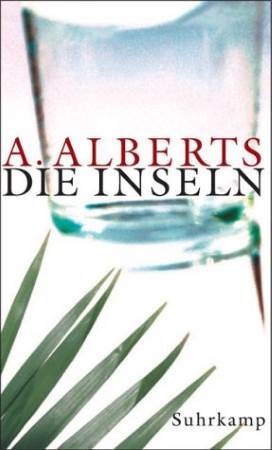Franz Werfel : Eine blassblaue Frauenschrift

Inhaltsangabe
Kritik
Wir befinden uns im Wien des Jahres 1939. Leonidas Tachezy ist Sektionschef, ein hoher Beamter im Kultusministerium. Er hat es weit gebracht, wenn man berücksichtigt, dass er aus kleinen Verhältnissen stammt: Sein Vater war ein armer, unbedeutender Lehrer. Durch Fleiß, glückliche Umstände und „glänzende Empfehlungen“ gelangte er an den gehobenen Posten im Staatsdienst. Mit seinem guten Aussehen, seiner charmanten Auftretensweise sowie seinem herausragenden Tänzertalent zieht er bei gesellschaftlichen Veranstaltungen die Aufmerksamkeit auf sich. So fiel er auch Amelie Paradini auf, der reichen Erbin eines weltweit tätigen Handelshauses. Sie setzte es sich in den Kopf, ihn zu heiraten und brachte die Ehe gegen erheblichen Widerstand der millionenschweren Verwandtschaft zustande – „die Extravaganz einer Sehrverwöhnten“ (Seite 41). Seit zwanzig Jahren sind sie jetzt verheiratet; die Ehe blieb kinderlos. Amelie, „sein großer, sein größter Lebenserfolg“, ist achtunddreißig und Leonidas, von seiner Frau León genannt, feiert heute seinen fünfzigsten Geburtstag.
Es treffen viele Glückwunschbriefe ein. Ein Kuvert ist darunter, das Leonidas gleich in die Augen sticht; auch Amelie scheint es bemerkt zu haben. Es ist nämlich nicht wie die anderen mit Maschinenschrift adressiert, sondern in einer markanten Frauenhandschrift in blassblauer Tinte geschrieben. Leonidas steckt die Umschläge ein und nimmt sie mit ins Amt.
Er erkennt die Handschrift und erinnert sich an Vera Wormser, die er als Dreiundzwanzigjähriger kennen lernte. Damals erteilte er Veras Bruder als Hauslehrer Nachhilfeunterricht und durfte auch an den Mahlzeiten der jüdischen Familie teilnehmen (was ihm wegen seiner finanziellen Knappheit sehr gelegen kam). Seine unbeholfenen Schwärmereien für die ihm intellektuell überlegene Fünfzehnjährige prallten an dem Mädchen ab.
Ich war mit dreiundzwanzig Jahren in meinem Elend eine noch nicht voll entwickelte Lemure. Vera aber, ein Kind, schien weit über ihre Jahre hinaus reif und gefestigt zu sein. Immer, wenn mich bei Tisch ihre Augen streiften, erstarrte ich unter dem arktischen Kältegrad ihrer Gleichgültigkeit. (Seite 47)
Durch einen Zufall begegneten sich Leonidas und Vera in Heidelberg in einer Pension nach sieben Jahren wieder. Vera war nach dem Tode ihres Vaters, eines Arztes, und ihres Bruders nach Deutschland gezogen. Die inzwischen Zweiundzwanzigjährige studierte Philosophie. Leonidas war sofort wieder von ihr hingerissen. Ihr Typ entsprach zudem seinem Geschmack. Im Gegensatz zu Amelie, die figürlich zur Fülle neigte, erfüllte Vera seine Vorstellungen; er hatte „eine unüberwindliche Zuneigung für kindhafte, ätherische, durchsichtige, rührend-zarte, gebrechliche Frauenbilder, insbesondere dann, wenn sie mit einem besonnenen und unerschrockenen Geiste gepaart sind“. (Seite 44) Leonidas und Vera verabredeten sich, machten zusammen Ausflüge, und nach anfänglichem Zögern gab Vera seinem Drängen nach. Zu seiner Verwunderung „ergab“ sich Vera bereits am vierten oder fünften Tag ihres Zusammenseins und „entgegen Veras freien Reden und oft burschikosem Gehaben“ (Seite 56) durfte er feststellen, dass er „der Erste“ gewesen war. Er war dreizehn Monate verheiratet als er den Ehebruch beging, dessen er sich zwar schuldig bekannte, den er aber nicht bedauerte.
Ich bekenne mich schuldig. Nicht aber liegt meine Schuld in der einfachen Tatsache der Verführung. Ich habe ein Mädchen genommen, das bereit war, genommen zu werden. Meine Schuld war, dass ich sie mala fide so restlos zu meinem Weibe gemacht habe, wie keine andere Frau jemals, auch Amelie nicht. Die sechs unzugänglichen Wochen mit Vera bedeuten die wahre Ehe meines Lebens. (Seite 56)
Er verwöhnte Vera mit wertvollen Geschenken, entwarf Zukunftspläne für sie beide zusammen. So sollte sie beispielsweise ihr Studium in Wien an seiner Seite vollenden, und als sie sich von ihm bei seiner Abfahrt im Zugabteil verabschiedete, versprach er ihr: „Noch vierzehn Tage und ich hole dich ab.“
Um seinen gewohnten Lebensstil beibehalten zu können und einen gesellschaftlichen Eklat zu vermeiden, ließ er Vera fallen. Seiner Frau sagte er nichts. Wie sie auch nie etwas von seinen anderen außerehelichen Eskapaden erfahren würde.
… er belobte sich selbst mit einiger Melancholie, weil er, ein anerkannt schöner und verführerischer Mann, außer der leidenschaftlichen Episode mit Vera nur noch neun bis elf gegenstandslose Seitensprünge in seiner Ehe sich vorzuwerfen hatte. (Seite 30)
Drei Jahre nach der Affäre mit Vera erhielt Leonidas während eines Urlaubs mit seiner Frau einen Brief von seiner früheren Geliebten, die sich am selben Ort zur Erholung aufhielt. Weil er sein schändliches Verhalten gegenüber Vera vor Augen hatte und befürchtete, der Brief könne eine unangenehme Nachricht enthalten und Amelie könne etwas erfahren, zerriss er ihn ungelesen.
Ingrimmig denkt Leonidas: Vera ist eben doch nur eine „intellektuelle Israelitin“. So hoch diese Menschen sich auch entwickeln können, an irgend etwas hapert’s am Ende doch. Zumeist am Takt, an dieser feinen Kunst, dem Nebenmenschen keine seelischen Scherereien zu bereiten. (Seite 26ff)
Und nun, nach weiteren fünfzehn Jahren, an seinem fünfzigsten Geburtstag, schickt ihm Fräulein Doktor Vera Wormser wieder einen Brief. Am liebsten hätte er ihn wie seinerzeit ebenfalls zerrissen, aber die „gesammelte Persönlichkeit der blassblauen Frauenschrift“ veranlasst ihn diesmal, den Umschlag aufzuschlitzen.
Oben auf dem Kopf des Briefes stand in raschen und genauen Zügen das Datum: „Am siebten Oktober 1936“. Man merkt die Mathematikerin, urteilte Leonidas, Amelie hat in ihrem ganzen Leben noch nie einen Brief datiert. Und dann las er: „Sehr geehrter Herr Sektionschef!“ Gut! Gegen diese dürre Anrede ist nichts einzuwenden. Sie ist vollendet, taktvoll, obgleich sich ein schwacher aber unüberwindlicher Hohn hinter ihr zu verbergen scheint. Jedenfalls lässt dieses „Sehr geehrter Herr Sektionschef“ nichts allzu Nahes befürchten. Lesen wir weiter!
„Ich bin gezwungen, mich heute mit einer Bitte an Sie zu wenden. Es handelt sich dabei nicht um mich selbst, sondern um einen jungen begabten Menschen, der aus den allgemein bekannten Gründen in Deutschland sein Gymnasialstudium nicht fortsetzen darf und es daher hier in Wien vollenden möchte. Wie ich höre, liegt die Ermöglichung […] eines solchen Übertritts in Ihrem speziellen Amtsbereich, sehr geehrter Herr. Da ich hier in meiner ehemaligen Vaterstadt keinen Menschen mehr kenne, halte ich es für meine Pflicht, Sie in diesem, für mich äußerst wichtigen Fall in Anspruch zu nehmen. Sollten Sie bereit sein, meiner Bitte zu willfahren, so genügt es, wenn Sie mich durch Ihr Büro verständigen lassen. Der junge Mann wird Ihnen dann zu gewünschter Zeit seine Aufwartung machen und die notwendige Auskunft geben. Mit verbindlichem Dank. Vera W.“ (Seite 31ff)
Wozu die Aufregung? Diesen Brief hätte Amelie ruhig lesen können, scheint ihm. Doch dann wird ihm die Zweideutigkeit der Nachricht bewusst.
Es war der harmloseste Brief der Welt, dieser hinterlistigste Brief der Welt. […] In diesem harmlosen Bittbrief aber hatte Vera ihm kundgetan, dass sie einen erwachsenen Sohn besaß und dass dieser Sohn der seinige war. (Seite 34)
Leonidas beschließt, sich kraft seines Amtes für den jungen Mann einzusetzen. Plötzlich freut er sich nämlich, einen Sohn zu haben – wenn auch von einer jüdischen Mutter. Als ein Ministerposten zu besetzen ist, schlägt er entgegen seiner sonstigen Einstellung einen „israelitischen“ Kandidaten vor, und stößt dabei auf Unverständnis bei seinen Vorgesetzten. Da sich seine Empfehlung für seine Karriere ungünstig auswirken würde, wie er noch rechtzeitig bemerkt, schließt er sich der allgemeinen Meinung der Behörde an, die den jüdischen Bewerber dann auf eine andere Stelle weglobt.
Außerdem will er seiner Frau eine Beichte ablegen. Da heißt es, einen günstigen Zeitpunkt zu erwischen und eine gut gelaunte Amelie anzutreffen. Der Gedanke, Vater zu sein, behagt ihm mittlerweile nicht mehr. (Er hat schon überlegt, ob er die Vaterschaft bestreiten soll.) Während er sich die Worte zurechtlegt, wie er ihr die Situation am Elegantesten beibringen könnte, überkommen ihn plötzlich Befürchtungen, ob Amelie ihn womöglich hintergeht.
War es denkbar, dass Amelie ihm ein treues Weib geblieben. diese ganzen zwanzig Jahre lang, ihm, einem eitlen Feigling, dem ausdauerndsten aller Lügner, der unter dem gesprungenen Lack einer unechten Weltläufigkeit ewig den Harm seiner elenden Jugend verbarg? Nie hatte er den gottgewollten Abstand zwischen sich und ihr überwinden könnne, den Abstand zwischen einer geborenen Paradini und einem geborenen Dreckfresser. Nur er allein wusste, dass seine Sicherheit, seine lockere Haltung, seine lässige Elegance anderen abgeguckt war, eine mühsame Verstellung, die ihn nicht einmal während des Schlafes freigab. (Seite 93)
Da Amelie noch nicht vom Friseur zurück ist (sie gehen an diesem Abend in die Oper), lässt er sich dazu hinreißen, in ihren Schubläden zu kramen.
Mit Herzklopfen suchte er die Briefe des Mannes, die ihn zum Hahnrei machten. Was er fand, waren die reinsten Orgien der Harmlosigkeit, die ihn gutmütig verspotteten. (Seite 93)
In ihren Kalendereintragungen liest er eine Bemerkung, die ihn stutzen lässt: Sie findet ihn in letzter Zeit unter anderm unaufmerksam ihr gegenüber, schiebt das aber auf „das gefährliche Alter der Männer“. Sie müsse aufpassen, glaube aber „felsenfest“ (dreimal unterstrichen) an ihn.
Amelie überrascht ihn dabei, wie er in ihren Sachen wühlt. Verlegen will Leonidas endlich sein Geständnis vorbringen; da wird der Gong zum Essen geschlagen. Wie üblich isst sie fast nichts, weil sie auf ihre Figur achtet, um León zu gefallen. Und als er ihr vorwirft, seinetwegen bräuchte sie sich nicht zu kasteien, ist sie sehr in ihrem Selbstgefühl gekränkt. Auch das Herumspionieren in ihren Briefen wirft sie ihm vor. Da habe sie sich noch eingebildet, er sei eifersüchtig, aber vermutlich sei er auf „wertvollere Dinge neugierig als auf Liebesbriefe“. Er habe ausgesehen wie „ein Hochstapler, ein Gentleman-Betrüger, wie ein Dienstmädchenverführer am Sonntag“ (Seite 100). Amelie bricht in Schluchzen aus, entschuldigt ihre Erregung aber zunächst mit dem langwierigen, strapaziösen Friseurbesuch. Der eigentliche Grund ihrer nervlichen Anspannung, gibt sie dann zu, sei aber der Brief, den er heute Morgen bekam, der, „mit einer verstellten, verlogenen Weiberschrift“. Da gibt er ihr den Brief, dessen Absender „Vera Wormser, loco“ Amelie bereits beim Frühstück erspäht hatte. Ihre Eifersucht war also unbegründet! Zerknirscht gesteht sie ihm, was sie sich alles ausgedacht hat, was ihn mit dieser Frau verbinden könnte. Sie habe sich ausgemalt, dass er ein Doppelleben führe, dass er vorhaben könnte, sie, Amelie, umzubringen, denn Vera Wormser dürfe er nicht umbringen, da sie die Mutter seiner Kinder sei. Sie habe sich schon im Sarg liegen sehen, und mit diesen albtraumhaften Bildern im Kopf, habe sie ihn dann vor ihrem Schreibtisch mit der offenen Schublade angetroffen. Er will sich nur mein Vermögen sichern, schoss es ihr durch den Kopf. Ausgesehen habe er wie ein „Testamentsfälscher und Erbschaftsschnüffler“. Ein Testament habe sie zwar nicht gemacht, aber es gehöre alles ihm. Sie bedauert ihren hysterischen Ausbruch. Schuld sei nicht er, sondern sie allein „und der Brief dieser unschuldigen Dame Wormser“.
Amelie ist erleichtert, sich ihre Befürchtungen von der Seele geredet zu haben, möchte aber doch noch gerne wissen, warum er von der ganzen Gratulationspost gerade den Brief „dieser wildfremden Person“ mit sich herumträgt. Fremd sei ihm die Dame ja nicht, beruhigt er seine Frau, er kenne sie aus seinen Tagen als Nachhilfslehrer. Dann sollte er aber auch was für den „begabten jungen Mann“ tun, meint Amelie.
Leonidas ist mal wieder gut weggekommen. Er hätte sich keine Gedanken machen müssen, wie er sich mit einer Aussprache am besten aus der Affäre zieht. Ohne sein Zutun hat sich sein Entschluss zu einer Beichte als überflüssig herausgestellt. Im Gegenteil: Amalie hat sich ihm geöffnet, was er als unverdienten Liebensbeweis auffasst.
Am Nachmittag geht Leonidas in das Hotel, in dem Vera logiert. Er lässt sich bei Frau Doktor Wormser anmelden und wartet in einer muffigen Hotelhalle; aber Vera lässt sich Zeit. Erst nach einer Stunde erscheint sie – ohne einen Grund dafür anzugeben. Er begrüßt sie mit „Gnädigste“ und übergibt ihr unausgewickelt achtzehn Teerosen, die sie in einen Trinkwasserkrug stellt. Nachdem sie ihn so lange warten ließ, nahm er an, sie habe sich sorgfältig zurechtgemacht, aber außer Lippenstift kann er kein Make-up feststellen. Verlegen sitzt er ihr gegenüber.
„Gnädigste haben gewünscht …“ begann er mit einem Ton, vor dem ihm selbst ekelte, „ich bekam erst heute früh den Brief und bin sofort … und habe sofort … Selbstverständlich steh ich voll und ganz zur Verfügung …“
[…]
„Sie hätten sich nicht persönlich bemühen müssen, Herr Sektionschef“, sagte Vera Wormser, „ich hab’s gar nicht erwartet … Ein telefonischer Anruf hätte genügt …“ (Seite 123)
In der weiteren Konversation, die Leonidas alles andere als gewandt und überlegen erscheinen lässt, erfährt er, dass Vera in den nächsten Tagen Deutschland verlassen wird. Es fällt ihm ein Stein vom Herzen! Er vermutet, dass es „jetzt nicht besonders angenehm sein muss, in Deutschland zu leben“. Worauf Vera kühl bemerkt, dass es für die meisten Deutschen sehr angenehm sei, „nur für unsereins nicht“ (Seite 127). Sie sagt ihm dann, dass sie nach Montevideo auswanderen werde, wo ihr eine Lehrstelle an einem College angeboten wurde. Da sie nicht verheiratet sei, falle ihr dieser Schritt nicht schwer. Leonidas bietet ihr dann an, dass sie den jungen Mann, Emanuel heißt er, am nächsten Tag ins Ministerium schicken soll. Trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten verbürgt er sich mit seinem Wort, dass „die Sache geregelt“ wird. Sicher sei Emanuel hochbegabt, wahrscheinlich sehe er Vera ähnlich, vermutet Leonidas. Warum sollte er, verblüfft sie ihn: „Emanuel ist der Sohn meiner besten Freundin.“ Und diese Freundin starb vor einem Monat; ihren Mann überlebte sie nur um neun Wochen. Ihr einziges Kind wurde Vera anvertraut. Leonidas jubelt insgeheim; alle seine Bedenken waren also unbegründet!
„Ich gebe Ihnen mein heiliges Versprechen, Vera, der Sohn Ihrer armen Freundin wird von mir gehalten werden wie Ihr eigener Sohn, wie mein eigener Sohn. Danken Sie mir nicht. Ich habe Ihnen zu danken. Sie machen mir das großmütigste Geschenk …“
Vera hatte ihm nicht gedankt. (Seite 136)
Vera schickt sich an, zu gehen. Er hält sie aber zurück, bittet sie um Verzeihung und überschwänglich gibt er ihr zu bedenken, dass seit achtzehn Jahren kein Tag vergangen sei, an dem „er nicht stumm wie ein Hund gelitten“ hätte. Bis vor wenigen Minuten sei er noch überzeugt gewesen, dass Emanuel ihrer beider Sohn sei und er „nahe daran war“, seine Pension zu beantragen, die Scheidung von seiner Frau zu verlangen und ein neues Leben zu beginnen.
In der Antwort der Frau [Vera] klang zum ersten Mal der alte echte Spott auf, jedoch wie vom Rand einer tiefen Erschöpfung:
„Wie gut, dass Sie nur nahe daran waren, Herr Sektionschef …“ (Seite 140)
Weiter bricht es aus Leonidas hervor: Er beteuert ihr seine immerwährende seelische Verbundenheit, und beim Abschied damals hätte er geahnt dass sie miteinander ein Kind haben würden. Er wirft sich selbst seine „treulose Feigheit“ vor, die ihn daran gehindert habe, nach ihr zu suchen.
„Wissen Sie, dass ich heute früh aus Feigheit beinahe Ihren Brief ungelesen zerrissen hätte, so wie ich damals […] Ihren Brief ungelesen zerrissen hab …“
Kaum war’s heraus, erstarrte Leonidas. Ohne es zu wollen, hatte er sich bis tief auf den Grundschlamm entblößt.
[…] „Das war sehr praktisch von Ihnen, damals“, sagte sie, „meinen Brief nicht zu lesen. Ich hätte ihn gar nicht schreiben dürfen. Aber ich war ganz allein und ohne Hilfe in den Tagen, als das Kind starb …“ (Seite 141 ff)
Der Junge war zwei und ein halbes Jahr alt. Es tut ihr Leid, jetzt von ihm gesprochen zu haben; sie hatte sich vorgenommen, nicht mit Leonidas darüber zu reden.
Leonidas konnte nichts mehr sagen, seine Augen brannten. Als er sich nach einer Weile umdrehte, war Vera gegangen.
Abends in der Oper fällt Amelie auf, dass Leonidas „über der blendenden Frackbrust ein zerknittertes und graues Gesicht aufgeschraubt trägt“. Er ähnelt jetzt nicht mehr dem „Götterliebling“, wie er sich immer bezeichnet hat. Sie macht sich Vorwürfe, dass ihre Szene von heute Mittag ihn verstimmt haben könnte. Aber bald ist sie abgelenkt, von all den hochgestellten Persönlichkeiten, die zu ihrer Loge herübergrüßen. Sie muss ihren Mann darauf aufmerksam machen und ihm die Namen der Prominenten zuflüstern. Denn Leonidas ist abgespannt, ausgelaugt, aber zugleich erleichtert, obwohl er weiß, dass er eine Gelegenheit verpasst hat, reinen Tisch zu machen mit seiner „Lebens-Schuld“. Sobald die Musik einsetzt, schläft Leonidas ein.
Der Sohn eines mittellosen Lehrers mit dem hochtrabenden Namen Leonidas kann auf seine steile Karriere stolz sein. Ein makabrer Umstand brachte ihn in den Besitz eines Fracks: Ein Kommilitone hatte sich erschossen und ihm das Kleidungsstück vermacht. Damit bekam er Zugang zur besseren Gesellschaft, wo er mit seinem guten Aussehen und eleganten Auftreten Eindruck machte und als exzellenter Tänzer bei Bällen gefragt war. So fiel er auch der schwerreichen Erbin eines traditionellen Handelshauses auf, die es sich in den Kopf setzte, ihn zu heiraten. Durch glückliche Umstände und Protektion gelangte er an einen hohen Staatsposten. Seit zwanzig Jahren ist er mit Amelie verheiratet; dass die Ehe kinderlos blieb, ist ihm ganz recht. Mit seinem oberflächlichen und langweiligen Leben (wenn man von seinen neun bis elf Seitensprüngen absieht) ist der Parvenü und Opportunist zufrieden
An seinem fünfzigsten Geburtstag wird er allerdings durch einen Brief in seinem Gleichmut gestört. Dieser Brief ist von einer früheren Geliebten, die er vor achtzehn Jahren in schändlicher Weise verlassen hatte. Drei Jahre nach Beendigung der Affäre seinerzeit, hatte er von Vera eine Nachricht bekommen – diese aber ungelesen zerrissen – und seither war er nicht mehr von ihr belästigt worden.
Nach fünfzehn Jahren bittet Vera Wormser, die „israelitische Intellektuelle“, Leonidas in ihrem Brief nun darum, ihr einen Gefallen zu erweisen, und zwar für einen Achtzehnjährigen, der unter den gegebenen Umständen in Deutschland (wir schreiben das Jahr 1939) nicht mehr zum Studium zugelassen ist. Als Sektionschef könnte er sicher eine Empfehlung für den jungen Mann in Wien aussprechen. Leonidas interpretiert das Bittschreiben in der Weise,, dass er der Vater dieses Jungen ist. Zuerst freut er sich, aber bald ist er schon weniger begeistert von der Situation. Er nimmt sich vor, Amelie eine Beichte abzulegen. Aber dazu kommt es nicht, denn seine Frau schüttet ihm ihrerseits ihr Herz aus.
Leonidas sucht Vera in ihrem Hotel auf. Während er ihr verlegen und gehemmt seine Bereitschaft zur Hilfe für den jungen Mann anbietet, lässt sich die selbstbewusste Frau nicht von den emotionalen Ausbrüchen ihres früheren Geliebten beeindrucken. Die Demütigung, die sie seinerzeit durch ihn erfuhr, hält sie ihm nicht vor. Gegenüber der souveränen Haltung Veras kann der tölpelhaft agierende Bonvivant nicht bestehen. Als Leonidas in seiner Erregung ausplaudert, dass er ihren ersten Brief seinerzeit ungelesen vernichtete, erklärt sie nur kühl, dass sie damals in großer Not und allein war, als ihr Sohn mit zweieinhalb Jahren starb. Der Junge für den sie die Bitte aussprach, ist ein Sohn ihrer verstorbenen Freundin, der ihr anvertraut wurde. Sie selbst werde wegen der politischen Umstände in Deutschland nach Montevideo auswandern.
Am Beispiel des Sektionschefs im Ministerium für Unterricht und Kultus, Leonidas Tachezy, erzählt Werfel eine Geschichte von Anstand und Moral, von Anfechtung und Verführung, von Schwächen und von Chancen. Es ist ebenso die Geschichte über den Verrat einer Liebe wie ein Sittengemälde der ersten österreichischen Republik mit ihrem latent allgegenwärtigen Antisemitismus.
(Dirk Rumberg, Süddeutsche Zeitung, 2. Februar 2008)
Die Novelle, 1941 veröffentlicht, ist in traditioneller Erzählweise geschrieben und insofern lesenswert, weil immer wieder einfallsreiche Beobachtungen eingestreut sind. Unvermutete Wendungen geben der Geschichte Schwung und halten den Leser bei Laune. Bei den Personenbeschreibungen hätte vielleicht die psychologische Befindlichkeit der Protagonisten eingehender dargestellt werden können; insbesondere bei Leonidas hätte man sich ein paar mehr Facetten seines Charakters gewünscht.
Axel Corti verfilmte die Novelle „Eine blassblaue Frauenschrift“ von Franz Werfel 1984 fürs Fernsehen:
Originaltitel: Eine blaßblaue Frauenschrift – Regie: Axel Corti – Drehbuch: Kurt Rittig, nach der Novelle „Eine blaßblaue Frauenschrift“ von Franz Werfel – Kamera: Edward Klosinski – Musik: Hans Georg Koch – Darsteller: Friedrich von Thun, Gabriel Barylli, Krystyna Janda, Friederike Kammer, Otto Schenk u.a. – 1984; 240 Minuten
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Irene Wunderlich 2006 / 2008
Textauszüge: ©
Franz Werfel (Kurzbiografie)
Franz Werfel: Der Abituriententag