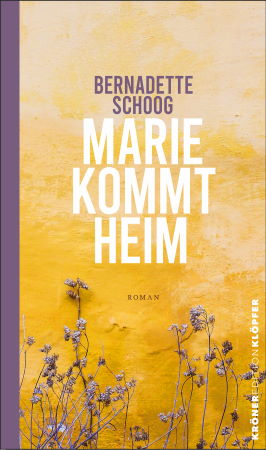Urs Widmer : Der Geliebte der Mutter
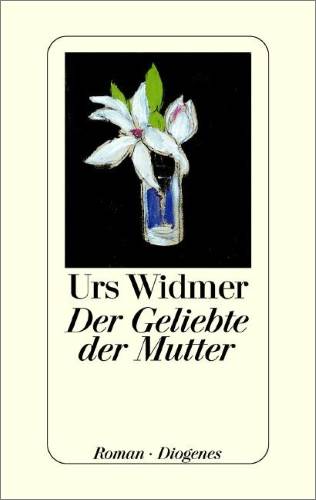
Inhaltsangabe
Kritik
Die Mutter liebte ihn ihr ganzes Leben lang. Unbemerkt von ihm, unbemerkt von jedermann. (Seite 5)
Um einigermaßen zu verstehen, wie es zu der verzweifelten Liebe Claras, der Mutter, zu einem egozentrischen, arroganten Künstler kommen konnte, muss man sich ihre Kindheit vor Augen halten.
Ein despotischer Vater, der sie merken lässt, dass sie unerwünscht ist, tyrannisiert und demütigt sie fortwährend.
Und wenn sie nicht eine Viertelstunde nach Schulschluss zurück war, verschloss der Vater die Tür. Da stand sie dann, klingelte und rief, bis der Vater das Türfensterchen öffnete, ein vergittertes Viereck, hinter dem er wie ein Gefängniswärter aussah, der aus irgendeinem Grund im Gefängnis drin war, während die Gefangene draußen um Einlass bettelte. Er sagte ruhig, klar, dass sie zu spät sei, da müsse sie nun halt warten, bis das Tor wieder aufgehe, irgendwann dann, jetzt jedenfalls gewiss nicht. Das habe sie ihrer Art zu verdanken. (Seite 12)
Die devote „Mutter der Mutter“ (bei Urs Widmer haben die engsten Familienangehörigen in dem Roman keinen Namen) ist ihr auch keine tröstende Stütze. Kein Wunder, dass Clara kein Selbstbewusstsein entwickeln kann, wenn ihr der Vater immer wieder vorwirft: „Niemand will dich! Keiner! Das ist wegen deiner Art!“. Und er brüllt sie an, sie solle in ihr Zimmer gehen: „Damit ich dich nicht mehr sehe!“
Was ist denn nun ihre „Art“?
Vielleicht war ihre Art, dass sie oft starr in einer Zimmerecke stand, mit Augen, die nach innen sahen, geballten Fäusten, einer glühenden Hitze im Hirn. Sie atmete kaum mehr dann, stöhnte zuweilen auf. In ihr drin kochte alles, nach außen hin war sie tote Haut. Taub, blind, Man hätte sie wie ein Stück Holz wegtragen können, wie einen Sarg, sie hätte es nicht bemerkt. Sie allerdings, hätte man sie in ihrer Fieberstarre überrascht, wäre vor Scham gestorben. Vor Schreck, vor Schuld. (Seite 12)
In ihrer Hoffnungslosigkeit träumt sie sich in eine heile Märchenwelt. Sie resigniert und unterwirft sich.
Nach dem Tod ihrer Mutter muss Clara allein für den Haushalt und den Vater sorgen. Das meistert sie, zwar verzweifelt, aber mustergültig.
Ihr Zimmer war wie Eis. (Der Vater duldete nicht, dass ihr Ofen über Nacht brannte.) Ihre Kleider waren steif gefroren. […] Die Wirbel, die sich in ihr drehten, drohten dann, sie mit sich zu reißen mit Haut und Haar. Als ob sie in sich selber weggurgeln könnte, sich in sich selber hineinstülpen und verschwinden, endgültig, von einem Todesstrudel in ihr Inneres gesogen. (Seite 27)
Manchmal wird sie vom Vater gelobt:
[…] ja, ja, das schmeckt gut, Kind. Fast wie zu Hause. – Zu Hause? Sie hatte gedacht, das hier sei das Zuhause. (Seite 27)
Die einzige Zerstreuung für Clara sind Konzertbesuche. In der Stadt gibt es ein ehrgeiziges Junges Orchester, das unkonventionelle Komponisten im Programm hat. Die Begeisterung der Musiker steckt sie an, insbesondere der Dirigent (!), Edwin, imponiert ihr. Sie besucht jetzt regelmäßig die Konzerte und geht nach der Aufführung mit den Musikern aus.
Die Mutter saß immer noch unten am Tisch, und Edwin oben. Nie sprachen sie miteinander. Edwin nickte ihr nicht einmal beim Abschied zu. Aber nach dem siebenten oder achten Konzert setzte er sich plötzlich neben sie und eröffnete ihr, dass sie ihm vom ersten Abend an aufgefallen sei. Dass er Erkundigungen über sie eingezogen habe. Und dass das Urteil seiner Freunde über sie günstig sei. […] Edwin fragte die Mutter, ob sie eine Art Mädchen für alles werden wolle. Herz und Hirn des Jungen Orchesters. […] Er sah sie ernst an, und sie sagte ja, ohne einen Moment zu überlegen. Über einen Lohn wurde nicht gesprochen. (Seite 29)
Mit Feuereifer stürzt sich die Dreiundzwanzigjährige in die neue Aufgabe. Nicht nur ihre Arbeitskraft setzt sie ein, auch das vom Vater ertrotzte Taschengeld verwendet sie für die organisatorische Tätigkeit. Papier, Porto, Druck für Handzettel werden von ihr bezahlt.
Vor den Proben stellte die Mutter die Stühle und Pulte bereit, zentimetergenau. Sie prüfte, ob der Raum genügend geheizt war. Ob ein Gebläse rauschte. […] Sie kam als Erste, ging als Letzte. (Seite 32)
Das alles tut sie unauffällig und klaglos – Edwin zuliebe.
Sie hatte nur Augen für ihn. […] Die Musiker sahen die Augen der Mutter sehr wohl. Nur Edwin bemerkte sie nicht. (Seite 33)
Und trotzdem ist Clara erfüllt von ihrer Aufgabe.
Sie war begeistert. Sie war glücklich. (Seite 34)
Das erste Gastspiel des Jungen Orchesters findet in Paris statt und wird natürlich sorgfältigst von Clara vorbereitet; für die Bahnfahrt hat sie den Musikern sogar Lunchpakete zurechtgemacht.
Nach dem Konzert zechen alle miteinander noch in einem Lokal und gehen betrunken ins Hotel zurück. Edwin „landet[e] irgendwie im Zimmer der Mutter und küsst[e] sie“. Sie haben eine Liebesnacht. Mit dem Zug fährt die gesamte Gruppe tags darauf wieder nach Hause. Edwin findet es nicht der Mühe wert, Clara nach der Ankunft nachts in ihre Wohnung zu begleiten.
Am nächsten Morgen – Clara bereitet gerade den Kaffee zu – stirbt der Vater. Nach der Beerdigung, als sie seine Unterlagen durchsieht, stellt sie fest, dass alle Wertpapiere durch den Börsencrash wertlos geworden sind. Blitzartig wird ihr klar:
Dass sie arm geworden war. Dass sie kein Geld mehr hatte, kein bisschen mehr als nichts. Sie war jetzt vierundzwanzig Jahre alt, hatte nichts gelernt, war schön und noch nie ohne Geld gewesen. Auf dem Konto war gerade noch der letze Lohn des Vaters. (Seite 47)
Das Haus – in schlechtem Zustand – muss sie verkaufen. Sie braucht ein Zimmer, und Edwin, der in eine elegantere Wohnung zieht, überlässt ihr seines.
Im Frühjahr besucht sie ihre Verwandten in Italien, wo sie sich etwas erholt.
Sie fand das Leben schön, ja eigentlich nur dann nicht, wenn ihre Art sie überwältigte. (Seite 59)
Ihre Art. Dieses Rätsel, das in ihr wohnte, auch ihr selber fremd. Ihre Art war nämlich inzwischen, dass – aber wann? Und warum? – alles in ihr heiß wurde, der Kopf, das Herz, der Bauch. […] Um sich zu retten, biss sie sich auf die Lippen und gab sich Schläge an den Schädel. Nach einer Zeit – Minuten? Stunden? – vergurgelte das glühende Entsetzen wieder tief in ihr. (Seite 60)
Zurück in der Stadt trifft sie sich wieder mit Edwin. Sie setzen ihre Liebesbeziehung fort. Aber:
Er liebte jetzt anders als in Paris. Er gab Befehle. Er tauchte unerwartet in dem Zimmer auf, das eben noch seines gewesen war und in dem nun die Mutter wohnte. Da stand er dann, lächelte, drückte seine Zigarette auf dem Nachttisch aus und herrschte die Mutter aufs Bett. Er wusste nun, wie er lieben wollte, und die Mutter liebte ihn so, wie er es wollte. […] Selten blieb er lange, nie eigentlich. Er zog die Hose an und ging, mit schmalen Lippen, grußlos. (Seite 61)
Clara wird schwanger. Edwin „versteinert“ bei der Nachricht. Er und auch Claras Bekannte reden auf sie ein, dass ein Kind „das Leben der Mutter zerstören [würde], und das Edwins sowieso“ (Seite 63). Zur Abtreibung wird sie von einer befreundeten Cellistin begleitet. In der Nacht bleibt sie allein.
Dann heiratete Edwin. Alle schienen von seiner Hochzeit gewusst zu haben, jede und jeder, seit Wochen. Für die Mutter, die beiläufig und Tage danach von dem herrlichen Fest hörte – „Wo hast du gesteckt? Es war großartig!“ –, war es, als habe der Blitz in sie eingeschlagen. (Seite 73)
Edwin, der inzwischen ein angesehener und auch bei Gastspielen gefragter Dirigent ist, heiratet eine schöne Frau, die zudem den Vorzug hat, Alleinerbin einer Maschinenfabrik zu sein.
Mit Clara hat Edwin nie über seine Hochzeit gesprochen. Die Beziehung bricht ab; nur zu ihren Geburtstagen schickt er ihr durch Fleurop eine Orchidee mit Kärtchen: „Alles Gute! E.“ – zweiunddreißig Jahre lang. Dann kommt keine Orchidee mehr: Die neue Sekretärin hat wohl die Kartei „ausgemistet“, vermutet Edwin später.
Bald heiratet auch Clara. Der Leser erfährt keinen Namen und auch sonst keine Angaben über den Ehemann, der auch der Vater von Claras Sohn sein wird.
Der Kult der Mutter um Edwin setzt nicht sofort ein, keineswegs. Sie wollte zufrieden sein, sie war es. Sie hatte ein Haus! Sie war eine Ehefrau! (Seite 76)
Pedantisch widmet sie sich Haushalt und Garten. Oft starrt sie traumverloren ins Nichts und murmelt vor sich hin.
Irgendwann aber hatte sie ihren Text gefunden, und der war: Edwin, Edwin, Edwin, Edwin. Jede Faser des Körpers der Mutter rief Edwin. Bald sangen alle Vögel Edwin, und die Wasser glucksten seinen Namen. (Seite 77)
Sie fängt damit an, nachts durch den Wald zu einem See zu laufen, mit einem schweren Stein, den sie vorher im Garten ausgegraben hat, und watet ins Wasser, „Edwin betend“, und ans andere Ufer starrend zu der festlich beleuchteten Villa Edwins.
Wenige Wochen nach der Hochzeit macht sie sich erneut zu einem Besuch ihrer Verwandschaft in Italien auf. Der Zeitpunkt ist allerdings unpassend, denn die gesamte Sippe bereitet sich gerade auf einen Besuch Mussolinis vor. Der Auftritt des Duce auf dem Anwesen der Weinbauern endet grotesk-komisch; er stolpert nämlich über die von Clara abgestellten Koffer und fällt beinahe hin.
Dann kam ihr [Claras] Kind zur Welt, ich, und diesmal wollte sie sich freuen dürfen. Sie wollte sich freuen, freuen, wenn sie ihr Kind ansah. […] Aber sie konnte es nicht, es gelang ihr einfach nicht. […] Ihre Art wurde nun jedenfalls, dass sie zitterte, wenn sie ein Glas Wasser trank, und bebte, wenn sie ein Stück Brot abschnitt. […] Sie stützte sich auf der Herdplatte auf und merkte nicht, dass ihre Hand schmorte. Umgekehrt lüftete sie stundenlang die Zimmer, wenn es draußen Stein und Bein fror. Sie konnte das Wort sterben nicht aussprechen – sagte stürbseln, kaum zu glauben – und ging im Kopf ihre Todesarten immer erneut durch. Das Rattengift aus dem Schuppen trinken. Sich die Pulsadern mit dem Küchenmesser durchschneiden. Tabletten verschlingen, alle aufs Mal, den Whisky trinken, den ganzen Vorrat, dann hinaus in den Schnee und sich unter den Nussbaum legen. Sich im Bad verbrühen. In den See gehen, nicht innehalten diesmal, den Stein nicht loslassen. – Das Kind wollte sie mitnehmen, das war selbstverständlich. „Das Kind mitnehmen“, so nannte sie es. (Seite 91ff)
Sie geht jetzt nachts wieder und wieder an den See. Diesmal mit dem Kind anstatt des Steins. Beim Hinüberstarren zu Edwins Villa übersieht sie, dass der Kleine mit dem Kopf unter Wasser gerät. Beinahe lässt sie ihn ins Wasser gleiten.
Clara besucht wieder einmal ein Konzert. Edwin dirigiert ein Werk von Béla Bartók. Den Komponisten kennt sie von ihrer früheren Arbeit für das Orchester. Nach der Aufführung macht sie die beiden am Ausgang schüchtern auf sich aufmerksam. Weder Edwin noch Bartók beachten sie.
In dieser Nacht saß die Mutter auf der Couch, biss in ein Kissen und rief: „Ich kann nicht mehr.“ Sie schlug den Kopf gegen die Wand. Sie konnte nicht mehr. Ein Arzt wurde geholt, und sie wurde weggeführt, ein wimmerndes Bündel mit dem Pelzkragenmantel um die Schultern. Das Kind, ich, kugelte hinter dem Transport drein, kletterte die Abgründe der Treppenstufen hinab und gelangte endlich auch ins Freie. (Seite 97)
Nach einer Elektrotherapie („sie sei das Schlimmste gewesen, was ihr je zugestoßen sei“, sagt sie viel später) kommt sie wieder nach Hause. Sofort macht sie sich daran, den Garten zu roden. Gemüse und Kräuter pflanzt sie an, Obst kocht sie ein. Das ist hilfreich, weil Lebensmittel knapp sind. Es ist nämlich Krieg. – Sie geht jetzt nicht mehr zum See.
Der Krieg ist im Mai 1945 vorüber.
„Hund“, sagte sie zum Hund. „Von heute an müssen wir den Frieden bestehen, wir zwei.“ Sie stand auf, stieg über das Kind hinweg, das auf dem Boden saß und mit Steinen eine Burg baute, ein uneinnehmbares Kastell, und ging ins Haus. (Seite 103)
Von einem früheren Bekannten erfährt Clara, dass Edwins Fabrik während des Krieges durch den ungeheuren Bedarf an verschiedenen Maschinen zu einem großen Unternehmen herangewachsen war. Edwin war auch nicht zimperlich gewesen, konkurrierende Firmen zu verdrängen, hatte am Krieg also gut verdient. Edwin war jetzt also nicht nur ein angesehener Dirigent, sondern auch der reichste Mann der Schweiz. Und bei den Frauen: „… da weißt du ja Bescheid. Er läßt noch immer nichts anbrennen“, wird ihr gesagt.
Die Art der Mutter war nun nicht mehr, wie ein Holzscheit in einer Ecke zu stehen, wie einst als Kind. Fiebernd vor Erregung, mit geballten Fäusten, nach innen verdrehten Augen, an Könige und Mörder denkend, deren Opfer und Beherrscherin sie war. […] Nein. Ihre Art war nun geworden, genauso wie die anderen Menschen zu sein. Normal. Ja, sie war – weil sie untrüglich zwischen einer Regel und ihrer Ausnahme zu unterscheiden wusste – normaler als die Normalen. […] Sie war genauer als die Genauen und pünktlicher als die Pünktlichen. (Sie selber sah das nicht so, sie war, in ihren eigenen Augen, nie perfekt genug.) (Seite 115)
Plötzlich stirbt Claras Mann. Wieder erfährt man keine näheren Umstände. Sie lässt ihn nicht im Familiengrab beisetzen.
Ihr Vater hätte das nicht gewollt. (Seite 118)
Clara nimmt nochmals Zuflucht bei ihren Verwandten in Italien. Drei, vier Mal sucht sie eine psychiatrische Klinik auf. Immer wieder besucht sie Konzerte des Jungen Orchesters. Als alte Frau unternimmt sie plötzlich Reisen – in den Osten der Türkei, nach New York. Sie fürchtet sich vor nichts und sorgt sich um niemand.
Am 17. Februar 1987 machte die Mutter das Bett in dem Heim für alte Menschen, in dem sie jetzt wohnte, stellte die Silberschälchen und Kerzenständer gerade und schrieb auf ein Stück Papier: „Ich kann nicht mehr. Lebt weiter und lacht. Clara.“ […] Die Mutter öffnete das Fenster – sie wohnte im sechsten Stock – und sah noch einmal zum sonnenleuchtenden anderen Ufer. „Edwin“, sagte sie. Dann sprang sie. Nun schrie sie, glaube ich. „Edwin.“ In ihr drin das Tosen all dessen, was sie in zweiundachtzig Jahren erlitten hatte, oder das Brüllen der Anfänge. (Seite 123)
Sie schlägt auf dem Autodach des Hausmeisters auf. – Die Trauerfeier findet in kleinstem Kreise statt. Kein Kranz von Edwin.
Die Geschichte ist erzählt. Diese Geschichte einer Leidenschaft. einer sturen Leidenschaft. Dieses Requiem. Diese Verneigung vor einem schwer zu lebenden Leben. (Seite 124)
Der Autor berichtet in einem Epilog, wie er zufällig den Geliebten der Mutter trifft. Er spricht Edwin an und gibt sich als Sohn Claras zu erkennen.
„Clara Molinari?“ sagte er. „Der Name ist mir im Augenblick nicht geläufig. Ich treffe so viele Menschen.“
„Ich bitte Sie!“ rief ich, jäh erregt. „Clara war das erste Ehrenmitglied Ihres Orchesters!. Das werden Sie doch wohl noch wissen!“
[…] „Aber natürlich! Die gute alte Clara. Wie geht’s ihr denn so?“
„Sie ist tot.“
„Ja.“ Er nickte. „Das sind wir alle jetzt immer häufiger.“ (Seite 125ff)
Und dann fragt der Sohn ihn noch, warum er Clara gezwungen habe, ihr Kind abzutreiben.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)„Ich zwinge keine Frauen zu nichts. Nie. Ich habe vier Kinder. Und ich bin den Müttern gegenüber immer großzügig gewesen. Äußerst großzügig.“ […] „Wenn Ihre Geschichte stimmen würde …“, rief er kichernd. „Da wären Sie ja mein Sohn!“ Er hob beide Arme und ließ sie wieder fallen. „Pech gehabt, junger Mann.“ (Seite 127)
Der Autor Urs Widmer – also der Sohn – versucht, die tragische Geschichte seiner psychisch kranken Mutter in teils authentischer, teils fiktionaler Erzählweise aufzuarbeiten. Einfühlsam, aber lakonisch und manchmal bewusst unterkühlt, schildert er den Lebensweg der seit ihrer Kindheit unterdrückten Frau. Nie larmoyant oder anklagend, auch nicht gegenüber dem hochnäsigen Künstler und gerissenen Geschäftsmann, dessen Ausstrahlungskraft das Leben seiner Mutter zerstörte, zeichnet er emotional zurückhaltend, aber sehr bewegend ein „biografisches Porträt der Mutter“ (so die Aussage von Urs Widmer).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Wer sich hier durch Angriff verteidigt, ist der Ich-Erzähler, der sich von der Mutter nicht geliebt fühlte. Sie konnte es nicht. Der Ich-Erzähler versucht, noch immer wütend, zu zeigen, warum.
Wut macht nicht subtil. Aber die Geschichte ist temporeich erzählt und spannend. Dabei lässt Widmer im Zeitraffer die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts Revue passieren. (Hans-Peter Kunisch, Süddeutsche Zeitung, 9. Juni 2007)
Inhaltsangabe und Rezension: © Irene Wunderlich 2004
Textauszüge: © Diogenes Verlag
Urs Widmer (Kurzbiografie)
Urs Widmer: Im Kongo
Urs Widmer: Das Buch des Vaters
Urs Widmer: Ein Leben als Zwerg
Urs Widmer: Reise an den Rand des Universums