Lukas Bärfuss : Hundert Tage
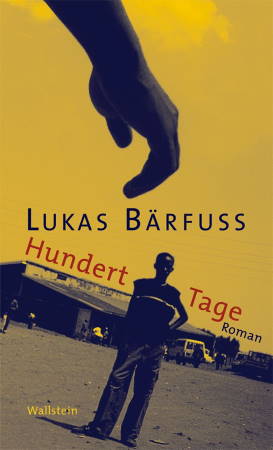
Inhaltsangabe
Kritik
Dienstantritt eines Idealisten
Als der 24-jährige Schweizer David Hohl Ende 1990 von Zürich über Brüssel nach Kigali fliegt, um in der Hauptstadt von Ruanda seinen Posten bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit anzutreten, beobachtet er, wie eine europäisch gekleidete junge Afrikanerin während der Passkontrolle von rassistischen belgischen Beamten beleidigt wird. Er protestiert, wird jedoch sofort von zwei Polizisten weggezerrt und erntet von der Betroffenen nur ein höhnisches Schnalzen mit der Zunge. Dass er sich dadurch in seiner Eitelkeit verletzt fühlt, wird noch Folgen haben.
Das erstbeste aufgetakelte Fräulein hatte meine Ideale gemeuchelt.
In Kigali wird der neue Mitarbeiter in einem eigenen Haus mit Garten („Haus Amsar“) untergebracht.
Die Direktion sah sich nicht als Behörde, wir begriffen uns als Unternehmen. Wir verwalteten nicht, wir gründeten, legten Hand an und gestalteten, und deshalb misstrauten wir den Sesselfurzern im Außenministerium, zu dem die Direktion administrativ gehörte. Diplomaten und andere Bedenkenträger waren unsere natürlichen Feinde, und am meisten hassten wir die Politik.
Verhängnisvoller Ausflug
Durch Zufall sieht David Hohl in Kigasi die Afrikanerin vom Flughafen in Brüssel wieder. Sie heißt Agathe Ndindiliyimana und will so schnell wie möglich zurück nach Belgien, wo sie studiert. Ihr Vater, ein Ministerialbeamter in Ruanda, verlangte von ihr, die Semesterferien bei der Familie in Kigali zu verbringen. Er will sie mit einem ihrer Cousins verheiraten, aber Agathe hat bereits einen Flug zurück nach Brüssel gebucht.
Am Tag vor ihrer Abreise unternimmt sie noch einen Ausflug mit David nach Gisenyi am Kiwusee. Dort erfahren sie gegen Abend, dass die Regierungstruppen die Straße von Ruhengeri nach Kigali nach einem Angriff der Tutsi-Rebellen auf den Grenzposten in Kagitumba gesperrt haben. Sie versuchen zwar, auf Umwegen rechtzeitig zurückzukommen, aber das gelingt ihnen nicht, und Agathe verpasst ihr Flugzeug.
Ich habe mich oft gefragt, was geschehen wäre, wenn ich damals nicht auf unserem Ausflug bestanden hätte. Sie wäre nach Brüssel gereist, keine Frage, wir hätten uns nie wiedergesehen, ich hätte die hundert Tage nicht in Kigali verbracht, und vielleicht würde Agathe sogar noch leben.
Bürgerkrieg
Der Zorn der Schweizer Direktorin Marianne und ihres Stellvertreters Paul richtet sich gegen die Tutsi-Rebellen, deren Krieg gegen die Hutu-Regierung die Erfolge der Entwicklungshilfe gefährdet.
Paul nahm den Krieg persönlich; für ihn war es, als griffen die Rebellen ihn an, seine Arbeit, die nicht nur die Arbeit von sechs Jahren war, seit er nach Kigali gekommen war, sondern die Arbeit der letzten dreißig Jahre.
Bei der für David angestellten Putzfrau Erneste handelt es sich um eine Tutsi. Als er erfährt, dass sie sieben Kinder zu versorgen hat, stellt er ihr einen Teil des Gartens für den Gemüseanbau zur Verfügung, ohne das mit seinen Vorgesetzten abzusprechen.
Agathe bleibt vorerst in Kigali und besucht immer wieder heimlich David im Haus Amsar.
Sie liebte, wie sie aß: um ein Bedürfnis zu stillen, für das sie keine Verantwortung trug, das einfach da war und schrie, wie ein Baby schreit, um das man sich zu kümmern hat. Für mich war das Erschreckendste, dass Agathe dieses Bedürfnis genau zu kennen schien.
Einmal überrascht Agathe ihn mit einem Besuch, als Erneste da ist. Die Hutu-Angehörige gießt sich in der Küche ein Glas Milch ein − nur um es auf den Kachelboden fallen zu lassen und herrscht dann die Tutsi-Frau an, die Scherben aufzuheben.
Und Erneste gehorchte stumm, ließ sich nichts anmerken, während Agathe danebenstand und sie beschimpfte, meinte, jetzt sei die Kakerlake dort, wo sie hingehöre, auf dem Boden nämlich. Erneste ließ alles über sich ergehen, wischte auf, und ich habe danebengestanden und mit Schrecken festgestellt, wie sich in meiner Hose etwas rührte, während sich plötzlich die Milch rosa zu färben begann. Erneste hatte sich an einer Scherbe verletzt, was Agathe nicht besänftigte […].
Sobald Erneste fort ist, fallen David und Agathe übereinander her und treiben es wie von Sinnen.
Nachdem David zwei Männer davon abgehalten hat, im Garten einen Bussard totzuschlagen, sammelt er Aas, um den Raubvogel damit zu füttern, der wegen eines gebrochenen Flügels nicht mehr fliegen kann.
Oft sammelte ich mehr, als der Bussard an einem Tag fressen konnte. Ich legte die Kadaver in den Gefrierschrank und taute dann das Futter portionsweise auf.
Als Agathe das mitbekommt, meint sie spöttisch, er habe zu viele Ritterromane gelesen. Von einem Afrikaner, der Hunde-Kadaver verkauft, lässt sich David beliefern und denkt dabei:
Ich zerhackte Hunde, die man meinetwegen totschlug, gesunde, starke Hunde, zerhackte sie, um sie einem verkrüppelten Vogel zu verfüttern.
Im August 1993 soll ein Friedensvertrag die Kämpfe beenden.
Eine Mehrparteienregierung sollte eingesetzt werden, die Flüchtlinge sollten zurückkehren können, und schließlich trafen auch noch die Kavallerie und die Blauhelme unter Führung dieses kanadischen Generals mit dem Schnurrbart und den traurigen Augen in Kigali ein. Nur die UNO-Soldaten aus dem belgischen Kontingent stifteten Unruhe. […] und in der Direktion schüttelten wir den Kopf über die Vereinten Nationen, die ausgerechnet Soldaten der verhassten Kolonialmacht als Friedensstifter schickten.
Im Frühjahr 1994 wird Paul von einer jugendlichen Tutsi-Prostituierten mit Aids infiziert. Der 53-jährige stellvertretende Direktor wagt es nicht, seiner Ehefrau Ines die Wahrheit zu gestehen.
Ein Mann, der wegen etwas Alkohol und Sprechgesang seine Beherrschung verliert, ein Feigling, der lieber seine Frau ansteckt, als ihr zu erklären, dass er nicht der heilige, selbstlose Entwicklungshelfer war […]
Völkermord
Die Direktion will nicht wahrhaben, dass die von der Entwicklungshilfe profitierende Hutu-Regierung einen Genozid an den Tutsi organisiert.
[…] wir sahen nur unsere Tugend, die uns zu helfen befahl. Und ich glaube nicht einmal, dass sie uns betrogen oder hinters Licht führten, sie behelligten uns einfach nicht mit den Dingen, die unsere Redlichkeit in Frage stellten.
Sie verlangten nach Schreibgerät, und weil Bleistifte nichts Schlechtes sind und das Gute ohne sie nicht geschaffen werden kann, weil jede gute Tat einen Bleistift erfordert, einen Bleistift und einen Lehrer, ein Telefon und eine Straße, weil es keinen besseren Beweis für unsere Redlichkeit gab und wir durch irgendeinen geheimen Fluch gezwungen waren, uns immer und immer wieder unsere Rechtschaffenheit zu beweisen, weil es kein besseres Zeichen gab als eine begradigte Straße, ein zum ersten Mal in einer abgelegenen Präfektur klingelndes Telefon, einen angespitzten Schweizer Bleistift in der Hand eines subalternen Beamten, deshalb gaben wir ihnen den Bleistift, mit dem sie dann die Todeslisten schrieben, deshalb legten wir ihnen die Telefonleitung, durch die sie den Mordbefehl erteilten, und deshalb bauten wir ihnen die Straßen, auf denen die Mörder zu ihren Opfern fuhren.
Als der Staatspräsident Juvénal Habyarimana am 6. April 1994 von einer Gipfelkonferenz in Daressalam zurückkehrt, wird das Flugzeug beim Anflug auf Kigali von zwei Raketen getroffen und stürzt ab. Der Anschlag wirkt wie ein Fanal. Die Hutu halten die Tutsi für die Täter. Mit Gewehren, Macheten und Nagelkeulen bewaffnete Hutu-Milizen machen Jagd auf Tutsi („Kakerlaken“) und verschonen dabei auch keine Frauen und Kinder.
Die Entwicklungshelfer werden evakuiert.
Der kleine Paul und Marianne und die anderen Expats, sie verließen die brennende Stadt, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ihre Arbeit war getan, die Menschen hatten sich ihrer Redlichkeit nicht würdig erwiesen.
Ausgerechnet Missland, ein vor längerer Zeit als Entwicklungshelfer nach Ruanda gereister Schweizer, der jedoch wegen seiner Unmoral entlassen wurde, zeigt in dieser Lage Mitmenschlichkeit.
Und wenn ich dann Missland sah, diesen lüsternen, nur auf die Befriedigung der eigenen Triebe bedachten Menschen, der sich von keiner Vernunft, keiner Moral leiten ließ, sondern allein seinem Schwanz folgte, der seinem Leben die Richtung vorgab, und der doch, im Gegensatz zu uns, tatsächlich das Gute tat, indem er im April vierundneunzig seine kleine Denise und sie ihre Familie außer Landes brachte, nicht, weil er ihre vier Brüder, drei Schwestern, sechzehn Cousinen und drei Onkels und Tanten mochte, ganz im Gegenteil, er verachtete sie und rettete sie bloß, weil er Denises süßen Hintern ohne die fetten Ärsche ihrer Verwandten nicht retten konnte. Denise hätte ihre Familie niemals in Kigali zurückgelassen, und wenn Missland sie weiterhin flachlegen wollte, musste er alle außer Landes bringen. Er verkaufte, was er besaß, den Wagen, das Haus, das Mobiliar. Das Geld reichte gerade für die einunddreißig Flugscheine und Reisepässe mit den notwendigen Visa, und achtundvierzig Stunden nach dem Abschuss der Präsidentenmaschine saßen sie in einer Maschine, die sie sicher nach Brüssel brachte. Dieser ewig geile Bock, dieser Mensch, der sich nicht um sein Ansehen scherte, korrupt war bis auf die Knochen – er ist doch der Einzige von uns allen, der sein ganzes Vermögen opferte und Leben gerettet hat, und nicht nur eines, dreißig Seelen hat er gerettet, das heißt, neunundzwanzig Seelen und einen Arsch, um genau zu sein.
100 Tage in der Hölle
Weil David seiner afrikanischen Geliebten beweisen will, dass er kein Feigling ist, versteckt er sich während der Evakuierung und bleibt im Haus Amsar in Kigali. Notdürftig versorgt wird er von seinem ehemaligen Gärtner Théoneste, einem plündernden Hutu, der seine Beute im Haus Amsar lagert.
Ich gab ihm zu verstehen, was ich von den Plünderungen hielt, aber er meinte, es sei besser, man rette wenigstens die Ware. Es mache niemanden wieder lebendig, wenn man das Zeug dem Regen und den Termiten überließ. Die Toten hätten keine Verwendung dafür, er aber könne mit dem Geld Essen kaufen, und er habe nicht nur für seine Kinder, sondern auch für mich zu sorgen, und weil ich tatsächlich auf seine Rationen angewiesen war, ließ ich ihn gewähren.
Als David begreift, dass Théoneste nicht nur plündert, sondern zu den Mordbanden gehört, verprügelt und vertreibt er ihn.
Ich bereute meine Schläge bereits, als er mir den Rücken zuwandte, denn wer würde mich nun mit Lebensmitteln und Wasser versorgen?
Vom Durst getrieben, zeigt David sich sechs jungen Milizionären, die sich im Garten des Hauses Amsar ausruhen wollen.
[…] und es war mir egal, was sie mit mir anstellten, sollten sie mich erschlagen, wenn sie mich vorher nur trinken ließen.
Die Mörder kommen nun regelmäßig vorbei und bringen dem Schweizer Proviant.
Er wundert sich darüber, dass der flugunfähige Bussard, den er schon lange nicht mehr gefüttert hat, wohlgenährt aussieht. Ist der gebrochene Flügel geheilt? Kann der Raubvogel wieder fliegen und jagen? Dann bemerkt David, dass der Bussard einen menschlichen Daumen in den Klauen hat. Er holt eine Machete aus dem Schuppen und köpft das Tier.
Théoneste taucht noch einmal auf – mit dem Fahrrad, das Erneste gehörte. Aus sicherer Entfernung kündigt er David an, dass er mit seiner Familie am nächsten Tag Kigali verlassen werde und rät dem Schweizer, sich ihnen anzuschließen.
Und das Fahrrad, fragte ich, das Fahrrad wirst du wohl mitnehmen, nicht wahr? Ich habe sechs Kinder, Monsieur, und meine Frau erwartet das siebte. Sie wird auf dem Fahrrad sitzen. Musste sie deshalb sterben, Théoneste, musste Erneste sterben, weil du ihr Fahrrad wolltest […]. Sie wissen, was sie war, Monsieur, gab er zur Antwort, eine Ibyitso war sie, eine Verräterin, und ich habe nur getan, was man uns aufgetragen hat.
Théoneste will sich gleich wieder verabschieden, aber David hält ihn auf, bis die Milizionäre mit Proviant kommen. Théoneste stellt sich vor, beteuert, ein Hutu zu sein, kann sich aber nicht ausweisen, weil ihm seine Identitätskarte aus der Tasche gerutscht ist. David hat sie längst unter einem Stuhl liegen sehen, sagt jedoch nichts und sieht zu, wie Théoneste nach draußen gezerrt wird. Der Mord dauert nicht lang.
Das Wiedersehen mit Agathe
Schließlich bringen die vor der Rache der überlebenden Tutsi fliehenden Milizionäre den Schweizer über die kongolesische Grenze in ein Lager. Während der mehrtägigen Fahrt trägt er ein ein rotes Hemd mit weißem Kreuz.
[…] und das rettete mir zwar das Leben, brachte mir aber auf der Reise auch viele Unannehmlichkeiten. Kranke und Verzweifelte baten mich um Hilfe, darunter eine alte Frau ohne Zähne, die unerträglich nach Kot stank. Sie verlangte Essen und Medikamente, und es kostete mich einige Mühe, diese lästige Person abzuschütteln. Sie war nicht die Einzige, immer wieder musste ich erklären, dass dies ein weißes Kreuz auf rotem Grund und kein rotes Kreuz auf weißem Grund war, und ich also kein Helfer war […].
Ein Mann berichtet, dass in einem Flüchtlingslager bei Goma eine augenscheinlich Verrückte das Sagen habe,
[…] die den ganzen Tag wie eine Hofdame durch das Lager promeniert sei. Alle Welt habe sie Madame Pompadour genannt, weil sie immer einen Sonnenschirm trug und durch das Elend schlenderte, als erginge sie sich in einem Schlosspark. Vier Milizionäre folgten ihr auf Schritt und Tritt, allesamt bewaffnet, obwohl Waffen im Lager verboten waren. Aber es gab niemanden, der es gewagt hätte, ihnen die Gewehre wegzunehmen, und die Frau habe einen Ruf besessen, der es vernünftiger erscheinen ließ, wenn man sich nicht mit ihr anlegte. Was man über sie erzählt habe, wollte ich wissen, und er meinte, Genaues habe man nicht erfahren, nur dass sie die Anführerin einer Miliz gewesen sei, und was diese angerichtet hätten, sei ja nun wohl bekannt.
Einige Zeit später erreicht David mit einem Reporter von Agence France Press das Lager Mugunga bei Goma. Er findet Agathe, die an Cholera erkrankt ist und im Sterben liegt. Erstaunt blickt sie ihn an. Zunächst glaubt er, sie wundere sich darüber, dass er nicht nach Europa geflohen sei, wie sie annahm, aber dann begreift er, dass der Gesichtsausdruck durch den in diesem Augenblick eintretenden Tod hervorgerufen wird. Sie stirbt mit einem Schnalzen der Zunge, wie er es bereits in Brüssel von ihr hörte.
Rahmenhandlung
David Hohl kehrt in die Schweiz zurück. In seiner Wohnung im Jura berichtet er einem früheren Mitschüler, der ihn dort besucht, von seinen Erlebnissen in Ruanda.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Der Protagonist des Romans „Hundert Tage“ von Lukas Bärfuss erzählt in der Ich-Form und im Nachhinein von seinen Erlebnissen als Schweizer Entwicklungshelfer 1990 bis 1994 in Ruanda. Während der letzten hundert Tage seines Aufenthalts fand dort ein unter den Augen der Entwicklungshelfer vorbereiteter Genozid an schätzungsweise 800.000 Tutsi statt (Völkermord in Ruanda). Die Darstellung erfolgt also aus der Sichtweise des Schweizers David Hohl, der als Idealist nach Afrika ging und vier Jahre später als gebrochener Mann zurückkam.
Lukas Bärfuss arbeitet vor allem heraus, wie gut gemeinte Entwicklungshilfe ungewollt zum Aufbau der Ordnung beitrug, die den organisierten Völkermord überhaupt erst ermöglichte.
[…] jetzt weiß ich, dass in der perfekten Hölle die perfekte Ordnung herrscht, und manchmal, wenn ich mir dieses Land hier ansehe, das Gleichmaß, die Korrektheit, mit der alles abgewickelt wird, dann erinnere ich mich daran, dass man jenes Höllenland auch die Schweiz Afrikas nannte, nicht nur der Hügel und der Kühe wegen, sondern auch wegen der Disziplin, die in jedem Lebensbereich herrschte, und ich weiß jetzt, dass jeder Völkermord nur in einem geregelten Staatswesen möglich ist, in dem jeder seinen Platz kennt […]
Nein, wir gehören nicht zu denen, die Blutbäder anrichten. Das tun andere. Wir schwimmen darin. Und wir wissen genau, wie man sich bewegen muss, um obenauf zu bleiben und nicht in der roten Soße unterzugehen.
Offenbar hat Lukas Bärfuss die Ereignisse 1990 bis 1994 in Ruanda gründlich recherchiert. Er veranschaulicht das grausam endende Geschehen in einer schnörkellosen klaren Sprache und entwickelt die Handlung ebenso stringent wie temporeich. Gerade deshalb ist „Hundert Tage“ eine erschütternde Lektüre.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2020
Textauszüge: © Wallstein Verlag



















