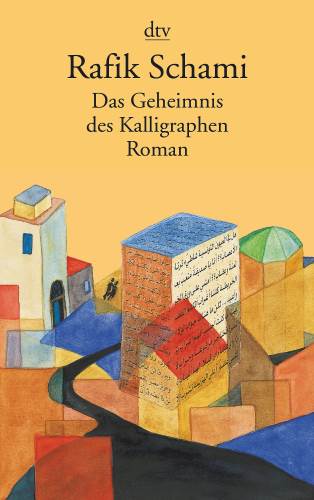Finn Job : Hinterher

Inhaltsangabe
Kritik
Abreise aus Berlin
Der Ich-Erzähler, ein Mann Anfang 20, dessen Namen wir nicht erfahren, kündigt als Barmann in einem Klub in Berlin.
Das frenetische Hämmern, der chemische Dunst der halbnackten Leiber und das grün flackernde Licht, die Ekstase in den leeren Gesichtern, das Hochschnellen der Jalousien, ein kurzer Schimmer des Tages, nur dazu da, die immerwährende Nacht noch zu verdunkeln, der darauffolgende Jubel, nicht über das Licht, nein, über die Dunkelheit, immer über die Dunkelheit – mir bis vor wenigen Minuten zuwider, versetzte es mich nun in eine gar haltlose Trance. Nein. Mein Körper wurde nicht durchströmt von jener verlorenen Elektrizität, jener fremd gewordenen Mischung aus kollektivem Wahn und enthemmter Subjektivität, jener Mischung, für die ich die bebende Masse wieder und wieder hassen gelernt hatte. Nein. Ich hasste sie auch jetzt. Allein, nie mehr muss ich dieses Spektakel ertragen.
Feine Rinnsale flossen mir in die vom stehenden Rauch der Zigaretten, vom gleichsam stehenden Dampf der Nebelmaschinen bereits tränenden Augen. Nein, die Erlösung, die ich mir von diesem Moment erhofft hatte, trat nicht ein. Nie tritt sie so ein, wie man sie erhofft.
An seinem letzten Abend im Klub sieht er zufällig Francesco wieder, von dem er schon lange nichts gehört hat. Mit ihm geht er in eine Toilettenkabine, und Francesco fragt:
„Was wollen wir nehmen, Boy? Koks? Keta? Beides? Speed? Noch was?“
„Ja, warum nicht.“
Ich warf meine erst angerauchte Zigarette ins verdreckte Klo und sah zu, wie Franceso drei Hügel weißen Pulvers auf sein Telefon schüttete. Er zitterte so sehr, dass die Hälfte auf dem Boden landete. Besser, ich nahm ihm die Utensilien aus der Hand, vermengte die drei Hügel zu einem einzigen Berg und schob das Pulver mit seiner Kreditkarte auf dem zersprungenen Bildschirm hin und her.
Francesco fordert ihn auf, in der nächsten Woche mit nach Frankreich zu kommen. Ein Freund in der Normandie verfüge über die Schlüssel für eine Kirche, erklärt Francesco, und da werde er eine Installation machen. Boy wirft ein, dass er kein Geld habe, aber Francesco will alle Kosten übernehmen.
Ein paar Tage später ruft Francesco an und nennt als Treffpunkt Peters Fünf-Zimmer-Wohnung in Neukölln, in der früher eine WG hauste, zu der auch der Ich-Erzähler und sein Geliebter Chaim gehörten. Seit Chaim vorletztes Jahr ausgezogen und nach Tel Aviv übersiedelt war, hatte er die Wohnung nicht mehr betreten.
Peter reicht ihm seinen Speed-Spiegel. Ein Joint geht herum. Ab und zu klingelt jemand, der von Peter Drogen kaufen möchte.
Auch Sophia ist da. Mit ihr, seiner Jugendfreundin, kam der Ich-Erzähler gleich nach dem Abitur aus einem ostwestfälischen Dorf nach Berlin, „in dieses große, stinkende Babel“. Sophia ruft ihren Freund aus Thüringen an, und als der in Peters Wohnung kommt, sucht er sogleich nach Sophias Ex-Freund: „Also, wo ist jetzt dieser Nazi?“
Der Ich-Erzähler versteckt sich in Chaims früherem Zimmer, und als Francesco eintrifft, um ihn abzuholen, wagt er sich nicht aus der Deckung. Kurz nachdem Francesco wieder gegangen ist, reißt er die Zimmertür auf, rennt aus der Wohnung und hetzt in großen Sprüngen über die Treppe hinunter. Im Freien trifft ihn ein Schlag, der ihn gegen einen geparkten Lieferwagen prallen lässt.
Nicht die Faust des Thüringers hatte mich getroffen, auch war es keiner von den Männern mit den bunten Schläuchen und den Ressentiments – nein, ein Rad, natürlich!, ein Fahrrad. Ständig vergaß ich die Fahrräder. Und warum fuhren sie auch auf dem Bürgersteig?
Im nächsten Augenblick hält der maulbeerfarbene Porsche Cayenne neben ihm, den Francesco von seiner Mutter geliehen hat.
Er trug eine riesige Gucci-Sonnenbrille, ein enganliegendes, fleckiges Feinrippunterhemd und zu allem Überfluss eine kurze, silbern schimmernde Thaiboxhose.
Die Papiere und die Geldbörse des Ich-Erzählers sind zwar in dem kleinen Rollkoffer, den er bei seiner Flucht in Peters Wohnung zurückließ, aber das hält die beiden Männer nicht davon ab, nach Frankreich zu fahren. Dabei betrinken sie sich und schnupfen Kokain.
Francesco erzählt, dass er zwar in Berlin geboren wurde und aufwuchs, aber im Alter von fünf Jahren mit seiner Mutter nach London zog. Nachdem er von den meisten Privatschulen dort geflogen war, schickte ihn seine Mutter zum Vater nach Charlottenburg zurück. Da war er 17.
Die Reise nach Frankreich
Unterwegs besichtigen sie die Kathedrale von Amiens. Kurz vor dem Ziel spricht Francesco von Gédéon, dem etwa zehn Jahre älteren Mann mit dem Schlüssel für die Kirche, bei dem sie wohnen werden. Der war in kleinbürgerlichen Verhältnissen in Nogent-sur-Seine aufgewachsen. Während er in Paris Schauspiel studierte, starb seine Großmutter und vererbte ihm eine eine herrschaftliche Villa in der Normandie. Gédéon brach daraufhin sein Studium ab, zog in die Villa und nahm sich vor, ein Hotel für Künstler daraus zu machen, aber dafür fehlt es ihm an Geld.
Verkatert wacht der Ich-Erzähler am nächsten Morgen auf, und weil er nirgendwo eine Schmerztablette findet, schnupft er ein wenig Kokain, das zwar seinen nüchternen Magen reizt, aber seinen Kopf kaum betäubt.
Aus irgendeinem Grund verwahrt Gédéon den Schlüssel für die Chapelle Saint-Michel aus dem Jahr 1788, die Francesco bei seiner Kunstaktion mit Alufolie verspiegeln will.
„Das Ziel ist, dass man in die Kirche geht und überall sich selbst sieht. Nice, oder? Anstelle von Gott trifft man hier dann sich selbst – egal, wo man hinschaut.“
Allerdings gibt es in der Gegend weder Kirchgänger noch Kunstinteressenten. Und bevor Francesco anfangen kann, drückt ihm Gédéon eine verrostete Spitzhacke und seinem Begleiter einen Vorschlaghammer in die Hand.
„Bonjour mes amis! Aujourd’hui we start with the ground floor.“
Gédéon erwartet, dass sie den Holzboden herausreißen, weil das Fischgrätenparkett „nicht mehr contemporary“ sei. Aber nach ein paar Minuten ändert er seine Vorstellungen und fordert sie auf, eine Wand zu zertrümmern, um Platz für die Portiersloge zu schaffen. Francesco fügt sich und erklärt seinem Freund:
„Er will nur, dass man ihn kurz ernst nimmt, ihn appreciatet […]. Er merkt immer selbst nach fünf Minuten, dass seine Idee schwachsinnig ist. Dann will er, dass man aufhört, und denkt sich etwas Neues aus: Nach zwei oder drei Anläufen ist er dann traurig und schämt sich. Dann hat man wieder ein paar Tage Ruhe.“
Die Vergangenheit
Der Ich-Erzähler erinnert sich an den Tag nach Sophias Geburtstag vor zwei Jahren. Sie waren zu zehnt bei Peter gestrandet.
Es war heiß, Peters Speed-Spiegel kreiste, und wir lagen auf dem Boden verteilt und redeten fröhlichen Unsinn […]
Dichte, helle Rauchschwaden standen im Raum, und alle waren auf Mephedron. Ich weiß noch, dass der Ventilator zu jener Zeit kaputt war und alle bloß ihre Unterwäsche trugen. Nur Peter hatte noch ein verschwitztes Antifa-Shirt an, trank ein Weizen nach dem anderen und ergoss sich in Theorien darüber, ob Stalins Tod nicht vielleicht vorgetäuscht worden sei, schließlich hätte er ebenso gut einen seiner Doppelgänger aufbahren lassen können; er sei ein Fuchs gewesen.
Als es keinen Alkohol mehr gab, gingen Chaim und er noch einmal weg und kauften bei einem Späti ein paar Flaschen Sekt. Es war dumm, dass er Chaim auf der Straße flüchtig auf die Wange küsste. Sofort riefen „zwei schmächtige Jungs in Unterhemden, höchstens dreizehn, der eine hinten auf dem Gepäckträger, den Vorderen umklammernd“: „Schwuchteln! Yallah, da sind Homos!“ Daraufhin kam eine Bande junger Männer aus einer Querstraße angerannt, und die beiden Freunde schafften es im letzten Augenblick, sich hinter die Haustür zu retten.
Erst als Sophia meinte, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Nazis wie Chaim und ich sich in Neukölln nicht mehr sicher fühlten, konnte ich es nicht mehr zurückhalten und erbrach mich in einer großen Flut auf dem Dielenboden. Einige mussten lachen, Peter sah ausdruckslos in sein verschmiertes Weizenglas, und als Hatice aufstand, mich am Arm nahm und schrie, sie sollten sich alle schämen, war ich so verwundert über diesen schlagartigen Ausbruch, dass ich nicht wusste, wie mir geschah. Ja, Hatice schrie, weinte und zog mich aus dem Zimmer, zog mich durch den Flur, stieß ohne anzuklopfen Chaims Tür auf, zog ihn vom Bett – Wir gehen jetzt! – und rief noch im Hausflur ein Taxi.
Hatice war vor ihrer Familie aus Düsseldorf nach Berlin geflohen, weil sie kein Kopftuch tragen wollte. Nach dem Vorfall zog sie zu Chaim und dessen Freund in die Zwei-Zimmer-Wohnung am Nollendorfplatz. Eigentlich hatte sie Fotografin werden wollen, aber sie war an einer Supermarktkasse gelandet.
Hatice wählt mehrmals vergeblich die Nummer seines Handys. Als er endlich abnimmt, berichtet sie, dass jemand sie erkannt habe. Ihr jüngerer Bruder sei bei ihr aufgetaucht und habe ihr vorgeworfen, wie eine deutsche Hure zu leben. Die Familie wisse, dass sie mit einer „Schwuchtel“ zusammen sei und werde die Schande nicht hinnehmen. Hatice sagt, dass sie zu ihrer Freundin Lisa nach Friedenau geflohen sei und warnt ihn, weil ihr Bruder die Adresse am Nollendorfplatz kennt.
„Hey! Kannst du bitte irgendwas sagen? Deine Stimme fehlt mir so, und ich habe Angst, dass ich untertauchen muss – umziehen oder so. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich … so weit gehen würden. Wahrscheinlich nicht, oder? Oder?! Und du musst dir auch Gedanken machen, wie du jetzt weitermachst. Sie wissen von dir, und du solltest erst mal nicht zurück in die Wohnung. Es tut mir so leid! Weißt du schon, wie lange du noch in Frankreich bleibst? Hast du eine Idee, was wir tun können? Bitte sprich mit –“
Ich legte auf […]
Hatice rief mich nicht wieder an.
Wieder denkt der Ich-Erzähler an Chaim. Der verließ ihn, nachdem er ihn beim Küssen eines anderen Mannes beobachtet hatte.
Als ich später nach Hause kam, war Chaim bereits weg – ja, sogar seine Sachen hatte er schon mitgenommen. Ich sah ihn nicht wieder.
Das vibrierende Telefon nervt ihn. Er zieht es aus der Hosentasche, und ohne noch einmal aufs Display zu blicken, schleudert er es ins Meer.
Gédéon
Gédéon, der wie eine Katze auf allen Vieren herumschlich und miaute, wurde vom Nachbarn zusammengeschlagen.
„That son of a bitch called me dog. Dog, you understand? Dog … Merde! I was a cat. Tu comprends? That salopard want my house. But non. I don’t give up. You should seen son face, when I scratched him.“
„And now you aren’t a cat anymore?“, fragte ich tastend, ein widerliches Kratzen im Hals.
„Merde! Do I look like a fucking cat?“, schrie er.
Weil Gédéon der örtlichen Polizei misstraut, lässt er sich von Francesco nach Paris bringen, um den Nachbarn anzuzeigen. Der Ich-Erzähler fährt mit. Auf der Wache merkt Gédéon, dass er seine Papiere im Wagen liegen ließ.
„Give me the putains key, Francesco! J’ai oublié my fucking ID in the car.“
Francesco nestelt an seiner Bauchtasche. Das Kokain fällt heraus, „jede Menge Tütchen, kleine wie große, volle wie leere“. Die Polizistin, die das beobachtet, verdreht die Augen, unternimmt aber nichts weiter.
Weil sich die Alufolie als ungeeignet für die Installation erweist, kauft Francesco in mehreren Baumärkten die Lagerbestände an Spiegelfolie auf. Außerdem besorgt er ein Gerüst und zwei Baustrahler.
Die Baustrahler entdecken Francesco und sein Berliner Freund kurz darauf bei einem von Gédéon dirigierten Chor von Flüchtlingen.
„It is a matter to aid the humans. We should all help the humans. Un beau jour maybe they will help me with the hôtel. But first we will sing together. That will give them the ésperance back and then the power […].
Gédéon fuhr indes fort, erklärte uns, diese Menschen hätten eine furchtbare Flucht hinter sich. Er wisse zwar nicht, woher sie kämen, aber helfen müsse er ihnen allemal. Niemand dürfe sich dieser Pflicht entziehen – nein, auch wir nicht. Und außerdem würden sie sicher aus Dankbarkeit gut für ihn arbeiten, ja, womöglich könne er das Hotel noch Ende diesen Jahres eröffnen. Aber das würde er ihnen erst in ein paar Tagen oder Wochen erklären, also, dass sie für ihn arbeiten sollten. Nun ginge es erst einmal darum, ihr Vertrauen zu gewinnen.
Die Kunstinstallation
Francesco ist mit der Soundanlage und der Verspiegelung in der Kirche fast fertig. Er muss nur noch die Decke mit Folie auskleiden. Ein Höllengesang bricht los: „C-C-C-Cocaine! C-C-C-Cocaine!“ Unvermittelt rollt ein Ball herein, gefolgt von Gédéon, der sich jetzt wie ein Hund gebärdet.
Ich stand in der Kanzel und betrachtete das Spektakel. Francesco hatte sich seine Sonnenbrille aufgesetzt, saß auf seinem Turm, rauchte einen Joint und lachte, während sich Gédéon, angespornt vom eigenen Spiegelbild, in immer tollere Sprünge ergab, immer schneller und ausgelassener von Wand zu Wand lief, sich immer hastiger reckte und bog, sich warf und schmiss – die Marionette eines irren Gauklers.
Gédéon reißt versehentlich eine Bahn der Spiegelfolie herunter. Der seit Tagen gewachsene Abzess hinter Francescos Ohr platzt auf. Blutiger Eiter schießt hervor. Francesco verliert das Bewusstsein, liegt auf dem Gerüst, das sich wie eine Pappel biegt. Der Lokalreporter, der beabsichtigt, über die Vernissage zu berichten, schaut in die Kirche, hält den Ich-Erzähler für den Künstler und fragt ihn: „So, what is this project about?“
Ich überlegte, was Francesco jetzt wohl sagen würde […]
„Transcendence is no longer possible today. Transcendence is not even wanted anymore“, improvisierte ich. […]
For centuries Catholic churches where places that pointed beyond earthly existence.“ Ich schwitzte. „My artwork reflects on the narcissism of our time, our inability to think of anything other than ourselves.“
Da fällt Francescos Brille vom Gerüst, dem Reporter vor die Füße. Der zuckt zusammen, blickt nach oben, sieht den Kopf des Bewusstlosen, lässt Notizblock und Kamera fallen, schreit hemmungslos und flüchtet aus der Kirche. Durch das Gekreische kommt Francesco wieder zu sich.
Um sich vor Gédéon zu schützen, schieben Francesco und sein Freund das Retabel vor die gusseiserne Kirchentür. Gédéon wirft sich dagegen. Das Retabel wankt. Der goldene Bischof am linken Seitenflügel löst sich und fällt enthauptet zu Boden. Draußen singen Kinder: „Les Allemands bloquent le fou! Les Allemands bloquent le fou!“
Feuer
Francesco hat es plötzlich eilig. Er muss zum Flughafen Orly und Sophia abholen. Der Ich-Erzähler ist entsetzt, aber Francesco meint, er habe es längst angekündigt. Peter sei nicht bereit, Drogennachschub zu bringen. Sophia mache das und bleibe für zwei Tage.
„Du fickst sie.“
„Gottverdammt, ja!“ Unvermittelt hatte er zu schreien begonnen. „Ich ficke sie, ja – nein, sie fickt mich! Was dachtest denn du?“
Weil Francesco vor der Fahrt zum Flughafen noch duschen will, schiebt Gédéon das schmutzige Bettlaken in den Ofen, mit dem er bekleidet war:
„Francesco préfère warm water to cold. I make warm water for mon ami.“
Als Francesco das mitbekommt, schreit er:
„You crazy bastard! You’re gonna kill us all! Your house will explode!“
Gédéon rennt nackt davon. Francesco packt seinen vor Schreck erstarrten Berliner Freund und reißt ihn mit sich, um ihn vor dem Feuer zu retten.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Es geht um Liebeskummer, Verlorenheit und Identitätssuche. „Hinterher“ weist zugleich Züge einer Roadnovel und eines Entwicklungsromans auf.
Der schwule Ich-Erzähler wirft seinen Job als Barmann in Berlin hin und lässt sich von einem Bekannten, den er schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat, zu einer Reise in die Normandie überreden, wo Francesco eine Kirche bei einer Kunstaktion mit Spiegelfolie auskleiden will. Anders als der Künstler hat der Erzähler kein Ziel, nichts, was er anstrebt. Statt an eine Zukunftschance zu glauben, hängt er der Vergangenheit nach, in der er mit Chaim zusammen war. Aber der lebt seit zwei Jahren in Tel Aviv. Als ihn das Vibrieren des Telefons nervt, schleudert er es ins Meer.
Der exzessive Kokain-Konsum der Figuren zieht sich wie ein Running Gag durch „Hinterher“.
Finn Job (*1995) entwickelt die fantasievolle, mitreißende Geschichte mit überbordender Fabulierlaune konsequent aus der Sicht des Protagonisten, dessen Namen wir nicht erfahren. Wir erleben seine Reise in die Normandie mit und erfahren zwischendurch etwas über die unglückliche Vorgeschichte, der er verhaftet bleibt. Die überzogenen Figuren – allen voran der Franzose Gédéon – sind skurril, farbig und originell. „Du bist doch keine fuckin‘ Houellebecq-Figur, Boy“, meint Francesco im Gespräch mit dem Ich-Erzähler.
Finn Job spielt in seinem tragikomischen Debütroman „Hinterher“ virtuos mit verschiedenen Registern der Sprache, mischt englische und französische Sätze in die wörtliche Rede. Dabei wechseln er Tempi und Rhythmen. Zumindest passagenweise erreicht Finn Job mit seinem Furor ein kraftvolles poetisches Niveau.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2022
Textauszüge: © Verlag Klaus Wagenbach