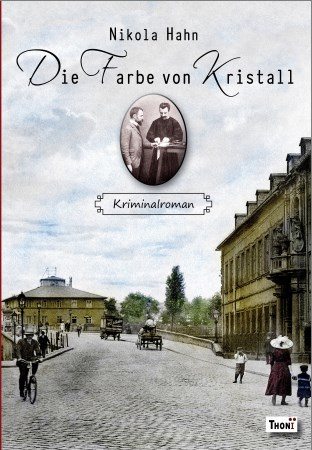Susanne Röckel : Der Vogelgott

Inhaltsangabe
Kritik
Prolog: Konrad Weyde in Z.
Es war, wie mir bald klar wurde, jene sagenhafte Gegend, von der ich bei den Großen meines Fachs schon so viel gelesen hatte. Während die ramponierte Lok in irgendein Depot geschleppt wurde, erhielt ich mehrere Angebote ortsansässiger Taxifahrer mit Schnauzbärten und schmutzigen Gummistiefeln, die wünschten, mich über die kurvigen und schlaglochreichen Bergstraßen zum nächsten Bahnhof zu fahren, doch nach einem Blick gen Himmel, der ungewöhnlich hell und rein zu werden versprach, beschloss ich, an Ort und Stelle zu bleiben und mir in dem Dorf Z., das mir gezeigt wurde – wie es unregelmäßig und schief zwischen den Felszacken hing, ähnelte es dem Brutplatz eines Wanderfalken –, eine Unterkunft zu suchen.
So beginnt ein fragmentarisches, unveröffentlichtes Manuskript des Lehrers und Hobby-Ornithologen Konrad Weyde mit dem Titel „Der Vogelgott“.
Keine 100 Kilometer von seinem Reiseziel entfernt – der Stadt B. – strandet er unterhalb des Dorfes Z. Mühsam schleppt er Rucksack und Koffer den Hang hinauf. Als man ihn vom Dorf aus längst gesehen haben muss, wundert er sich darüber, dass niemand kommt, um ihm zu helfen. Die Felder werden offenbar schon lange nicht mehr bestellt. Nach drei Stunden erreicht er das Dorf und fühlt sich zwar aus Fenstern beobachtet, aber keiner der Bewohner zeigt sich im Freien. Notgedrungen betritt Konrad Weyde ein heruntergekommenes Gebäude mit der Aufschrift „Hotel International“. Erst nach einiger Zeit taucht eine feindselig wirkende Frau auf.
Sie verstand kein Wort der heutigen bekannten Verkehrssprachen (die ich, wie ich mir schmeicheln darf, sämtlich fließend spreche), sodass unsere Unterhaltung auf Gesten beschränkt blieb. Ich begriff, dass es keine Zimmer und kein Essen gab und dass sie mich allerhöchstens für eine Nacht notdürftig unterbringen könne.
Nachdem Konrad Weyde sein Gepäck ins Zimmer gebracht hat, sucht er im Dorf nach etwas zu essen. Vergeblich.
Am nächsten Morgen stellt er fest, dass sein Rucksack mit der Ausrüstung – Spektiv, Leica, Bestimmungsbuch, Habichtfangkorb – gestohlen wurde.
Der Verlust der Ausrüstung war ein empfindlicher Schlag für mich. Mit meinem mageren Lehrergehalt hatte ich lange dafür sparen müssen; manches, was ich als Ehemann und Vater meiner Familie hätte zukommen lassen können, war in die teuren Utensilien geflossen – kurz: Dieser Rucksack war das Beste, was ich besaß.
Draußen tritt ein Mann an ihn heran und begrüßt ihn nicht nur akzentfrei in seiner Sprache, sondern sogar mit seinem Namen. Darüber hinaus weiß er, dass Konrad Weyde darauf aus ist, einen großen unbekannten Vogel zu fangen – und verbietet es ihm. Der Greif werde im Dorf wie eine Art Gott verehrt, erklärt er.
Konrad Weyde lässt sich jedoch von seinem Vorhaben nicht abbringen und wandert auf der Suche nach dem Horst des mächtigen Vogels weiter hinauf.
Thedor Weyde im Land der Aza
Von den drei Kindern des Lehrers Konrad Weyde ist Thedor das jüngste. Die lange, schließlich mit dem Tod endende Krankheit der Mutter motiviert ihn, ein Medizinstudium zu beginnen, das er allerdings nach kurzer Zeit abbricht, weil ihm beim Anblick nackter Leichen übel wird. Einige Zeit später stirbt auch der Vater.
Mit 30 befürchtet Thedor Weyde, alles im Leben verpasst zu haben.
Nach einer ziellosen Wanderung im Anschluss an einen Kneipenbesuch findet er sich am Stadtrand wieder, in der Gegend, in der er aufwuchs.
Sie hatte sich völlig verändert. Aus den Schotterstraßen mit den ärmlichen Einfamilienhäusern und großen Gärten, die an Wiesen und Äcker, Hügel und Wälder grenzten, war ein dicht bebautes modernes Wohnviertel geworden […].
Die Kirche St. Michael, in der er, sein Bruder und seine Schwester getauft wurden, steht noch. Thedor geht hinein und stellt fest, dass sich im Inneren kaum etwas verändert hat.
Da war der Altar, dort die Nische mit dem großformatigen Gemälde Tobias und der Engel von Wolmuth; an der gegenüberliegenden Wand ein weiterer Wolmuth-Engel, die Posaune blasend, die den Anbruch der Endzeit verkündet, und über seinem Kopf das flatternde Schriftband mit den Worten REX COELESTIS DEUS PATER OMNIPOTENS.
Als er gehen möchte, sind die Türen verschlossen. Nur eine unauffällige Pforte lässt sich öffnen. Draußen erblickt er einen kleinen Laden, in dem es Bastelbücher, Stifte und Süßigkeiten zu kaufen gab, als er noch ein Kind war. Hinter der Theke stand eine stets schwarz gekleidete steinalte Frau, die gar nicht zu verbergen versuchte, dass sie Kinder nicht ausstehen konnte. Bei ihr einkaufen galt als Mutprobe. Den Laden gibt es nicht mehr; im Schaufenster hängt nun eine Abbildung des Posaunenengels aus St. Michael und ein Werbeplakat mit dem Buchstaben STW. Daneben steht: „DU bist gefragt!“. Thedor Weyde tritt ein und trifft auf einen Mann, der in einer völlig fremden Sprache telefoniert. Nachdem er das Gespräch beendet hat, wendet er sich Thedor Weyde zu, nennt ihn beim Vornamen und verhält sich, als ob er ihn erwartet hätte. „Vic Tally“, stellt er sich vor.
Er schien mich besser zu kennen, als ich mich selbst kannte, und mir etwas zuzutrauen, wovor ich immer zurückgeschreckt war. Er forderte mich heraus; er machte etwas aus mir; ich spürte, wie mir neue Energie zuströmte. […]
Es ging um einen Feldzug, ein Werk, eine weltumspannende Aktion. Ich sollte, ich würde daran teilnehmen. Ja, Vic sprach von einer bereits feststehenden Tatsache, nicht von einem Wunsch oder einer Forderung. Er wusste so gut über mich Bescheid, dass ich den Eindruck hatte, er spreche Gedanken aus, die ich selbst schon oft in unklarer Form gehabt hatte […]. Meine ermattete Seele blähte sich auf wie ein schmutziges Segel im Wind.
Am Ende unterschreibt Thedor Weyde einen Vertrag, mit dem er sich verpflichtet, ein Jahr lang für STW in Kiw-Aza zu arbeiten. Erst als er zu Hause googelt, findet er heraus, dass STW die Abkürzung für „Save the World“ ist, eine von dem Unternehmer Henry Morton zur Förderung des Volks der Aza gegründete Organisation.
Am Ankunftsort des Flugzeugs wartet Thedor Weyde tagelang vergeblich darauf, abgeholt zu werden. Schließlich fährt er mit dem Bus zur Station von Kiw-Aza und meldet sich dort zum Dienst.
Ich korrespondierte mit Stiftungen, Krankenhäusern, karitativen Einrichtungen; ich war zuständig für die Aufrechterhaltung der Verbindung der Station mit der übrigen Welt. Dabei wusste ich natürlich – im Lauf der Zeit wurde es mir immer klarer –, dass all diese Dinge mit der Wirklichkeit nichts zu tun hatten. Es war eine säuberlich geordnete, aus Zahlen, Kürzeln, Floskeln bestehende rein virtuelle Welt.
Nachts hörte ich manchmal das Quietschen der Torflügel; es gab erstickte Schreie, geflüsterte Wortwechsel und hastiges Getrappel von Schritten. Ich öffnete die Tür meiner Wohnung einen Spalt und spähte hinaus. In der finsteren Nacht irrlichterten Taschenlampen und Feuerzeuge umher, und ich sah, dass kranke oder verwundete Männer über den Hof geschleppt und von den herbeieilenden Nurses in Obhut genommen wurden. Diese Männer wurden offenbar im Hospital versorgt.
Beim Besuch eines kleinen Friedhofs fällt Thedor Weyde auf, dass die dort Bestatteten allesamt 1916 starben und englische Namen trugen. Gab es einen Überfall auf Missionare? Er findet Briefe eines Mannes namens Lazarus Pickford über einen als Erneuerer des alten Glaubens verehrten einheimischen Feldherrn – Civtaly alias Chief Aly -, von dem es heißt, er sei zu Beginn des Jahrhunderts in der britischen Armee ausgebildet worden und habe später ohne Rücksicht auf Verluste gegen die englische Schutzgruppe in seinem Land gekämpft.
Bereits bei der Ankunft hörte Thedor Weyde von als „Recelesti“ bezeichneten Rebellenhorden im Land der Aza, die an einen obskuren Vogelgott glauben und ihre eigenen Landsleute bekriegen.
Auf der Station taucht eine junge Frau aus Colorado Springs auf. Im Alter von zwei Jahren kam Miranda Morton zu Pflegeeltern. Seit Monaten sucht sie nun nach ihrem Vater, von dem sie annimmt, dass er früher in Kiw-Aza war.
Ein auf dem Hof der Station von Abfällen lebendes Rudel wilder Hunde, das auf Thedor Weyde zu hören scheint, fällt Miranda an. Der ehemalige Medizinstudent verhindert, dass das Mädchen zerfleischt wird, versorgt die Bisswunde an der linken Wade und stiehlt ein Medikament gegen Tollwut, um Miranda impfen zu können.
Einige Zeit später schreibt Thedor Weyde von sich aus in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses seiner Heimatstadt einen Bericht über seine albtraumartigen Erlebnisse in Aza. Aber es fällt ihm schwer, zwischen tatsächlichen und eingebildeten Erlebnissen zu unterscheiden.
[…] selbst der gute Dr. Andrae weiß, dass die bequeme Teilung der Welt in Wirklichkeit und Wahn nicht aufgeht. Ich kann mir selbst nicht mehr trauen. Was ist geschehen? Wer bin ich? Was habe ich getan?
Die Ärzte mögen glauben, was sie wollen, aber wenigstens sollen mein Bruder und meine Schwester – die Einzigen, die noch an meinem Leben Anteil nehmen – erfahren, wie es wirklich war.
Unmittelbar vor der geplanten Feier des Unabhängigkeitstages muss in der Station von Kiw-Aza etwas Schlimmes geschehen sein. Thedor Weyde wurde wohl mit einem UN-Hubschrauber ausgeflogen.
Am Ende richteten sich die Blicke auf mich. Was wusste ich von dieser Nacht, was hatte ich mit Mirandas Verschwinden zu tun? Ich konnte diese Fragen nicht beantworten. Die Frauen, die von den Engländern vernommen worden waren, gaben zu Protokoll, dass wirklich ein Überfall der Recelesti stattgefunden habe und dass Miranda entführt worden sei.
Thedor Weyde glaubt, er habe sich zu Fuß auf den zwölf Stunden weiten Weg nach Aza-Town gemacht, aber die Orientierung verloren und sei auf eine Gruft mit einem von einer Vogelstatue gekrönten Altar gestoßen. REX COELESTIS PATER OMNIPOTENS stand da. Auf dem Altar lag ein Menschenopfer, an dessen Fleisch die versammelte Gemeinde kaute. Auf dem zerfetzten T-Shirt las Thedor: „Colorado Springs“. Er rannte sogleich davon – und im Freien glaubte er, fliegen zu können.
Ich bewegte die Arme, die mich mühelos in der Luft hielten.
Der UN-Soldat, der ihn zu einem Hubschrauber hinaufzog, konnte ihn kaum bändigen.
Man hat mir berichtet, dass die Station Kiw-Aza nach der Nacht, in der Miranda Morton verschwand, von britischen Sondereinsatzkräften besetzt wurde. Bis auf eine Handvoll Frauen waren alle Baracken leer. Die Frauen wurden in ihre Dörfer zurückgeschickt, und das umliegende Gebiet diesseits des Flusses wurde durchkämmt. Man fand aber weder eine Höhle noch einen Baum, wie ich ihn beschrieben hatte, oder sonst etwas Verdächtiges. Auch Vic Tally und die Organisation STW hatten sich offenbar in Luft aufgelöst.
Dora Weyde und die „Madonna mit der Walderdbeere“
Thedors jüngere Schwester Dora Weyde studiert mit einem Stipendium in London, als der Vater stirbt, übernimmt sie jedoch die Aufgabe, die Hinterlassenschaften des Lehrers und Ornithologen zu ordnen und die Stadtwohnung zu verkaufen, in die er zuletzt gezogen war. Das Elternhaus hat man inzwischen abgerissen.
Eine große Wohnsiedlung war entstanden, mit einem sechsstöckigen Parkhaus und einem neuen S-Bahnhof.
Die Kapelle im Gyrental, zu der ihre damals bereits kranke Mutter des Öfteren einen Spaziergang mit ihr unternommen hatte, steht noch. Dora lässt sich von dem im Nachbarhaus einsam wohnenden Geistlichen namens Szymon aufschließen und betrachtet das Altarbild. Auf einem Schild steht:
Die Madonna mit der Walderdbeere, Kopie von unbekannter Hand eines verschollenen Gemäldes von Johannes Wolmuth (1601 – 1656)
Von Doras Interesse angenehm überrascht, erzählt Szymon, er habe sich als junger Theologe mit dem Phänomen antichristlicher Kulte beschäftigt und vermute aufgrund von Funden, dass die Kapelle Versammlungsraum einer frühneuzeitlichen Sekte war, die ihrem Gott blutige Opfer brachte.
Am Ende des Sommers fliegt Dora zwar wie geplant nach London, aber nur, um ihren Haushalt aufzulösen. Sie zieht zurück in ihre Heimatstadt, zu einem Mann namens Hans, der gerade Juniorprofessor geworden ist und ihr dabei hilft, Professor Bartolo als Doktorvater zu gewinnen. Dora hat sich nämlich vorgenommen, über das Gemälde in der Kapelle zu promovieren. Ihre These lautet, dass es sich bei dem sichtbaren Bild um eine Übermalung handelt.
Durch gute Beziehungen erreicht Professor Bartolo, dass es einer eingehenden restauratorischen Analyse unterzogen wird. Dabei bestätigt sich Doras Annahme: Die Walderdbeeren-Madonna wurde über ein ähnliches, fertig ausgearbeitetes und nur wenig älteres Bild gemalt. Überraschend ist, dass das ursprüngliche Gemälde künstlerisch wertvoller war als das neuere. Außerdem wurden kostbarere Farben verwendet.
Zweifellos hing früher ein Marienbild von Johannes Wolmuth in St. Michael, einer der Hauptkirchen der Stadt, die bei einem Großfeuer im Jahr 1651 niederbrannte. Dora hält es für möglich, dass das Gemälde damals gerettet und in die Kapelle im Gyrental gebracht wurde. Sie kommt zu der Überzeugung, dass es sich sowohl beim übermalten als auch beim jetzt sichtbaren Gemälde um Werke von Johannes Wolmuth handelt. Aber warum wollte er, dass man das ursprüngliche Bild nicht mehr sehen konnte, warum benutzte er billigere Farben und warum verwandte er weniger künstlerische Sorgfalt darauf?
Dora reist nach Paris, Brünn, New York und Eau Vive, um andere Gemälde und Zeichnungen von Johannes Wolmuth zu studieren. Während sich Dora im Studienzentrum der Sammlung Fetterman in Eau Vive aufhält, gibt der Direktor Victor Lalyt bekannt, dass Professor Thaddé Fetterman bei einem Unfall ums Leben gekommen sei und „der weltbekannte Fabrikant und Philanthrop Henry Morton“ den Vorsitz im Kuratorium übernommen habe. (Doras Bruder Lorenz googelt später und findet heraus, dass der Leiter der Sammlung Fetterman in Eau Vive nicht Victor Lalyt, sondern Dr. Alain Lafitte heißt.)
Ein bei der Rückkehr in der Bahnhofsapotheke besorgter Schwangerschaftstest bestätigt Doras Befürchtung. Als sie von der Abtreibung nach Hause kommt, ist Hans – der bald nach dem Kennenlernen ihr Ehemann geworden war – ausgezogen. Zuletzt hatten sie sich immer heftiger und häufiger gestritten, zum einen, weil sie sich nicht an der Wohnungsmiete beteiligte, aber auch, weil Hans kein Verständnis für ihre Besessenheit aufbrachte, das Geheimnis der Walderdbeeren-Madonna zu ergründen.
Dora stößt auf eine Mariensage und kommt zu dem Schluss, dass Wolmuth sie auf dem ursprünglichen Gemälde dargestellt habe.
Natürlich, Johannes Wolmuth hatte eine Totenmadonna gemalt. Seine junge, blonde Maria-Persephone kommt auf die Erde, um die Walderdbeeren zu pflücken, die die Kinder im Jenseits erfreuen sollen. Die Gestalten neben und hinter der undeutlichen Frauengestalt auf den Infrarotaufnahmen der Restauratoren waren keineswegs nur harmlose Putten – wie Professor Bartolo vermutet hatte –, es mussten die toten Kinder sein, die sich zeigen, wenn die Himmelskönigin auf die Erde herabsteigt. Und auch das Jesuskind auf ihrem Schoß – dieser so sonderbar starr und puppenhaft wirkende kleine Knabe mit den liebevoll gezeichneten hellen Locken, den feinen Händchen und zarten Füßchen – gehörte in Wahrheit zur Schar der Abgeschiedenen, die sich nach der lange vermissten irdischen Speise sehnen.
Dora wollte ursprünglich nicht Kunsthistorikerin, sondern Künstlerin werden, verwarf den Traum jedoch nach einer Absage der Akademie. Jetzt malt sie in dem ungeheizten Atelier, in das sie aus Kostengründen umgezogen ist, mehrere Tage lang in rauschhafter Begeisterung. Unvermittelt taucht ein Mann auf – V. Littal, Kunsthandel –, packt die Bilder sorgfältig in eine Mappe und legt ihr ein Bündel großer Geldscheine auf den farbverkrusteten Gartentisch.
Inzwischen glaubt Dora, zu wissen, was während des Dreißigjährigen Kriegs im Gyrental geschah, und sie schildert es ihrem längst ungeduldig gewordenen Doktorvater in einer Mail.
Eines Tages war ein Trupp Söldner gekommen, ebenfalls ausgehungert, zerlumpt, verroht und zu allem bereit. Sie hatten die letzten Vorräte geplündert, die Häuser in Brand gesteckt, die Männer mit Piken und Dreschflegeln niedergemacht, die Frauen zusammengetrieben und vergewaltigt. Die Kinder waren im Wald gewesen, um Holz zu sammeln.
Die Kinder versteckten sich in der Kapelle, die dann allerdings von den Landsknechten gestürmt wurde. Das Gemetzel zog Geier aus dem Gebirge an.
Als sie sich aus hoch aufgetürmten schwarzen Wolken im Schein der blutroten Abendsonne über dem Dorf zeigten, mussten sie die Wirkung eines Himmelszeichens haben, vor dem sich die Menschen dieser Zeit wie vor nichts anderem ängstigten. Ihr Anblick schlug die Mörder in die Flucht. Die Dorfbewohner aber warfen sich vor ihnen nieder. Hunger und Verzweiflung hatten ihren Verstand ausgelaugt. Sie sahen, wie die bewaffneten Angreifer erschrocken Reißaus nahmen. Sie sahen, was ihre Seelen und ihre Phantasie seit Langem beschäftigte. Es konnten keine Vögel, es mussten Engel sein, von denen sie gerettet worden waren, mächtige wundertätige Wesen mit Krallen statt Händen, die das Fleisch der Erschlagenen fraßen.
Johannes Wolmuth, der selbst zu einem Anhänger des neuen Kults geworden war, malte seine 1636 gestorbene Frau mit den toten Kindern für St. Michael. 1651 setzten die Sektierer ihre Stadt in Brand, aber das Gemälde wurde gerettet. Wolmuth übermalte es mit einer frommen Allerweltsmaria mit dem Jesuskind, weil er die Erinnerung nicht mehr ertrug.
Dora fährt mit der S-Bahn ins Gyrental und setzt sich auf eine Bank am Ufer des rauschenden Kanals.
Die Türklinke an der Seitenpforte der Kapelle ist eiskalt.
Ein widerwärtiger Geruch schlug mir entgegen, den ich zuerst nicht identifizieren konnte. Ich sah an mir herunter – ich trug sonderbare, grobe, ausgeblichene Kleidungsstücke. Ich hatte blondes Haar. Ich war die schattenhafte Gestalt, die die Röntgenstrahlen der Restauratoren zum Vorschein gebracht hatten, die junge Frau, die sich hinter der Madonna mit der Walderdbeere versteckt […].
Bevor sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnten, spürte ich die Blicke der Unsichtbaren, die den Altar umstanden, hörte ihre erregten und angsterfüllten Atemzüge. An der Stirnseite das große, runde offene Fenster. »O ihr Engel … ihr Herrlichen … o unsere Retter …«, lautete das fiebrige Gemurmel, das Gebet, mit dem sie ihren grausigen Gott anlockten. Hier also endete die Suche nach meinem Kind, vor diesem schrecklichen Altar. Ein weißes Tuch lag darüber, mit drei roten Tropfen befleckt. Mein Kind. Das Blut meines Kindes, das mir entrissen worden war.Das Hupen eines Autos brachte mich zurück auf meine Bank am Kanal. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber ihre Wärme war schon spürbar, und eine Prozession leuchtend roter Wolken zog über den grauen Himmel. Auf der schattigen Erde wanderte ein Junge mit einem Einkaufstrolley von Haus zu Haus und steckte Reklameprospekte in die Briefkästen. Ich ging zum Kapellchen. Wieder einmal fiel mir auf, wie fein und präzise die Feldsteine gemauert waren und wie genau der große Oculus in die östliche Fassade eingepasst war. Die Steine fühlten sich rau und kühl an. Die Pforte war verschlossen.
Lorenz Weyde: Kinderträume
Weil der Vater sich weigerte, die Journalistenschule zu bezahlen, musste Lorenz Weyde Nachhilfeunterricht geben, Zeitungen austragen und nachts Pakete in einer Lagerhalle am Güterbahnhof schleppen, um sein Studium zu finanzieren. Außerdem half er seinem jüngeren Bruder Thedor bei den Hausaufgaben.
Die Krankheit meiner Mutter und der Geiz meines Vaters hatten mich dazu gezwungen, früh mit dem Arbeiten zu beginnen.
Als der Vater stirbt, hat Thedor sein Medizinstudium bereits abgebrochen. Dora kommt aus England, kümmert sich um die Beerdigung und die Auflösung der Wohnung. Erst bei der Testamentseröffnung erfährt Lorenz vom Notar, dass der Vater seine von Motten zerfressene Vogelsammlung – darunter ein Furcht einflößender Greif aus Z. – verbrannt hat.
Lorenz Weyde und seine als Lehrerin tätige Frau Marta haben zwei Söhne: Philip und Tom. Seit der ersten großen Entlassungswelle beim Tagblatt arbeitet er nur noch freiberuflich als Journalist und verdient so wenig, dass er ohne Marta nicht einmal die Miete bezahlen könnte.
Ich tat nichts und ging den Problemen aus dem Weg, während sie unablässig anpackte, schuftete und uns alle über Wasser hielt.
Als die Familie drei Wochen Sommerferien in einer Pension verbringt, fühlt sich Lorenz von einer der sechs oder sieben osteuropäischen Frauen angezogen, die für die Bedienung der Gäste und Reinigung der Räume zuständig sind. Sie heißt Clara. Weil sie unnahbar bleibt, steckt Lorenz den beiden anderen Frauen, die sich mit ihr eine Dachkammer teilen, etwas Geld zu. Am vorletzten Tag des Aufenthalts lassen ihn Ana und Veronica ein und bieten ihm einen der beiden Stühle an. Auf dem anderen sitzt Clara. Lorenz gibt vor, sie für eine Reportage befragen zu wollen, aber sie schüttelt den Kopf. Unvermittelt sagt Ana: „Sie müssen jetzt gehen.“ Und Veronica fügt hinzu: „Sofort.“ In der Tür flüstert Ana ihm zu: „Sie hat den Teufel gesehen. Er war bei Ihnen, ganz nah. Sie sagt, Sie müssen aufpassen.“
Am nächsten Morgen findet Lorenz eine große weißliche Feder auf dem Fensterbrett. Vor der Abreise zeigt er sie einigen vogelkundigen Einheimischen. Sie stamme aus der Armschwinge eines Raubvogels, meinen sie. Aber solche Vögel seien schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Gegend heimisch.
Zurück am Wohnort, erhält Lorenz Weyde einen Anruf des Tagblatt-Redakteurs Matthisen. In einem fast ausschließlich von Migranten bewohnten Randbezirk wurde ein fünfjähriger Junge von einem Auto erfasst und getötet. Darüber soll der Freiberufler einen Artikel schreiben.
Obwohl die beiden Schwestern des toten Jungen allein zu Hause sind, als Lorenz klingelt, lassen sie ihn in die Wohnung. Die Mädchen erzählen, dass ihr Bruder Amadou unentwegt Vögel gemalt habe. Sie vermuten, dass ihn ein Flugzeug erschreckte, er sich deshalb von der Mutter losriss und bei Rot auf die Straße rannte.
Lorenz ist überzeugt, dass sich hinter dem tödlichen Unfall ein größeres Geheimnis verbirgt, aber Matthisen will davon nichts wissen.
Bei seinen dennoch begonnenen Recherchen stößt Lorenz auf den Namen eines Arztes namens Torvyk Allt, der Kinder behandelt haben soll, die von merkwürdigen Albträumen heimgesucht wurden und auch tagsüber die Stimmen von Raubvögeln nachzuahmen versuchten.
Dass ich nirgends eine Adresse oder Telefonnummer von ihm finden konnte, führte ich auf eine fehlerhafte Schreibweise seines Namens zurück. Ein „Prof. Dr. V. Y. Callt“ hatte in einem fünf Jahre alten Interview, das ich im Archiv des Tagblatts fand, verkündet, dass die Zahl der Depressionen und Angsterkrankungen im Kindesalter auf besorgniserregende Weise ansteige, und zu einem frühzeitigen Check-up im Klinikum geraten. Doch weder „Allt“ noch „Callt“ ergaben weitere Treffer.
Weil die Symptome jeweils nach einem Gesundheitscheck im Städtischen Klinikum auftraten, fährt Lorenz mit der Straßenbahn hin. Der Gebäudekomplex, in dem die Familie Morton im 19. Jahrhundert eine pharmazeutische Fabrik betrieben hatte, hieß früher Mortonsche Heilanstalt. Lorenz wundert sich über den widerwärtigen Geruch. Unvermittelt wird er mit seinem Namen angesprochen. „Allt“, stellt sich sein Gegenüber vor.
Er sprach von einem Medikament – so viel begriff ich –, dessen Entwicklung er, im Dienst der Firma Morton stehend, leitete. Ein Mittel, das die Unvollkommenheit unseres Gehirns überwinde und dazu führe, dass endlich das ganze Potential des Individuums ausgeschöpft werden könne. So naiv sei die Wissenschaft heute nicht mehr – fuhr er dann ungefähr fort –, dass sie sich einbilde, ewige Jugend erschaffen zu können. Doch die Krankheit, die dem heutigen Menschen am meisten zu schaffen mache, könne ausgerottet werden wie einst die Pest.
Unerwartet erhält Lorenz doch wieder einen Auftrag des Redakteurs Matthisen. Ein älterer Beamter des Passamtes mit Namen Petri meldete sich beim Tagblatt und raunte davon, dass junge Männer von einer obskuren Organisation angeworben würden und das Land verließen, angeblich, um sich für Kinder oder Kranke zu engagieren. (Als Leserinnen und Leser wissen wir, dass er auch Thedor Weydes Papiere für den Auslandseinsatz stempelte.)
Lorenz spricht mit dem Mann. Der berichtet ihm, sein Onkel Christian Petri sei in den frühen Fünfzigerjahren mit seiner Familie nach Afrika ausgewandert und habe mit einigen Engländern gemeinsam in Kiw-Aza eine Missionsstation aufgebaut, die 1952 überfallen worden sei. Das geschah, als der im Ersten Weltkrieg von der britischen Armee rekrutierte Schamanen-Sohn Id Civaly oder Y’lavid – dessen Namen die Engländer zu „Chief Ali“ verballhornten – sein Volk in einem blutigen Krieg von der Kolonialherrschaft befreite. Christian Petri kämpfte offenbar an der Seite der als Vogelmänner verkleideten Aufständischen gegen die Briten.
Nach dem Besuch teilt Lorenz seinem Redakteur mit, der alte Mann wolle sich nur wichtig machen. An der Geschichte sei nichts dran.
Bald darauf probt Marta mit der Theater-AG das Stück „Der Triumph des Prometheus“, das ein früherer Schüler des Gymnasiums namens Heinrich Morton in einem inzwischen aufgegebenen Kleinverlag veröffentlicht hatte. Der Autor, der mehrmals die Schule wechseln musste und das Abitur nicht schaffte, litt unter schweren Depressionen. Nach einer kaufmännischen Ausbildung schickte ihn sein Vater auf Reisen. Henry Morton, wie er sich schließlich nannte, soll bei seiner weltweiten Suche nach pharmazeutischen Substanzen in Afrika einem obskuren Zauberpriester begegnet sein. Jedenfalls haben er und sein medizinischer Berater Torvyk Allt mit dem von ihnen geführten Pharmaunternehmen die Heimatstadt reich gemacht. Seine Tochter Miranda schickte er als Kleinkind zu ihm unbekannten Pflegeeltern in Amerika. Er gründete die Hilfsorganisation „Save the World“. Inzwischen hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Spekulationen zufolge wird sein Pharmaunternehmen demnächst ein Wundermittel auf den Markt bringen.
Bei einem weiteren Besuch im Städtischen Klinikum begegnet Lorenz nach dem Verlassen des Lifts einem Mann, der sich auf einen Rollator stützt und dessen Anzug am hageren Leib schlottert. Lorenz erkennt ihn als Henry Morton, doch obwohl dieser allenfalls ein paar Jahre älter ist als er, wirkt er wie ein Greis. Lorenz schaut sich die an Stellwänden ausgestellten Kritzeleien an, die denen ähnelt, die er von dem verunglückten Jungen Amadou kennt. Verwundert liest er die Signatur Dora Weyde.
Frühmorgens weckt Lorenz seine Frau und bittet sie, ihm zuzuhören.
Ich erzählte ihr von meiner ungeheuerlichen Entdeckung. Ich sagte ihr, welches Geschäft Morton betrieb, dass er behauptete, ein Wundermedikament zu entwickeln, aber in Wahrheit etwas ganz anderes tat, dass er Kinder betäubte und willenlos machte und ihre Gehirne anzapfte, um sich von ihrer Kraft zu nähren, dass er im Dienst eines Vogels stand, der das von ihm verlangte, dass dieser schreckliche und gefräßige Vogel, der viele Namen hatte, aber immer derselbe war, uns alle bedrohte, dass ich es sah und spürte, dass man es überall sehen und spüren konnte, wenn man nur aufmerksam genug war, überall diese Ermattung und Entkräftung, dieses unaufhaltsame heimliche Dahinsiechen, auch wenn auf den ersten Blick alles seinen gewohnten Gang ging, die Leute in ihren Büros saßen, in Geschäfte gingen und Dinge kauften und sich abends beim Essen unterhielten und zu wissen glaubten, wer vor ihnen saß …
Lange Zeit hört Marta nur zu. Dann konstatiert sie: „Du bist krank.“ Sie macht einen Arzt ausfindig, der Lorenz behandeln soll.
Es war schrecklich für mich, zu sehen, wie resolut, fast munter sie das »Problem« anpackte. Sie machte mir keine Vorwürfe, lamentierte nicht, nörgelte nicht, verlangte nichts von mir. Eine Zeitlang gelang es mir, sie zu täuschen. Ich behauptete, beim Arzt gewesen zu sein, Tabletten zu nehmen. Ich verhielt mich still, zog mich zurück. Dann kam sie mir auf die Schliche.
Lorenz läuft fort und lebt als Obdachloser in dunklen Winkeln der Stadt.
Das Schwerste war, den Behörden zu entkommen, den Polizisten, Therapeuten, Sozialarbeitern, die ihre fürsorglichen Krakenarme nach mir ausstreckten.
Es ist Clara, die ihn findet.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Susanne Röckel lässt in „Der Vogelgott“ vier Ich-Erzähler zu Wort kommen. Den Anfang macht der Lehrer Konrad Weyde, der Vögel jagt und ausstopft. Eine klare Zeitangabe gibt es nicht, aber es heißt, er habe als Erster im Lehrerkollegium ein Fernsehgerät angeschafft. Das lässt auf die frühen Fünfzigerjahre schließen. In den drei anderen Kapiteln lesen wir Berichte der Tochter und der beiden Söhne. Die Kunsthistorikerin Dora gerät in den Bann eines Marienbildes aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und glaubt schließlich, darin das Zeugnis eines Massakers und eines antichristlichen Kults mit Menschenopfern zu erkennen. Thedor bricht sein Medizinstudium ab, lässt sich von einer vermeintlichen Hilfsorganisation anwerben und stößt irgendwo in Afrika auf die Anhänger eines Schamanen-Sohnes, der sein Volk mit als Vogelmännern verkleideten Kämpfern in einem blutigen Krieg von der britischen Kolonialmacht befreit. Lorenz, der Älteste, geht als erfolgloser Lokalreporter dem Verdacht nach, dass ein vermeintlich wohltätiger Pharmaunternehmer an einem Wundermittel arbeitet und dabei über Kinderleichen geht.
Was davon real und was Wahn ist, lässt sich nicht ausmachen. Susanne Röckel spielt in „Der Vogelgott“ mit verwischten Grenzen zwischen Realität und Aberglaube, Einbildung und Wirklichkeit. Rätsel und Irritationen, Unklarheiten und Leerstellen gehören zum Programm dieses ungewöhnlichen, an Franz Kafka und das Genre der Schauerromantik erinnernden Romans.
Mit stupender erzählerischer Kraft erschafft Susanne Röckel in „Der Vogelgott“ eine bildhafte Parallelwelt.
Der Roman kam auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2018, und Susanne Röckel wurde dafür mit dem Tukan-Preis der Landeshauptstadt München 2018 ausgezeichnet.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2018
Textauszüge: © Jung und Jung