Patrick Süskind : Die Geschichte von Herrn Sommer
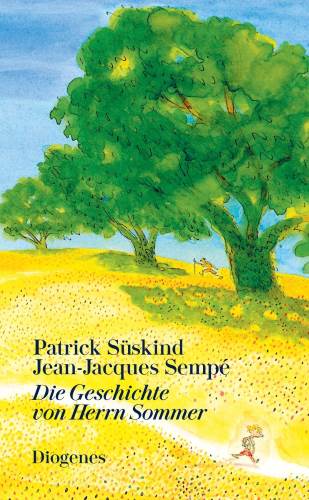
Inhaltsangabe
Kritik
Der Erzähler geht auf die Fünfzig zu. Aus seiner Schulzeit möchte er uns die „Geschichte von Herrn Sommer“ erzählen und setzt an: „Zu der Zeit, als ich noch auf Bäume kletterte …“ Doch er schweift gleich ab und erinnert sich an andere Dinge, zum Beispiel, wie er einmal von einer Weißtanne stürzte. Für eine Spätfolge jenes Unfalls hält er „eine gewisse Konfusion und Unkonzentriertheit“, an der er „neuerdings“ leidet. „So fällt es mir beispielsweise immer schwerer, beim Thema zu bleiben, einen bestimmten Gedanken kurz und knapp zu formuieren, und wenn ich eine Geschichte wie diese erzähle, dann muss ich höllisch aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere, sonst komme ich vom Hundertsten ins Tausendste und weiß zum Schluss nicht mehr, womit ich überhaupt angefangen habe.“
Auf Seite 16 hebt er zum dritten Mal an: „Zu der Zeit, als ich noch auf Bäume kletterte …“. Und nach einer weiteren kurzen Abschweifung beginnt er mit der „Geschichte von Herrn Sommer“. Aber da gibt es eigentlich gar keine Geschichte. Herr und Frau Sommer kamen irgendwann in das Dorf Unternsee. Sie wohnten im Souterrain des Hauses von Malermeister Stanglmeier, hatten keine Kinder und bekamen niemals Besuch. Seither wanderte Herr Sommer jeden Tag 12 bis 16 Stunden eilig herum, mit einem Nussbaumstock und einem Rucksack für ein Butterbrot und eine Gummipelerine. Einmal, bei einem fürchterlichen Hagel-Unwetter, sahen ihn der Erzähler, dessen Bruder, Schwester und Eltern vom Auto aus. Der Vater bot Herrn Sommer an, ihn mitzunehmen. Zuerst reagierte Herr Sommer nicht, doch als der Vater des Erzählers die Beifahrertür öffnete und den durchnässten Wanderer wiederholt aufforderte, einzusteigen, rammte dieser seinen Stock gegen den Boden und sagte flehentlich: „Ja so lasst mich doch endlich in Frieden!“ – Niemand wusste, von was er umgetrieben wurde. Er besorgte nichts. Die erforderlichen Einkäufe erledigte seine Frau, die zu Hause Stoffpuppen anfertigte und einmal pro Woche ein Paket davon zum Postamt brachte.
So ist die „Geschichte von Herrn Sommer“ mehr eine Geschichte aus der Schulzeit des Erzählers, oder eigentlich ist es auch nicht eine Geschichte, sondern es handelt sich um eine Reihe von Begebenheiten, an die sich der Erzähler erinnert.
Da ist zum Beispiel seine Mitschülerin Carolina Kückelmann, die er immer wieder heimlich ansieht, weil sie ihm so gut gefällt. Aber nach dem Unterricht geht sie mit den anderen Klassenkameraden nach Oberndorf, während er als einziger in Unterndorf wohnt. Nur einmal, da kündigt sie an, ihn nach Unterndorf zu begleiten, weil sie dort eine Freundin ihrer Mutter besuchen wolle. Der Erzähler malt sich aus, was er ihr auf dem Weg alles zeigen wird: ein summendes Transformatorenhäuschen, einen Ameisenhaufen und andere Sehenswürdigkeiten. Zum Schluss würde er mit ihr auf eine wunderbare alte Buche klettern. – Aber an dem besagten Tag kommt Carolina Kückelmann doch nicht mit, denn die Freundin ihrer Mutter ist krank geworden.
Nachdem er gelernt hat, auf dem Rad das Gleichgewicht zu halten, fährt er regelmäßig zu Fräulein Funkel, einer ältlichen und unausstehlichen Klavierlehrerin. Hier ist ein kleiner Textauszug:
„Und jetzt werden wir noch zehn Minuten Diabelli spielen, damit du endlich Noten lesen lernst. Wehe, du machst einen Fehler!“
Ich nickte ergeben und wischte mir mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht. Diabelli, das war ein freundlicher Komponist. Das war kein solcher Fugenschinder wie dieser grauenhafte Häßler. Diabelli war einfach zu spielen, bis zur Einfältigkeit einfach, und klang dabei doch immer sehr famos. Ich liebte Diabelli, auch wenn meine Schwester manchmal sagte: „Wer gar nicht Klavier spielen kann, der kann immer noch Diabelli spielen.“
Wir spielten also Diabelli vierhändig, Fräulein Funkel links im Bass orgelnd und ich mit beiden Händen unisono rechts im Diskant. Eine Weile lang ging das recht flott dahin, ich fühlte mich in zunehmendem Maße sicher, dankte dem lieben Gott, dass er den Komponisten Anton Diabelli geschaffen hatte, und vergaß schließlich in meiner Erleichterung, dass die kleine Sonatine in G-Dur notiert und also am Anfang mit einem Fis vorgezeichnet gewesen war; dies bedeutete, dass man sich auf Dauer nicht nur auf den weißen Tasten bequem dahinbewegen konnte, sondern an bestimmten Stellen, ohne weitere Vorwarnung im Notentext, eine schwarze Taste anzuschlagen hatte, eben jenes Fis, welches sich gleich unterhalb des G befand. Als nun zum ersten Mal das Fis in meinem Part erschien, erkannte ich es nicht als solches, tappte prompt daneben und spielte stattdessen F, was, wie jeder Musikfreund sofort begreifen wird, einen unerfreulichen Missklang ergab.
„Typisch!“ fauchte Fräulein Funkel und brach ab. „Typisch! Bei der ersten kleinen Schwierigkeit haut der Herr gleich daneben! Hast du keine Augen im Kopf? Fis! Da steht es groß und deutlich! Merk’s dir! Noch mal von vorn! Eins-zwei- drei-vier …“
Wie es dazu kam, dass ich beim zweiten Mal den gleichen Fehler wieder machte, ist mir noch heute nicht ganz erklärlich. Vermutlich war ich so sehr darauf bedacht, ihn nicht zu machen, dass ich hinter jeder Note ein Fis witterte, am liebsten von Anfang an nur lauter Fis gespielt hätte, mich regelrecht zwingen musste, Fis nicht zu spielen, noch nicht Fis, noch nicht … bis … – ja, bis ich eben an der bewussten Stelle abermals F statt Fis spielte.
Sie wurde mit einem Schlag knallrot im Gesicht und kreischte los: „Ja ist das denn die Möglichkeit! Fis hab‘ ich gesagt, zum Donnerwetter! Fis! Weißt du nicht, was ein Fis ist, du Holzkopf? Da!“ – peng-peng – und sie klatschte mit ihrem Zeigefinger, dessen Spitze vom jahrezehntelangen Klavierunterricht schon so breitgeklopft war wie ein Zehnpfennigstück, auf die schwarze Taste unterhalb des G – „… Das ist ein Fis! …“ – peng-peng – „… Das ist … -“ Und an dieser Stelle musste sie niesen. Nieste, wischte sich rasch mit dem erwähnten Zeigefinger über den Schnurrbart und hieb anschließend noch zwei-, dreimal auf die Taste, laut kreischend: „Das ist ein Fis, das ist ein Fis …!“ Dann zog sie ihr Taschentuch aus der Manschette und schneuzte sich.
Ich aber starrte auf das Fis und erbleichte. Am vorderen Ende der Taste klebte eine ungefähr fingernagellange, beinahe bleistiftdicke, wurmhaft gekrümmte, grüngelblich schillernde Portion schleimig frischen Rotzpopels, offenbar stammend aus der Nase von Fräulein Funkel, von wo sie durch das Niesen auf den Schnurrbart, vom Schnurrbart durch die Wischbewegung auf den Zeigefinger und vom Zeigefinger auf das Fis gelangt war.
„Noch mal von vorne!“ knurrte es neben mir. „Eins-zwei-drei-vier …“ – und wir begannen zu spielen.
Die folgenden dreißig Sekunden zählten zu den entsetzlichsten meines Lebens. Ich spürte, wie mir das Blut aus den Wangen wich und der Angstschweiß in den Nacken stieg. Die Haare sträubten sich mir auf dem Kopfe, meine Ohren wurden abwechselnd heiß und kalt und schließlich taub, als seien sie verstopft, ich hörte kaum noch etwas von der lieblichen Melodie des Anton Diabelli, die ich selber wie mechanisch spielte, ohne Blick aufs Notenheft, die Finger taten’s nach der zweiten Wiederholung von alleine – ich starrte nur mit Riesenaugen auf die schlanke schwarze Taste unterhalb des G, auf der Marie-Luise FunkeIs Rotzeballen klebte … noch sieben Takte, noch sechs … es war unmöglich, die Taste zu drücken, ohne mitten in den Schleim hineinzutappen … noch fünf Takte, noch vier … wenn ich aber nicht hineintappte und zum dritten Mal das F statt des Fis spielte, dann … noch drei Takte – o lieber Gott, mach ein Wunder! Sag etwas! Tu etwas! Reiß die Erde auf! Zertrümmere das Klavier! Lass die Zeit rückwärts gehen, damit ich nicht dies Fis spielen muss! … noch zwei Takte, noch einer … und der liebe Gott schwieg und tat nichts, und der letzte fürchterliche Takt war da, er bestand – ich weiß es noch genau – aus sechs Achteln, die vom D herunter bis zum Fis liefen und in einer Viertelnote auf dem darüberliegenden G mündeten … wie in den Orkus taumelten meine Finger diese Achteltreppe hinunter, D-C-H-A-G … – „Fis jetzt!“, schrie es neben mir … und ich, im klarsten Bewusstsein dessen, was ich tat, mit vollkommener Todesverachtung, spielte F.
Nach diesem Schock will er sich auf dem Heimweg das Leben nehmen. Er klettert auf eine Rotfichte, aber als er gerade einen geeigneten Ast gefunden hat, von dem aus er sich in die Tiefe stürzen kann, eilt Herr Sommer herbei und verzehrt genau unter ihm sein Butterbrot. Danach hat der Bub keine Lust mehr, zu springen. Die Absicht, sich wegen der Klavierlehrerin umzubringen, kommt ihm plötzlich lächerlich vor.
Aber das Leben ist nicht einfach: „Ständig musste man, sollte man, sollte man nicht, hätte man besser doch … immer wurde irgend etwas von einem erwartet, verlangt, gefordert: mach dies! mach das! aber vergiss nicht jenes! hast du schon dies erledigt? bist du schon dort gewesen? warum kommst du erst jetzt? … – immer Druck, immer Bedrängnis, immer Zeitnot, immer die vorgehaltene Uhr. Man wurde selten in Ruhe gelassen, damals …“
Fünf oder sechs Jahre später starb Frau Sommer. Niemand nahm davon Notiz. Herr Sommer zog ein paar Häuser weiter in eine Dachkammer beim Fischer Riedl. Oft kam er tagelang nicht nach Hause.
Eines Tages, als der Erzähler seine herausgesprungene Fahrradkette auf das Zahnrad zurückgezerrt hatte und die schmutzigen Hände an ein paar Blättern abwischte, beobachtete er, wie Herr Sommer in den See ging. Schritt für Schritt ging er immer weiter ins Wasser, bis nur noch sein Strohhut auf der Oberfläche schwamm. Erst nach zwei Wochen bemerkte man sein Verschwinden. „Und zwar fiel es als erster der Frau des Fischers Riedl auf, die sich Sorgen um die monatliche Mietzahlung für ihre Dachkammer machte.“ Der Erzähler aber schwieg. „Ich weiß nicht, was mich so beharrlich und so lange schweigen ließ …, aber ich glaube, es war nicht Angst oder Schuld oder ein schlechtes Gewissen. Es war die Erinnerung an jenes Stöhnen im Wald, an jene zitternden Lippen im Regen, an jenen flehenden Satz: „Ja so lasst mich doch endlich in Frieden!“
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)„Die Geschichte von Herrn Sommer“ ist eine wunderliche Geschichte. Patrick Süskind (* 26. März 1949) hat sie in einem Plauderton geschrieben, als ob er sie gerade jemand erzählen würde. Da denkt man an „Der kleine Prinz“, und auch hier liegen Schmerz und Komik ganz nah beisammen. „Die Geschichte von Herrn Sommer“ ist ein kleines Meisterwerk der Erzählkunst.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2002
Textauszüge: © Diogenes Verlag
Patrick Süskind: Der Kontrabass
Patrick Süskind: Das Parfum
Patrick Süskind: Die Taube
Patrick Süskind und Helmut Dietl: Kir Royal (Drehbuch)
Patrick Süskind und Helmut Dietl: Rossini (Drehbuch)
Patrick Süskind und Helmut Dietl: Vom Suchen und Finden der Liebe (Drehbuch)



















