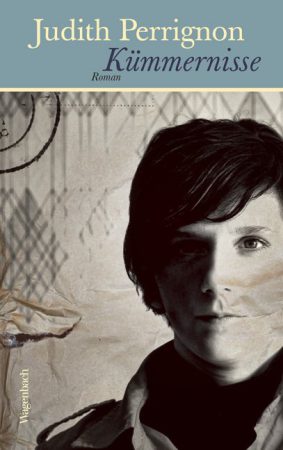Orhan Pamuk : Die weiße Festung
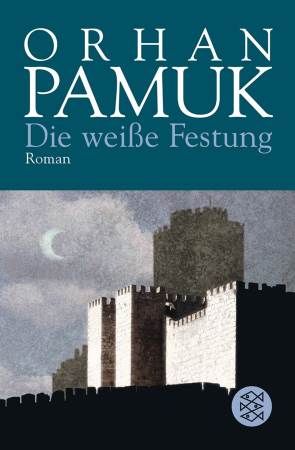
Inhaltsangabe
Kritik
Einem Studenten in der türkischen Provinz fällt 1982 ein jahrhundertealtes Manuskript in die Hände. Als er den Text durchsieht, fallen ihm zwar historische Ungereimtheiten auf, da ihn die Handlung an sich aber interessiert, transkribiert er die Vorlage. Der historische Rahmen der Geschichte ist Mitte des 17. Jahrhunderts in der Zeit als Sultan Mehmet IV. herrschte.
„Von Venedig nach Neapel ging unsere Fahrt, als wir von türkischen Schiffen aufgebracht wurden“ (Seite 15), schreibt der Ich-Erzähler, und dass er als Gefangener dem Sultan in Istanbul übergeben wurde. Bei dem Berichterstatter handelt es sich um einen Dreiundzwanzigjährigen, der in Florenz und Venedig Wissenschaft und Kunst studierte, in Astronomie, Mathematik, Physik und Malerei bewandert ist und auch etwas von Medizin versteht.
[In der Geschichte erfahren wir den Namen des Erzählers nicht, weshalb er hier mit dem Ersatznamen „Namenlos“ auftreten soll.]
Als der Pascha – das ist ein hoher Verwaltungsbeamter – von den Kenntnissen des Gefangenen erfährt, bestellt er ihn in seine Residenz ein. Während dieser auf den Pascha wartet, tritt ein Mann ein, der dem Namenlosen verblüffend ähnlich sieht. Der etwa fünf Jahre Ältere ist der Hodscha, also ein Gelehrter, dem eine Ähnlichkeit mit seinem Gegenüber allerdings nicht aufzufallen scheint. Der Pascha beauftragt seinen Berater, den Hodscha, zusammen mit dem Namenlosen ein Feuerwerk von bisher nicht gekannter Großartigkeit vorzubereiten. Dieses Schauspiel soll der Höhepunkt einer vom Hof auszurichtenden Hochzeit werden.
Trotz gegenseitiger Verachtung – der Hodscha wirft dem Fremden zum Beispiel vor, immer noch kein Moslem geworden zu sein – gelingt es ihnen, ein gigantisches Feuerwerk zu präsentieren. Der Pascha ist mit der Darbietung sehr zufrieden.
Der Namenlose wird nun auch vom Pascha mehrmals hinsichtlich eines Glaubenswechsels angesprochen und unter Druck gesetzt. An den Händen gefesselt und mit einem Beil bedroht, ringt er mit sich, eine Entscheidung zu treffen – aber da steht ihm ein Bild vor Augen, das ihn davon abhält, von seinem Glauben abzulassen.
[…] der Blick aus dem Fenster unseres Hauses auf den Garten dahinter: auf einem Tisch ein perlmuttverziertes Tablett mit Kirschen und Pfirsichen, hinter dem Tisch eine Ruhebank aus Rohrgeflecht, auf der Federkissen im grünen Farbton des Fensterrahmens ausgelegt waren, und weiter hinten ein Brunnen, auf dessen Rand ein Sperling saß, unter Oliven- und Kirschbäumen. Dabei bewegte sich ganz leise in einem fast unmerklichen Lüftchen eine Schaukel, die mit langem Strick am hohen Ast eines Walnussbaumes festgebunden war. (Seite 38)
Der Pascha respektiert einerseits die Entscheidung des Gefangenen, selbst unter Androhung des Todes bei seinem Glauben geblieben zu sein, andererseits wirft er ihm seinen Starrsinn vor, der bestraft werden sollte. Da er jedoch jemandem ein Versprechen gab, bewahrt er den Unbeugsamen von weiterem Übel: Der Pascha wird ihn dem Hodscha schenken, dessen Sklave er sein wird.
Im Haus des Hodschas ist bereits eine Kammer für ihn hergerichtet. Dem Gelehrten ist hauptsächlich daran gelegen, möglichst viel von dem Wissen seines Mitbewohners vermittelt zu bekommen und die Denkweise der abendländischen Kultur verstehen zu lernen. Auch lässt er sich die häuslichen Bräuche und Alltagsgewohnheiten in Italien beschreiben.
Vor allem fesseln den Gelehrten aber Sterne und Planeten, und da der Namenlose sich mit Astronomie auskennt und technisch begabt ist, tüfteln sie ein „Sternhimmelsmodell“ mit einem komplizierten Zahnradmechanismus aus. Der Pascha, dem sie ihre Konstruktion demonstrieren, ist damit nicht sehr zu beeindrucken. Überdies vermutet er, dass die Idee nicht vom Hodscha, sondern von dem jungen Mann stammt.
Der Hodscha hält den Pascha genauso für einen Toren, wie er auch alle „Anderen“ für töricht hält. Wie kommt es, fragt er sich, dass „diese“ in „ihren Köpfen keinen Raum zum Bewahren des Wissens haben“. Das treibt den Schriftgelehrten sein Leben lang um. Er möchte zu gern, dass es ihm gelänge, in „das Innere eines Menschen zu sehen“.
Die zwei Männer haben es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Tag Episoden aus ihrem früheren Leben niederzuschreiben und ihre Erfahrungen und Gedankengänge darzulegen. Ihre Aufzeichnungen tauschen sie gegenseitig aus und erfahren voneinander nach nunmehr zehn Jahren des Zusammenseins die persönlichen Umstände ihrer Herkunft.
Mittlerweile hat sich Hass bei unserem Berichterstatter aufgestaut, denn eigentlich fühlt er sich seinem „Herrn“ überlegen, und außerdem ist er der Ansicht, dass es an der Zeit wäre, freigelassen zu werden. In seinem Groll ersinnt er Wege, wie er den Hodscha dazu bringen könnte. Seine Heimkehr wird jedoch ohnehin verhindert: In der Stadt bricht die Pest aus.
Monatelang wagen sie sich wegen der Ansteckungsgefahr nicht aus dem Haus und sind gezwungenermaßen noch enger aneinander gebunden als vorher. Als der Hodscha an seinem Körper eine rote Schwellung entdeckt, zeigt er sie seinem Mitbewohner, der sie als Insektenstich herunterspielt. So schnell lässt er sich jedoch nicht beruhigen, sondern forscht seinerseits bei seinem Gefährten nach etwaigen Hautveränderungen – und er zwingt ihn, sich mit ihm vor einen Spiegel zu stellen.
Ich tat’s und erkannte einmal mehr […], wie sehr wir uns ähnlich waren. Als ich den Hodscha zum erstenmal gesehen hatte, […] war ich, wie mir einfiel, in gleicher Weise überwältigt gewesen. Damals sah ich jemanden, der ich hätte sein müssen, nun aber meinte ich, er müsse auch jemand wie ich sein. Demnach wären wir beide eins. Jetzt schien das eine ganz selbstverständliche Wahrheit zu sein. Ich war wie gefesselt, stand wie gelähmt. Um mich zu befreien, um begreifen zu können, dass ich noch ich selbst war, machte ich eine Bewegung und fuhr mir rasch mit der Hand durch das Haar. Doch er tat das gleiche […] (Seite 110)
Als der Hodscha dann auch noch seinen Blick imitiert, die Haltung seines Kopfes und seine entsetzte Miene nachahmt, kann der Namenlose seinen Anblick im Spiegel nicht mehr ertragen. Der Hodscha hingegen amüsiert sich über seine Parodie und triumphiert:
Wir würden gemeinsam sterben! schrie er. Wie unsinnig, musste ich denken, fürchtete mich aber zugleich. Dies war die schrecklichste der Nächte, die ich mit ihm zusammen erlebte. (Seite 110)
Die Situation in der Abgeschlossenheit empfindet der junge Mann immer klaustrophobischer, und er will weglaufen. Mit erspartem und dem Hodscha gestohlenen Geld kann er einen Bootsmann zum Übersetzen auf eine Insel bezahlen. Bei einer griechischen Familie findet er Unterschlupf und nach einiger Zeit erwägt er seine Flucht in sein Heimatland. Der Hodscha sei bestimmt schon tot, an der Pest gestorben, redet er sich ein, und nichts sonst halte ihn zurück.
Und dann steht eines Tages der Hodscha vor ihm. Der wusste längst, dass sein Gefährte auf die Insel geflohen war. Nun will er ihn zurückholen – er braucht nämlich seine Hilfe. Als Berater des Sultans soll er eine Statistik ausarbeiten, mit dem das Ende der Pest prognostiziert werden kann und sich eine Methode ausdenken, die eine weitere Verbreitung der Seuche verhindert. Sein Scharfsinn werde dafür nicht reichen, meint der Hodscha, aber:
„Weissagen ist Narrheit, doch gut dafür, den Toren zu imponieren!“ (Seite 120)
Sie klügeln ein sogenanntes Kalendarium aus, dem sich angeblich ein vorhersehbares Ende der Epidemie entnehmen lässt. Außerdem hat sich zum Beispiel durch Einführung von Passagierscheinen für Fremde die Zahl der Pestkranken reduziert. Der Sultan ist jedenfalls zufrieden mit der Ausführung seines Auftrags und ernennt den Hodscha zum obersten Sterndeuter, wohingegen er den Beitrag des Namenlosen nicht einmal erwähnt.
Der Hodscha kann den Sultan mit einer neuen Idee begeistern:
Hatte das Leben der Ungläubigen außer der Tatsache ihres Unglaubens überhaupt etwas Wissenswertes zu bieten? Konnte man eine Waffe bauen, mit der wir sie nach Belieben vor uns herzutreiben vermochten? (Seite 133)
Sogleich zeichnet der Sultan die Skizze einer Waffe mit langen Rohren und selbstauslösenden Zündmechanismen, wie er sich das vorstellt. Die zwei Männer befassen sich dann jahrelang mit nichts anderem, als sich dieses Kriegsgerät auszudenken. Die Pläne sind längst gezeichnet, bis sich der Sultan entschließen kann, den Befehl zum Bau des „unglaublichen Geschützes“ zu erteilen. Nach mehreren Jahren können sie dem Herrscher die Maschine endlich vorführen. Obwohl der Sultan mit seinem Heer nach Polen zieht, nimmt er die Waffe nicht mit. So wird immerhin Zeit gewonnen, um Leute zum Bedienen des komplizierten Mechanismus zu finden.
Niemand mochte sich in das Innere dieses so schrecklich anzuschauenden Vehikels von ungewisser Wirkung begeben. […] Die meisten, die ihre Furcht überwanden und sich in den eisernen Hügel hineinwagten, um das Räderwerk anzuwerfen, hielten der Enge und Hitze des bizarren Insektes nicht stand und liefen wieder fort. (Seite 165)
Endlich soll die Waffe nach Edirne zum Sultan geschafft werden. Auf dem zehn Tage währenden Zug dorthin stehen sich der Hodscha und sein Gefährte so nahe wie schon lange nicht mehr. Vor allem der Hodscha ist hocherfreut, wie die Neugierigen in den Dörfern die Hälse nach der Maschine recken.
Unsere als Monstrum, Käfer, Teufel, wehrhafte Schildkröte, laufender Turm, Riesentölpel, Eisenhaufen, rollender Kessel, Gigant, Zyklop, Ungeheuer, finsterer Kerl bezeichnete Waffe, deren Anblick […] bei jedermann Entsetzen auslöste, machte sich mit seltsam fürchterlichem Knirschen und Lärmen schwerfällig auf den Weg […]. (Seite 168ff)
In Edirne ergeht der Befehl zu einem erneuten Vorstoß nach Polen, obwohl die Jahreszeit für einen Krieg eigentlich zu weit fortgeschritten ist. Während des Feldzugs reitet der Sultan immer wieder zu Jagdausflügen aus, bei denen sein Gefolge, und allen voran der Hodscha, mit der Landbevölkerung Kontakt sucht. Seine schon immer bestehende Besessenheit „in das Innere der Köpfe“ der Menschen sehen zu wollen, veranlasst ihn, Dorfbewohner – sowohl christliche als auch moslimische – zu befragen. Zum Beispiel:
Welches war die größte Sünde, die schlimmste Übeltat, die er im Leben begangen hatte? (Seite 176)
Die slawischen Bauern in den Karpaten verstehen meistens die Frage nicht richtig und selbst mit einem Dolmetscher ist die Verständigung schwierig, sodass sie irgendwelche Antworten stammeln, die den Hodscha jedoch nicht zufriedenstellen. Von Dorf zu Dorf werden seine Verhöre aufdringlicher und rücksichtsloser. Das geht soweit, dass er die Dorfbewohner schlägt, und diese falsche Geständnisse ablegen und Nachbarn denunzieren. Diese inquisitorische Befragung nimmt erst ein Ende als das Heer in Polen einfällt.
Es hat tagelang geregnet und die Wege sind aufgeweicht, sodass der Tross nur langsam vorwärts kommt. Der Hodscha ist erkältet, verzweifelt und erschöpft. Als dann das Kriegsgerät im Schlamm versinkt, schwindet bei allen die Zuversicht. Es spricht sich herum, dass es bei den Kämpfen Verletzte und Tote gab und die geplante Einnahme der Festung Doppio nicht gelang. Der Sultan zögert noch mit dem Befehl für den Einsatz der Waffe.
Doppio ist immer noch nicht eingenommen, eine andere kleine Befestigung ebenfalls nicht, was einem Kommandanten den Kopf kostete. Es herrscht allgemeine Konfusion und hinter vorgehaltener Hand wird die Tauglichkeit der Waffe und der Erfolg des Kriegszugs insgesamt bezweifelt.
Der Einsatz der Kriegsmaschine ist nun beschlossen. Zwar werden gleich beim ersten Angriff unbedarfte Hilfskräfte von der Maschine erdrückt, zerstückelt oder erschlagen; der Vormarsch wird dennoch fortgesetzt. Weitere Nachrichten über Rückschläge in der Kriegsführung treffen ein – dann sehen sie zum ersten Mal die Festung.
Sie lag auf einem steilen Hügel, die sinkende Sonne warf eine zartschimmernde Röte auf die wimpelbesetzten Türme, doch sie war weiß, strahlend weiß und wunderschön. Mir kam der Gedanke, etwas so Schönes und Unerreichbares könne man eigentlich nur im Traum sehen. (Seite 190)
Allerdings sind alle die Festung umgebenden Flächen und Hügel morastig und deshalb mit dem wuchtigen Kriegsgerät nicht zu überwinden. Unser namenloser Berichterstatter begreift, dass die Soldaten die weiße Festung niemals erreichen würden, und er ist sich sicher, dass der Hodscha genauso denkt.
Wenn wir morgen früh zum Angriff übergingen, würde die Waffe im Sumpf versinken, mitsamt der dem sicheren Tode preisgegebenen Männer drinnen und draußen, und später würde man fordern, dass den Soldaten mein Kopf vor die Füße rollte, um sie und die Furcht und das Gerede vom Unheil zu besänftigen, und ich wusste sehr wohl, dass auch der Hodscha all dies voraussah. (Seite 191)
Der Hodscha kommt lange nicht zurück vom Zelt des Sultans, und der Namenlose vermutet schon, man habe ihn gleich an Ort und Stelle hingerichtet und sie würden den Henker dann auch zu ihm schicken. Es könnte aber auch sein, überlegt er, dass sich der Hodscha heimlich, ohne ihn zu benachrichtigen, zu der Festung aufgemacht hatte. Am Morgen kommt der Hodscha. Er gibt keine Erklärungen und scheint es eilig zu haben. Der Namenlose nutzt die Morgenstunden, um – wie vor langer Zeit schon einmal – detailreich und ausführlich zu schildern, was und wen er in seiner Heimat zurückließ. Warum hinterläßt er dem Hodscha nochmals die Niederschrift?
Gegen Morgen meinte ich, diese Geschichten hätten mich wohl deshalb betört, weil ich annahm, sie könnten sich schließlich doch einmal an der Stelle fortsetzen, wo sie unterbrochen worden waren. Ich wusste, dass der Hodscha das gleiche dachte und meiner Geschichte mit Freuden glaubte. (Seite 193)
Die Männer wechseln die Kleider; der Namenlose schenkt dem Hodscha einen Ring und ein Medaillon mit dem Bildnis seiner Großmutter. Der Hodscha verschwindet allmählich im Nebel.
Es begann hell zu werden, ich war todmüde, schlüpfte in sein Bett und fiel in friedlichen Schlaf. (Seite 193)
Was wurde aus dem Namenlosen? Es kursierten Gerüchte: Er sei von einem Pascha in Kairo aufgenommen worden, um dort Entwürfe für eine Waffe zu ersinnen. Bei der Niederlage vor Wien sei er in der Stadt gewesen und habe den Feind beraten. Als Bettler verkleidet habe er in Edirne einen Mann erstochen und sei dann verschwunden. Als Imam war er womöglich tätig. In Spanien habe er mit dem Verfassen von Büchern viel Geld verdient. Aber auch in Anatolien und in Dörfern der Slawen soll er gesehen worden sein. Die höfischen Intrigen, die den Sultan um den Thron brachten, werden ihm zugeschrieben. – Der Hodscha hatte von all dem nie etwas geglaubt.
„Mein Buch nähert sich dem Ende“, sagt der Ich-Erzähler im letzten Kapitel. Er hatte die vor Jahren verfassten Seiten schon weggepackt, aber durch die Aussage eines Besuchers wurde er dazu verleitet, daran weiterzuschreiben – weil er nun wusste, dass es das liebste aller seiner Bücher ist.
Im nächsten Absatz sieht sich der verblüffte Leser mit dem Hodscha als Erzähler konfrontiert, der sich, wie wir erfahren, in die türkische Provinz zurückgezogen hatte. Als oberster Sterndeuter verdiente er viel Geld, heiratete und ist Vater von vier Kindern. Jetzt, als Siebzigjähriger, denkt er gerne an ihn, „um ein passendes Ende für meine Geschichte, für mein Leben zu finden“.
Eigentlich wollte er sich mit dem Lebensabschnitt, den er mit ihm verbrachte, nicht mehr befassen, weil er bei Gesprächen mit dem Sultan erfuhr, dass dieser von Anfang an wusste, dass alle ihm ausgehändigten Bücher, Kalender, Entwürfe etc. von ihm verfasst gewesen waren, und er hatte ihm das auch gesagt. Der Sultan war ihm also überlegen, das muss der Hodscha zugeben. Dem Herrscher ist er überdies zu Dank verpflichtet, denn nach der Niederlage im Sumpf hatte er ihn vor dem Wüten der Soldaten gerettet. Als der Sultan dann aber von ihm verlangte, die Einzelheiten der von ihm beschriebenen Geschichten in seinem Buch festzuhalten, als sei es seine eigenen Erlebnisse, wollte er sich nicht darauf einlassen und zog sich deshalb aufs Land zurück.
Einmal kehrt ein alter Mann im Haus des Hodschas ein. Evliya widmete sein ganzes Leben dem Reisen. In zehn Bänden hat er über seine Fahrten berichtet. Allerdings gibt es eine Lücke in seinem Buch. Er habe keine Kenntnisse über Italien, gesteht der Besucher, ob der Hodscha ihm dieses Land beschreiben könnte? Hatte er nicht früher einen Sklaven von dort besessen, der ihm darüber berichtete? Obwohl der Hodscha nie in Italien war, was er dem Fremden auch sagt, fabuliert er seltsame Geschichten über Städte, die auf einer italienischen Landkarte eingezeichnet sind. Für den nächsten Tag verspricht er Evliya eine Überraschung: „Eine Geschichte, die ihm sicher gefallen würde, von zwei Menschen, die ihr Leben vertauschten.“
In jener Nacht ersinnt der Hodscha die Geschichte, an deren Ende wir Leser jetzt gelangt sind und die er Evliya zu lesen gibt.
Was ich erzählte, schien nichts Erfundenes, sondern wirklich Erlebtes zu sein, es war, als ob mir ein anderer all diese Worte behutsam zuflüstern würde, und bedächtig reihten die Sätze sich aneinander: „Von Venedig nach Neapel ging unsere Fahrt als wir von türkischen Schiffen aufgebracht wurden…“ (Seite 205)
Obwohl ihm die Geschichte gefalle, sagt der Fremde, habe er doch einige Einwände. Wir müssten nach dem Wundersamen, dem Erstaunlichen, draußen in der Welt suchen, nicht in uns selbst. Das lange, tiefgründige Nachdenken über uns selbst mache uns unglücklich. Das sei auch den Menschen in der Geschichte so ergangen, und deshalb konnten sie ihr eigenes Selbst nicht ertragen und wollten ein anderer sein. Außerdem würde „das ständige Suchen des Merkwürdigen in uns selbst zu jemand anders werden“. (Seite 206)
Um noch einmal in seiner Erinnerung zu schwelgen, darüber was den Hodscha mit ihm verband, nimmt er sich sein Buch vor, „das Buch meines Schattens“, wie er es nennt, und das vielleicht Jahrhunderte später einen neugierigen Leser finden wird. Weil er überzeugt davon ist, dass jeder sich von Neuem erträumen muss, was ihm an Leben und Träumen verloren ging, glaubt er an seine Geschichte.
Er schließt das Buch mit der Beschreibung jenes Tages, an dem folgendes geschah:
Ein Reiter kommt auf sein Haus zu. Der Fremde mit Umhang und Schirm spricht schlecht Türkisch – mit den gleichen Fehlern, die auch er machte –, wechselt aber dann ins Italienische. Von ihm habe er erfahren, wie er heiße, verrät er dem alten Mann. Nach seiner Heimkehr beschrieb er in einer Anzahl von Büchern seine unglaublichen Abenteuer unter den Türken, hielt Vorlesungen darüber und wurde dabei reich. Er schreibe nun ein Buch, das den Titel „Ein Türke, der mir gut bekannt“ erhalten solle. Daraus habe er auch schon einige Einzelheiten über ihn erfahren, prahlt er. Von seinem Bekannten wisse er, dass er ein großer Freund der Türken sei. Minuten später behauptet er genau das Gegenteil: Er habe alle möglichen hässliche Sachen über die Türken geschrieben. Das kann der Hodscha nicht glauben: Er wollte sie doch retten! Und deswegen, entgegnet der Besucher, habe er ja sogar eine Waffe gebaut. Er sei aber nicht verstanden worden, und das Vehikel im Morast versunken. Wenn er sie auch retten wollte, heißt das aber keineswegs, dass er frei von Bösem sei. „So seien sie nun einmal, die genial Begabten!“ Wie kann es sein, fragt er den Hodscha noch, dass zwei Menschen, die jahrzehntelang einander nahestanden, sich so wenig glichen. Und womit der alte Mann seine Mußestunden verbringe, wollte er wissen.
Daraufhin zeigt der Hodscha dem Fremden sein Buch, das er sechzehn Jahre nicht mehr anrührte. Dieser ist sehr daran interessiert, da es doch von ihm handelt, auch wenn es ihm Mühe macht, das Türkische zu entziffern. Der Hodscha lässt ihn mit der Lektüre allein und beobachtet ihn vom Garten aus. Den Zuruf des Lesenden, der Verfasser habe offensichtlich nie italienischen Boden betreten, beachtet er nicht weiter. Nach drei Stunden hat er das Buch zu Ende gelesen und wohl alles verstanden, aber seiner Miene nach zu schließen, ist er ratlos. Mit leerem Blickes sieht er in die Ferne, um dann – wie es der Hodscha erwartete – sein Augenmerk darauf zu richten, was der Rahmen des Fensters umschließt.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Nein, sicherlich haben meine klugen Leser verstanden – so töricht, wie ich angenommen hatte, war er nicht. Begierig begann er, die Seiten des Buches umzuschlagen, er suchte, wie ich’s vorausgesehen, und ich wartete wohlgelaunt, bis er’s fand und las – was auch letztlich geschah. Noch einmal schaute er dann aus dem Fenster in den Garten auf das, was der Blick ihm darbot. Und ich wusste natürlich, was er zu sehen bekam: auf einem Tisch ein perlmuttverziertes Tablett mit Kirschen und Pfirsichen, hinter dem Tisch eine Ruhebank aus Rohrgeflecht, auf der Federkissen im gleichen grünen Farbton ausgelegt waren; dort saß ich, nunmehr fast siebzig Jahre alt; und weiter hinten ein Brunnen, auf dessen Rand ein Sperling saß, unter Oliven- und Kirschbäumen. Dabei bewegte sich ganz leise in einem fast unmerklichen Lüftchen eine Schaukel, die mit langem Strick am hohen Ast eines Walnussbaumes festgebunden war. (Seite 215)
Vordergründig handelt der Roman „Die weiße Festung“ von zwei Männern aus unterschiedlichen Kulturkreisen und verschiedenen Religionen. Einen jungen gebildeten Mann aus Italien verschlägt es durch widrige Umstände nach Istanbul, wo er gefangen gehalten und dann an den Hodscha verkauft wird. Herr und Sklave (die sich im übrigen äußerlich ähnlich sind) ersinnen zusammen alle möglichen Konstruktionen und tauschen sowohl ihr Wissen als auch ihre Gedanken aus. Was die Geschichte dann reizvoll macht, ist einerseits der Konflikt der beiden Charaktere miteinander und andererseits, wie nicht mehr auseinanderzuhalten ist, wer Herr und wer Knecht ist. Mit unvermuteten Wendungen gelingt Orhan Pamuk in „Die weiße Festung“ eine facettenreiche Illustration von Persönlichkeitsspaltung und Widerspiegelung im Anderen. Wie in einem Vexierbild muss herausgefunden werden, wer nun wer ist. Das ist eine Interpretation. Man kann aber auch unterstellen, dass es sich überhaupt nur um eine Person handelt, die auf der Suche nach ihrem Ego verschiedene Stadien der Selbstfindung durchlebt. Die parabelhafte Darstellung ist durch die ausschweifende Erzählweise in der Art eines orientalischen Märchens unterhaltsam und originell. Orhan Pamuk, der sich selbst zwischen zwei Kulturkreisen bewegt – seine familiären Bindungen wurzeln in Istanbul, wohingegen seine Lebenweise weitgehend nach westlichen Kriterien ausgerichtet ist – setzt sich mit dieser Ambivalenz in einer für den Leser ungewohnten Form bildhaft auseinander.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Irene Wunderlich 2008
Textauszüge: © Carl Hanser Verlag
Orhan Pamuk (Kurzbiografie)
Orhan Pamuk: Rot ist mein Name
Orhan Pamuk: Schnee
Orhan Pamuk: Istanbul
Orhan Pamuk: Die Nächte der Pest