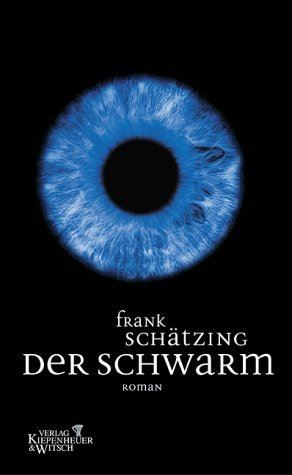Wytske Versteeg : Die goldene Stunde

Inhaltsangabe
Kritik
Paradies
Mari ist Anfang 40. Sie hat Archäologie studiert und beteiligt sich in den Sommermonaten an Ausgrabungen, engagiert sich jedoch seit einiger Zeit auch als Sozialarbeiterin in einer „Momo“ genannten Anlage für Asylsuchende, die von den Kleingärtnern in der umliegenden, seit 1935 bestehenden Schrebergarten-Siedlung mit dem Vereinsnamen „Paradies durch Arbeit“ geduldet, aber auch misstrauisch beobachtet werden. Johan, der hier seit 40 Jahren seinen Kleingarten pflegt:
„Hallo Sie“, pflegte er ernst zu sagen, „diese jungen Männer, die gehören einfach nicht hierher. Ich bin kein Rassist, denn genau in diese Schublade sollen wir gesteckt werden. Ich hab nichts gegen sie, aber sie gehören einfach nicht hierher.“ Er machte eine kurze Pause. „Man kann hier schließlich auch nicht einen Orangenbaum pflanzen und davon ausgehen, dass er gedeiht, stimmt’s oder hab ich recht?“ […] „Hier ist einfach zu wenig Platz“, fuhr er fort, „zu wenig Platz für eure Ideen.“
Einmal beschwert sich Johan bei Mari, dass es in ihrem Bereich wie in einem Coffeeshop rieche. „So was wollen wir hier nicht, das gibt bloß Ärger.“
Besonders erfüllend findet Mari ihr Engagement in der Sozialarbeit nicht.
Die meisten meiner Klienten waren nicht wütend, dafür fehlte ihnen die Kraft, sie hatten längst nicht mehr genug Hoffnung, um sich zu empören, es gab keinerlei Grund zu der Annahme, es könnte noch anders werden. Manchmal hasste ich sie auch deshalb. Was erwarteten sie eigentlich von mir? Sie benahmen sich wie träges, gefügiges Vieh, warteten einfach auf das, was kam oder niemals kommen würde, fanden alles selbstverständlich, was ich ihnen ermöglichte.
Durch Mari findet auch Ahmad nach „Momo“. Der Musiker ist vor dem Krieg in seiner Heimat geflohen. Obwohl er halb so alt ist wie sie, verliebt sie sich in ihn und quartiert ihn in ihrer Wohnung ein. Dass sie ihn mit ihrer Zuwendung erdrückt, spürt sie nicht.
Man kann wirklich nichts gegen sie sagen, außer dass ihre guten Absichten etwas aus mir machen, was ich nicht bin, nicht kann, nicht sein will.
Ich bin nicht die Geschichte, die du aus mir machst und anderen gegenüber im immer selben Wortlaut wiederholst.
Auf dem Fest, zu dem du mich eingeladen hattest, wollte eine Frau wissen, „was ich mache“. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, was sie damit meinte. Ich war zwischen den einzelnen Grüppchen umhergeirrt, ohne irgendwo Anschluss zu finden, und war froh, dass mich jemand ansprach. Aber selbst auf diese einfache Frage wusste ich keine Antwort. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich warte darauf, dass irgendetwas anfängt, dass ich endlich etwas tun darf, dass die Welt wieder anfängt zu klingen. Aber das sagte ich ihr nicht, natürlich nicht, ich sagte, ich würde Musik machen.
Eines Tages werden Momo und das Paradies durch ein Feuer in Schutt und Asche gelegt – und Ahmad verschwindet zur gleichen Zeit spurlos. Bald darauf wird neben den verkohlten Resten ein Riesenschild mit dem Angebot zukünftiger Luxusimmobilien aufgestellt.
Ahmad hinterlässt Mari einen langen Brief, in dem er schreibt:
Ich bin es den Toten schuldig, die Zeit nicht einfach so verstreichen zu lassen, ewig auf Entscheidungen von anderen zu warten. Ich bin es ihnen schuldig, mehr zu tun, als bloß zu überleben.
Ich habe beschlossen, nicht länger zu warten.
Mari denkt:
„Ich hätte mir etwas anderes gewünscht: eine Geschichte mit Happy End, in der ich dich vor allem retten würde, vor der Außenwelt, vor deiner Geschichte, vor dir.“
Sarakina
Verstört über die Zerstörung der Einrichtung und vor allem Ahmads unerwartetes Verschwinden macht Mari sich auf den Weg in seine Heimat, um mit Unterlagen, die er bei ihr zurückgelassen hat, nach 4000 Jahre alten Felsmalereien zu suchen. Sie kündigt ihre Wohnung, verkauft bzw. verschenkt ihren Hausrat und fliegt nach Baglor.
Dort meldet sie sich im Büro von „Tourism for Life“. Weil die Karthografierung von Felsmalereien für den Tourismus förderlich sein könnte, hilft man ihr, allerdings ohne besonderes Interesse.
Was noch geschehen musste, schien vor allem Bürokratie zu sein: Eine schier endlose Reihe Beamter musste ein Formular in dreifacher Ausfertigung abstempeln und das richtige Kästchen ankreuzen. Die Regierung misstraute Ausländern, die sich mit der Landeskunst befassen wollten, obwohl sie selbst gar nichts damit anzufangen wusste.
Nicht ohne schlechtes Gewissen sah ich zu, wie sich Enam meinetwegen einen Weg durch dieses Labyrinth bahnte. Man braucht Erfahrung, um mit Korruption umzugehen, muss wissen, welche Grenzen man auf keinen Fall überschreiten darf und welche Höflichkeiten nötig sind, um die gemeinsame Illusion aufrechtzuerhalten, dass das Geld aus reinem Pflichtbewusstsein angenommen wird.
Nach Wochen besaß ich endlich einen Stapel Formulare voller Stempel, ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, was darin stand. Aber laut Enam war alles organisiert.
Mari fliegt mit einem kleinen, klapprigen Flugzeug weiter nach Osten und fährt dann noch einmal hundert Kilometer mit dem Bus bis nach Sarakina. Das Dorf liegt in der Nähe von Ahmads Heimatstadt Daresh.
Die ersten Felszeichnungen bei Sarakina wurden um 1970 durch einen Zufall entdeckt, aber bald darauf brach der Grenzkrieg aus und niemand interessierte sich mehr dafür.
Unerwartet erklärt sich ein Mann um die 50 namens Tarik bereit, ihr bei der Suche nach den Felszeichnungen zu helfen, vor allem, indem er sie mit seinem Wagen an die gewünschten Orte bringt.
Die anderen Dorfbewohnern halten Distanz zu der Fremden.
Von Tarik und den Kindern einmal abgesehen, spreche ich so gut wie mit niemandem, die anderen meiden mich nach wie vor. In diesem Dorf haben alle außer mir eine Funktion, nur ich bin hier nutzlos.
Tarik
Tarik lebt zwar seit Jahren in Sarakina, wird aber von der Dorfgemeinschaft noch immer nicht als zugehörig angesehen. Man ruft ihn nur, wenn die Leiche eines in den Bergen tödlich verunglückten Fremden gefunden wird. Dann ist es seine Aufgabe, den Toten zu waschen, für die Bestattung vorzubereiten und das Grab zu schaufeln. Außerdem arbeitet er in der heißen und trockenen Jahreszeit als Brandwächter. Und nun hat ihn der Kreisleiter Mabruk beauftragt, sich um die Ausländerin zu kümmern, weil er als Einziger hier mehr als ein paar Worte Englisch sprechen kann.
Er ärgert sich über diese Frau, diese Mari. Ihre Ankunft bringt alles durcheinander. Nicht das Dorf, das tief verwurzelt und daher unerschütterlich ist, sondern ihn. Sie stört seine Routine, den Frieden, den er in Sarakina gefunden hat. Das liegt an ihrer Arglosigkeit, an ihrer naiven Hoffnung, etwas beitragen zu können – daran, dass sie gar nicht merkt, dass keiner hier auf sie gewartet hat.
Er war noch ein Kind, als Rebellen, die für die Unabhängigkeit der Region kämpften, in seinem Heimatdorf auftauchten, die Mutter erstarrte und ihn festhielt.
„Lass den Jungen los“, befahl der Mann mit dem roten Stirnband. „Oder willst du, dass er zusieht?“ Seine Leute lachten. Tariks Mutter atmete scharf ein, bevor sie ihn losließ. Auf einmal waren seine Schultern viel leichter, wo ihre Hände nicht mehr auf ihnen lasteten. Langsam entfernte er sich vom Haus, wobei er sich wiederholt nach seiner Mutter und den Männern umsah. Seine Füße waren bleischwer, seine Schritte zögerlich und unsicher.
Er erinnert sich noch gut an die Stille, die ihn empfing, als er zurückkam, ohne zu wissen, wie viel Zeit inzwischen verstrichen war. Daran, wie er sich nicht ins Haus traute und auf dem Grundstück wartete, bis seine Mutter endlich nach draußen kam und an ihm vorbeiging, ohne ihn wahrzunehmen. Etwas war schief an ihrem Gesicht, was ihm bislang nie aufgefallen war. „Es war niemand hier“, sagte seine Mutter, „niemand.“ Die Sonne stand noch hoch am Himmel, es war viel weniger Zeit vergangen, als er geglaubt hatte.
Später kam sein Vater nach Hause, so wie jeden Tag schweißbedeckt und rot vom staubigen Feld. Nichts an ihm war anders als sonst, seine Stimme war unverändert, der Blick, mit dem er seine Frau betrachtete, das Seufzen, mit dem er sich im Innenhof unter dem Baum niederließ. Tarik erinnert sich noch genau, wie er seinen Vater an diesem Abend und in den Wochen danach verstohlen musterte, wenn er ihm Hand und Stirn küsste, in der Erwartung, die Erde könnte sich jeden Moment unter seinen Füßen auftun. Er hatte eine Heidenangst davor, doch als nichts geschah, begann er sich regelrecht danach zu sehnen. Er wollte, dass seine Welt wieder so war wie vor diesem Morgen: echt.
Im Alter von 15 Jahren meldete sich Tarik in Daresh bei der Armee, die inzwischen mit Panzern durch die Straßen patrouillierte und einen eigenen Präsidenten installiert hatte, nachdem das gesamte Zentralkomitee bei einem Abendessen im Palast vergiftet worden war.
Man setzte ihn als Bewacher im Lager 33 ein.
Er hatte den Männern in der Hierarchie über ihm vertraut, die ihm erst gezeigt hatten, wie schwach er war, um ihn dann stark zu machen.
Ich war wie im Rausch, Teil von etwas Größerem, ich war nicht länger allein.
Es belastet Tarik, wenn er daran denkt, wie willkürlich und grausam er mit den politischen Gefangenen des Regimes umging, von denen viele im Lager umkamen. Mal gestattete er Frauen, die ihre Männer besuchen wollten, den Zutritt, mal nicht. Eine Regel gab es dafür nicht.
Ahmad
Ahmad träumte von einem Studium am Konservatorium in Daresh und einer Karriere als Musiker. Aber dann machte er bei den Demonstrationen gegen die Tyrannei mit.
Einige von uns tragen Totenhemden zum Zeichen, dass wir bereit sind, für die gute Sache zu sterben. Als lebende Tote haben wir nichts zu verlieren, die Gefängnisse sind voll mit unseren Freunden. Im Fernsehen behaupten Wissenschaftler und überschminkte Moderatorinnen, dass jeder, der auf die Straße geht, Geld dafür bekommt, dass wir für eine ausländische Macht arbeiten – oder dass wir unter Drogen stehen. Der Präsident verkündet, dass nicht er den Konflikt sucht, aber diese Verschwörung nicht ignorieren kann, das Blut, die Unruhen und Spannungen, dass dieser Aufstand niedergeschlagen werden muss.
Das Regime ließ die Demonstrationen gewaltsam auflösen. Von einem Hubschrauber aus wurde auf die Teilnehmer geschossen. Als Ahmad einmal in der Nähe eines Fensters stand, zerbarsten die Scheiben. Ein Panzer bahnte sich einen Weg durch die Gassen und riss dabei Hauswände ein.
Niemand bekommt seinen Toten, wenn nicht ein Formular unterschrieben und bestätigt wird, dass es ein Unfall war. Ein von Kugeln durchsiebter Körper wird begraben und verwest, ohne Fragen zu stellen. Papier ist geduldiger, es bleibt bestehen, sodass nur zählt, was darauf steht.
Nach dem Tod seiner kleinen Schwester Maryam bezahlt Ahmad einen Schleuser. Der lässt ihn und andere Flüchtlinge mit einem Transporter aufsammeln. Als sie das Wrack von einem Boot sind, auf dem sie übers Meer gebracht werden sollen, protestiert eine Frau und die Gruppe erstarrt wie eine Tierherde, die Gefahr wittert.
Der Schlepper schaut auf seine Uhr. Seine Miene bleibt reglos, als er eine Pistole zieht und auf die Frau zielt, ein lauter Knall, kein Blut ist zu sehen, aber sie steht nicht wieder auf. Der Mann starrt ihn entsetzt an, seine Kinder pressen sich an ihn.
Rückkehr
Vom Frühjahr bis zum Herbst versucht Mari vergeblich, mit Tariks Hilfe Felszeichnungen zu entdecken.
Was ich gefunden habe, ist enttäuschend: eine Höhle, in der vermutlich einst Jäger Feuer gemacht haben – vor so langer Zeit, dass die schwarze Rußschicht versteinert ist, sowie neuere Kratzer in einer anderen Wand. Dabei hatte ich Pferde, Hirsche, Ochsen, menschliche Figuren, Handabdrücke finden wollen – Zeichnungen, die Jahrtausende überdauert haben.
Ich hätte gar nicht erst herkommen dürfen.
Tarik ist viel zu höflich oder vielleicht einfach zu gleichgültig, um mir ins Gesicht zu sagen, wie sinnlos unsere Arbeit ist.
Tarik nimmt zur Kenntnis, dass Mari aufgibt und einen Rückflug bucht. Er fährt sie zu der Kleinstadt, von der die Maschine nach Baglor starten soll. Mari lädt ihn noch zum Essen ein, und danach meint sie, es sei bereits zu dunkel für seine Rückfahrt. Sie nimmt ihn mit in ihr Hotelzimmer. Nach dem Orgasmus redet sie unvermittelt von Ahmad:
„Es war nicht seine Schuld“, sagt sie plötzlich. „Ein Gasschlauch war falsch angeschlossen, jemand hätte das kontrollieren müssen, jemand hat das übersehen, vielleicht war es sogar meine Schuld. Alle haben gedacht, dass er es war, dass er den Brand gelegt hat.“ Und nach einer Pause: „Alle, einschließlich mir. Denn wenn man unschuldig ist – warum läuft man dann davon?“
Tarik, der froh ist, im Bett nicht versagt zu haben, ärgert sich darüber, dass Mari in dieser Situation an einen anderen Mann denkt.
Am anderen Morgen zieht er sich an und verlässt das Hotel, ohne Mari zu wecken. Er kehrt nach Sarakina zurück. Es ist bereits dunkel, als er ankommt.
Trotz seiner Erschöpfung findet er keinen Schlaf, deshalb steht er auf und geht ins Freie, nimmt einen Weg, der ihn weit von Sarakina fortführt. Hier war er mit ihr unterwegs, unweit der Höhlen, in denen sie nicht fand, was sie suchte.
Tarik sieht Licht aufblitzen und entdeckt eine Gruppe von knapp zwanzig Flüchtlingen. Er hilft einer gestürzten Frau, die sich nicht weiter über das Auftauchen eines Fremden wundert. Ohne weiteres zeigt er der Gruppe den Weg und führt sie an.
Als sie auf den Kreisleiter Mabruk und dessen bewaffnete Männer stoßen, brüllt Tarik ohne lange nachzudenken: „Lauft!“ Während die Flüchtlinge entkommen, wird Tarik mit Knüppeln zusammengeschlagen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Über Stunden bleibt er am Hang liegen wie ein Schaf, das nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen kann – ein Bild, das ihn trotz der Schmerzen grinsen lässt. […] Wenn er die Augen aufschlägt, stehen die Sterne über ihm nicht etwa still, sondern machen in wilden Kreisen Jagd aufeinander. Er weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist oder nur die logische Konsequenz der Schläge, die er auf den Kopf bekommen hat. Der Schmerz kommt jetzt in Wellen, er ist zu ertragen, ihm fast schon vertraut. Aber dass der Schmerz nachlässt und er die Kälte nicht mehr spürt, hat nicht unbedingt etwas Gutes zu bedeuten. […] Sollte er hier noch lange liegen, werden bald die Vögel, die Raben und Krähen kommen. Sie werden erst vorsichtig näher hüpfen und dann immer dreister werden, bei seinen Augen anfangen. Das sollte ihn eigentlich mit Entsetzen erfüllen, aber es geht ihn schon nichts mehr an – nicht wirklich. Er ist zu müde, um sich darüber aufzuregen, noch nie hat er sich so frei gefühlt.
Vom gleichzeitigen Scheitern ihres Engagements als Sozialarbeiterin und einer illusionären Beziehung mit dem arabischen Flüchtling Ahmad geschockt, reist die niederländische Idealistin Mari in dessen Heimatland und träumt davon, 4000 Jahre alte Felszeichnungen zu entdecken. Dabei hilft ihr Tarik, ein Außenseiter, der sich in jungen Jahren als Handlanger staatlicher Willkürherrschaft schuldig machte und davon nicht loskommt. Ahmad, der vor diesem Regime floh, begreift nach nach einer Phase der Orientierungslosigkeit und Verzweiflung, dass nur er selbst seine Zukunft gestalten kann.
Von diesen drei nach sich selbst suchenden Menschen erzählt Wytske Versteeg in ihrem Roman „Die goldene Stunde“. Sie entwickelt die Geschichte im Wechsel der drei Perspektiven – Mari, Ahmad, Tarik –, die sich gegenseitig ergänzen, spiegeln und widerlegen. Dabei lässt sie Mari und Ahmad als Ich-Erzählerin bzw. -Erzähler auftreten. Ahmad schreibt Mari, und Mari redet immer wieder in Gedanken mit Ahmad. Das sind Textpassagen in der literarisch ungewöhnlichen Zweiten Person Singular.
Die gegenwärtige Handlung in „Die goldene Stunde“ dauert kaum mehr als ein Jahr, aber Erinnerungen bzw. Rückblenden reichen teilweise bis in die Kindheit der Charaktere zurück.
Die von Wytske Versteeg in „Die goldene Stunde“ genannten Ortsnamen sind fiktiv. Ein Teil des Geschehens lässt sich wohl in den Niederlanden lokalisieren; alles andere spielt in einem arabischen Gebiet (Vorbild: Syrien?), in dem grausame Rebellen für die Unabhängigkeit kämpfen, bis sie von einem diktatorischen oder zumindest autokratischen Regime gewaltsam aufgerieben werden und ein Grenzkrieg tobt.
Wytske Versteeg hält der heutigen Welt mit ihrem Roman „Die goldene Stunde“ einen Spiegel vor. Klug, nachdenklich und mit stupenden Kenntnissen zeichnet sie ein erschütterndes Bild. Wie intensiv und überzeugend sich Wytske Versteeg in die Lage ihrer Romanfiguren zu versetzen vermag, zeugt von einem außergewöhnlichen Einfühlungsvermögen.
Ebenso überragend wie der Inhalt sind Form und Sprache. Anfangs ergeben sich beim Lesen von „Die goldene Stunde“ mehr Fragen als Antworten. Andeutungen evozieren das Bedürfnis nach Aufklärung, aber Wytske Versteeg hält sich mit Erläuterungen bewusst zurück, spart vieles aus und lässt anderes offen. Erst allmählich lichtet sich der Nebel ,und Zusammenhänge werden erkennbar. Das ist Literatur auf hohem Niveau.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2024
Textauszüge: © Verlag Klaus Wagenbach
Wytske Versteeg: Boy