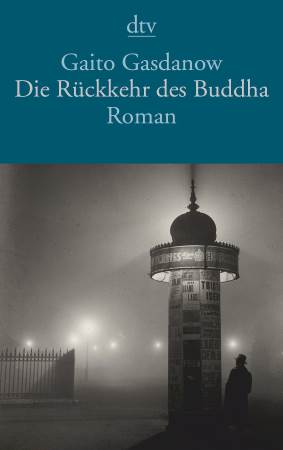Rolf-Bernhard Essig : Die Kunst, Wasser zu fegen

Inhaltsangabe
Kritik
Die aus Hamburg nach Franken gezogene Familie hat acht Kinder. Die Mutter der fünf älteren Kinder starb an Krebs. Die zweite Ehefrau des Witwers – deren erster Ehemann ebenfalls starb – ist die leibliche Mutter der drei jüngeren Kinder, zu denen der Ich-Erzähler gehört. Die drei ältesten Töchter wohnen in anderen Städten; zwei studieren, eine arbeitet bereits. Die restliche Familie lebt seit einiger Zeit in einem großen Haus auf einer Anhöhe, einen Kilometer vom fränkischen Dorf Haidenburg entfernt, im „Zonenrandgebiet“. Von dort ist es nicht weit bis zu Schildern mit der Aufschrift: „Halt! Hier Zonengrenze“.
Im Schuppen befinden sich Hühner- und Kaninchenställe, und als der 1963 geborene Junge acht Jahre ist, muss er dem Vater beim Schlachten helfen, beispielsweise einem Hahn den Kopf abschneiden. Der Vater will ihn zu Härte und Stärke erziehen, nicht zuletzt mit Schlägen, etwa mit einem Teppichklopfer. Wenn der Junge sich fürchtet, schreit der Vater:
„Hab doch nicht immer so Angst um dein bisschen Scheißleben!“
„Mein Vater war lang tot, als ich so alt war wie du!“, sagt er Vater.
Alle fürchteten und bewunderten gleichzeitig die bullige Kraft, mit der er schwerste Arbeit verrichtete.
Im Krieg war der Vater Unteroffizier auf einem Minensuchboot. Dann diagnostizierten die Ärzte bei ihm einen Herzfehler. Ein Arzt riet ihm zur Schonung, aber ein anderer meinte, er solle lieber das Leben auskosten, denn niemand wisse, ob er durch Untätigkeit länger leben würde. Während die Mutter als Lehrerin tätig ist, kümmert der Vater sich um die Kinder und den Haushalt.
Der Vater schimpfte selten über sein Hausmann-Dasein. Er kaufte ein, kochte für alle, putzte penibel das große Haus, wusch und bügelte Wäscheberge, besorgte den Garten. Wie nebenbei errichtete er den Schuppen, eine Tischtennishalle, malte und tapezierte im Haus, reparierte Kleinigkeiten am Auto, die Fahrräder, Möbel.
Die Kinder werden gedrängt, beim Fleisch den Fettrand mitzuessen. Dazu hält der Vater Predigten über die kriegsbedingte Mangelernährung und erzählt von Hamsterfahrten, die nötig waren, um das Notwendigste zu bekommen.
An Wochentagen isst die Familie in der Küche, aber am Sonntag wird der Tisch im Wohnzimmer – der zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern so weit ausgezogen werden kann, dass Platz für 14 Stühle entsteht – mit dem guten Porzellan und dem Silberbesteck gedeckt.
Zur Feier des 10. Hochzeitstags serviert der Vater eine malaiische Reistafel im Familienkreis. Dabei erzählt er, dass er als Pirat mit Klaus Störtebeker zur See gefahren sei. Nachdem sie von der Hanseflotte besiegt und zum Tod verurteilt worden waren, bat Störtebeker darum, seinen kopflosen Körper unmittelbar nach der Hinrichtung an seiner in Reihe aufgestellten Mannschaft entlanglaufen zu lassen und alle zu begnadigen, an denen er vorbeikam. Der Vater behauptet, an 13. Stelle gestanden zu haben. Vor dem 12. Mann habe der Henker dem enthaupteten Störtebeker ein Bein gestellt, fährt der Vater fort, aber der Piratenkapitän sei noch an ihm vorbeigetaumelt, und deshalb könne er jetzt davon berichten.
Dann erzählt der Vater den Kindern auch noch, die Mutter sei die Tochter des Negerkönigs gewesen. Vor zehn Jahren sei er mit einem Schiff nach Afrika gekommen und vom Negerkönig empfangen worden. Als er sich in dessen Tochter verliebte und um ihre Hand anhielt, weigerte sich der König, sein Einverständnis zu geben. Erst als der Bewerber dem von der Hitze am Äquator Geplagten eine große Menge Eis versprach, überließ dieser ihm die Tochter, und sie durfte sogar mit zur Antarktis reisen. In der kalten Region fror sie und wurde immer bleicher. Als das Paar nach 73 Tagen mit einem Eisberg im Schlepptau zurückkehrte, erkannte der Negerkönig seine Tochter kaum wieder, weil deren Haut inzwischen weiß geworden war.
Tatsächlich stammt die Mutter aus einem Ort, der im Schulatlas des Jungen noch Königsberg und nicht Kaliningrad heißt. In dem 1948 von den Alliierten genehmigten Atlas ist Deutschland in verschiedenfarbige Besatzungszonen aufgeteilt, und über einem Gebiet im Osten steht „z. Zt. unter polnischer Verwaltung“.
Beim Schlafen achtet der Junge darauf, dass weder ein Arm noch ein Bein aus dem Bett heraushängt, denn darunter vermutet er eine tagsüber nicht sichtbare Spinne, die ihn beißen würde. Nachts geht er nur ungern zur Toilette, denn er befürchtet, dass sich dort ein Skelett aufhält. Immerhin glaubt er, herausgefunden zu haben, wie man es zum Verschwinden bringt.
Durch Licht, viel helles, plötzliches Licht. Man musste möglichst rasch, am besten, ohne die Augen zu öffnen und in einem Schwung, die Tür zum Badezimmer öffnen und sofort den Lichtschalter umlegen. Dann verschwand es, ehe es irgendetwas anderes tun konnte.
Sobald er die Spülung betätigt hat, zieht er die Tür möglichst weit zu und knipst dann erst rasch das Licht aus.
Beim Ofenausräumen darf nicht geniest werden, denn sonst würde die Asche aufwirbeln, die ebenso wie ausgekämmte Haare, abrasierte Bartstoppeln des Vaters, abgeschnittene Fuß- und Fingernägel als Dünger auf die Gemüsebeete gestreut wird. Später wird der Küchenherd mit den herausnehmbaren Ringen in der Platte durch einen Gasherd ersetzt, und geheizt wird nicht mehr mit Holz und Kohlen, sondern mit Öl.
Ein besonderes Vergnügen ist es für die Kinder, wenn sie nach der Kartoffelernte einige übersehene Kartoffeln ausgraben dürfen, die sie dann auf Stöcke spießen und in die Glut der Feuer legen, mit denen die Bauern die Stoppelfelder abbrennen, bis die Schale zwar schwarz verbrannt, aber das Innere weich und essbar ist.
Eine Tante bringt Speck und Stroh-Rum aus Tirol mit. Die Kinder zünden heimlich mit „Welthölzern“ aus der Tischschublade ein paar Tropfen des 80-prozentigen Rums an und freuen sich über die blaue Flamme. Der ältere Bruder und dessen Freunde basteln bereits aus Metallrohren, Puderzucker und „Rasikal“-Unkrautvernichtungsmittel Bomben, aber der Erzähler begnügt sich noch mit Zündeln. Zwei Stunden nachdem er wieder einmal Erde auf ein kleines Feuer geschaufelt hat, um es zu löschen, hört er, wie die Feuerwehr zu der Stelle fährt. Eine Hecke und das Heu auf dem Feld sind abgebrannt. Diesmal wird der Junge nicht verprügelt, aber er weint und schämt sich. Der Vater erklärt ihm, dass Feuer unter einer Erdabdeckung weiterglühen und durch einen Windstoß angefacht werden könne.
Der Großvater fährt einen Mercedes 280 SL, ist Obermedizinaldirektor, malt und bewohnt mit seiner zweiten Frau eine Villa auf einem großen Grundstück mit einem eigenen Swimming Pool. Wenn die Familie dort zu Besuch ist, gibt es Torte, und zwar keine selbstgemachte, sondern gekaufte vom Konditor. Das ist etwas ganz Besonderes. Einmal lädt der Großvater sie zum Essen in ein Restaurant ein, und der Junge meint nach dem Eis, so gut habe es ihm noch nie geschmeckt. Als sie dann mit dem Opel Rekord nach Hause fahren, schimpft der Vater – der so rast und überholt, dass es den übrigen Insassen angst und bange wird –, über das „Geschleime“ gegenüber dem Großvater.
„Der Obermedizinaldirektor hatte doch mehr Hypotheken als sonst was! Wer hatte den Opa von seinen Schulden befreien und ihm das Haus abkaufen müssen? Er! Nur deshalb konnte der jetzt dicke tun! Nur deshalb fehlte es ihnen jetzt an Geld! Außerdem hatte der da sich einen Dreck um seine Kinder gekümmert, hatte sie und seine Frau sitzenlassen.“
Erst einige Zeit später begreift der Junge, dass er zwei Großväter hat. Der Obermedizinalrat ist der Vater der Mutter, der Großvater väterlicherseits starb früh, aber über ihn gibt es einen Artikel im Lexikon, denn er hatte Bücher geschrieben. Der Junge malt sich aus, dass es später auch einmal einen Beitrag über ihn mit dem Hinweis „Enkel von 1“ geben könnte.
Nicht selten fordert der Vater eines der Kinder auf: „Hol den Brockhaus!“ Weil pro Quartal nur einer der teuren Bände geliefert wird, fehlen die letzten allerdings noch.
Als das Telefon klingelt und die Eltern den Jungen ausnahmsweise auffordern, den Hörer abzuheben – nicht ohne ihn zu ermahnen: „anständig melden!“ – hört er zunächst nur jemanden atmen.
Dann kommt die Stimme. Er weiß nicht, ob eine Frau oder ein Mann spricht, hoch, beinahe singend, lockend: „Hallooo, weißt du, dein Vaaater, der macht es mir immer so schööön.“
Der Junge weiß nicht, wie er reagieren soll. Er fühlt sich wie gelähmt und wagt es dann auch nicht, den Eltern von dem Anruf zu berichten.
„Wer war das?“, fragt der Vater. „Das hab ich nicht gehört, es hat so gerauscht.“
In der Schule gilt der Junge als Außenseiter. Die anderen verspotten ihn zum Beispiel als Saupreuß, Fischkopf oder Nordlicht. Katharina lockt ihn einmal auf dem Schulhof zu Gabi, und die bespuckt ihn mit abgenagten Kirschkernen. Als er gedemütigt stehen bleibt, provozieren die Mädchen ihn, aber er hat gelernt, dass es sich nicht gehört, Mädchen zu schlagen.
In einer Baracke am Dorfrand, zu der nur ein Schlackeweg führt, sollen viele „Assis“ wohnen. Der Lehrer warnt die Schüler vor dem „Gesindel“, aber das macht sie neugierig. Sie pirschen sich an. Im Freien halten sich nur Kinder auf. Die einzige Erwachsene, die zu sehen ist, lehnt im Unterhemd am Fenster und raucht. Der Ich-Erzähler beobachtet, wie der zwei Jahre jüngere Mitschüler Jochen die „Rose von Jericho“ und deren Tochter besucht und mit Küssen begrüßt wird. Eines Tages bricht in der Baracke ein Schwelbrand aus. Die Feuerwehr rückt aus. Einige Zeit später wird die Baracke abgerissen.
Im Dorf sind viele Männer mit amputierten Armen oder Beinen zu sehen. Einer, den die Kinder den schwarzen Mann nennen, hat einen künstlichen Arm mit einer Lederhand und ist viel mit seinem Boxer Ali unterwegs. Der Junge weiß, dass er nicht mit Fremden mitgehen darf, aber als er sieht, dass die Mitschülerin Susanne den schwarzen Mann begleitet, will er ihr beistehen und schließt sich ihnen an. Der unheimliche Mann nimmt sie mit ins Haus und führt ihnen einige Spieluhren vor. Allmählich verliert der Junge seine Angst. Dann fordert der schwarze Mann ihn und Susanne auf, mit ins Schlafzimmer zu kommen und schließt die Tür hinter ihnen, damit der Hund draußen bleibt. Der Junge bereut es, mitgegangen zu sein. Aber der Mann öffnet auch hier eine Spieluhr. Das sei seine schönste, sagt er; seine Verlobte Eva habe sie ihm ins Feld geschickt. Unter Tränen erzählt er weiter. Eva starb kurz nach der Hochzeit, als das Haus, in dem sie wohnte, von einer Bombe getroffen wurde.
Einige Zeit später erfährt der Junge, dass der schwarze Mann im Krankenhaus liegt. Ein Granatsplitter in seinem Rücken hat sich verschoben und macht eine gefährliche Operation erforderlich. Der Junge würde den Patienten gern besuchen, doch um zum Krankenhaus in der nächsten Stadt fahren zu dürfen, müsste er erst seinem Vater gestehen, dass er mit dem Mann geredet hat, und das wagt er nicht.
Einmal wird der Vater so wütend, dass er kurzerhand eine dreieinhalb Wochen lange Reise nach Kanada bucht, ins Auto steigt und losfährt. Die erste Karte schickt er bereits aus Frankfurt am Main. Eigentlich wolle er gar nicht mehr wegfliegen, schreibt er, aber nun könne er nicht mehr zurück. Dabei hat er vergessen, seine Medikamente mitzunehmen und auch gar nicht daran gedacht, sich die Adresse des Neffen in Toronto zu notieren, den er besuchen will.
Der Vater bastelt alle Geschenke selbst und arbeitet unermüdlich in seiner Werkstatt. Als er mit der Hand in die Kreissäge gerät, presst er einen Lappen auf die heftig blutende Wunde, fährt allein ins Krankenhaus und arbeitet dann mit der genähten und verbundenen Hand sofort weiter.
Auf der Betondecke der Garage bleiben nach Regengüssen Wasserlachen zurück, die der Vater mit einem Straßenbesen wegfegt.
Die Kunst, Wasser zu fegen, erlernte der Junge erst nach vielen Monaten.
Als die Familie 1973 Ferien in Dänemark macht, ertrinkt der kleine Bruder. Die beiden anderen Brüder sind mit der Situation völlig überfordert.
Da knieten sie sich in den Sand und beteten laut und schrien zu Gott. Sie versprachen ihm, dass sie artig sein wollten, sie wollten ihr Erspartes den Inderkindern geben, sie wollten Finger dafür geben, einen Arm, wenn nur der Jüngere gerettet würde.
Am zweiten Abend wird die Leiche angeschwemmt. Die beiden noch lebenden Brüder fahren erstmals allein mit dem Zug, und zwar nach Hamburg, zu einer der Schwestern und deren Freund. Die bringen die Jungen dann nach Hause, wo sie von den Eltern erwartet werden, die den Sarg im Auto transportierten.
Bald wusste er [der Junge] es so einzurichten, dass er bei Bekannten oder Freunden das Gespräch unauffällig auf den Tod lenkte […], denn fast immer sahen ihn die Menschen dann tröstend und liebevoll an […]
Er hatte den Bruder benutzt wie ein Werkzeug: um Mitleid zu erwecken, Freundlichkeit, Nähe, Zustimmung, Bestätigung zu spüren. Er hatte mit ihm angegeben wie mit einem neuen Fahrrad. Er hatte ihn auch schon als Schutzschild missbraucht, um Strafen abzuwenden.
Er schämt sich für sein Verhalten und auch dafür, dass er den toten Bruder nach einigen Monaten nahezu vergessen hat. Er denkt erst wieder an ihn, als am Todestag eine Kerze am Küchenfenster brennt und ein Foto des kleinen Bruders daneben steht.
30 Jahre nach dem Krieg erhält der Vater endlich eine Rente als Schwerkriegsbeschädigter.
2002 fährt der Ich-Erzähler zur Silberkonfirmation von seinem jetzigen Wohnort Heilbronn nach Haidenburg, wo er seit vielen Jahren nicht mehr war. Er ist aus der Kirche ausgetreten, kann also nur zuschauen, wie sieben seiner früheren Mitschüler das Glaubensbekenntnis sprechen, und will auch gar nicht mitmachen, sondern lieber unerkannt in der Menge bleiben. Der 39-Jährige müsste sonst von seiner gescheiterten Ehe erzählen, den beiden bei ihm lebenden Kindern und dass er seit Herbst arbeitslos ist.
Nach der Messe bleibt er sitzen, bis die meisten die Kirche verlassen haben. Dann geht er zum Friedhof. Dort entdeckt er das Grab des schwarzen Mannes: Kurt Schwarzer, 18. 3. 1922 – 16. 7. 1973. Auf einen Pflasterstein hat jemand mit Ölfarbe „Ali“ geschrieben. Er sitzt bereits wieder im Auto, als ihm einfällt, dass er vergessen hat, das Familiengrab zu besuchen. Aber er geht nicht zurück. Stattdessen fährt er zum Elternhaus. Weil die Auffahrt von Ginsterbüschen, Haselnusssträuchern und Brombeerranken versperrt ist, lässt er das Auto stehen und geht zu Fuß weiter.
Oben angekommen, freute er sich: Die Wildnis hatte nicht ganz gewonnen. Beeteinfassungen hatten überdauert, Lilien blühten, Borretsch, Rosen, Königskerzen und Glockenblumen. Irgendjemand wohnte hier offenbar noch und mochte die fröhliche Unordnung des Pflanzendurcheinanders.
Auf der Nachbarwiese kündigt eine überdimensionierte Tafel den Bau von 27 Einheiten für betreutes Wohnen an, barrierefrei und mit einem Seniorentanzplatz.
Weil es zu spät ist, um nach Heilbronn zurückzufahren, beabsichtigt er, in einem Hotel zu übernachten. Aber er findet kein freies Zimmer. In einem Gasthof telefoniert jemand herum, während er zu Abend isst, und nachdem er auch noch ein paar Bier getrunken hat, heißt es, er werde in der „Krone“ erwartet. Auf dem kurzen Weg dorthin hält ihn eine Polizeistreife an. Er muss befürchten, dass sein Führerschein wegen Alkohols am Steuer einbehalten wird, aber einer der beiden Beamten, Adrian Markus, erkennt den Sohn der früheren Lehrerin und lässt ihn weiterfahren.
Die Wirtin der Gaststätte „Zur Krone“ heißt Annegret. Es handelt sich um die Tochter der „Rose von Jericho“, die vor zehn Jahren starb.
Der Roman „Die Kunst, Wasser zu fegen“ weist keine auf einen Kulminationspunkt zustrebende Handlung auf, sondern besteht aus kleinen Geschichten über die Kindheit eines Ich-Erzählers, dessen Name nicht genannt wird, der jedoch wie Rolf-Bernhard Essig 1963 in Hamburg geboren wurde und in Franken aufwuchs.
Die meisten dieser Geschichten spielen zwischen 1971 und 1973. Im 28. Kapitel werden der „Deutsche Herbst“ 1977, die „Baader-Meinhof-Bande“, die Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer und die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ kurz erwähnt. Vom 29. zum 30. Kapitel springen wir 25 Jahre nach vorne: Als 39-Jähriger kehrt der inzwischen in Heilbronn wohnende Ich-Erzähler noch einmal für ein paar Stunden in das fränkische Dorf zurück, in dem er seine Kindheit verbrachte.
Aus 31 Miniaturen komponierte Rolf-Bernhard Essig den Roman „Die Kunst, Wasser zu fegen“, in den gewiss viele persönliche Erfahrungen und Erinnerungen eingeflossen sind. Formal hält Rolf-Bernhard Essig sich sehr zurück; er verzichtet auf stilistische Experimente und Sprachspielereien.
Die literarische Kunst, von der Essig allerhand versteht, ist hier darum eine, die sich nicht ausstellt, sondern versteckt; der Stil ist von jener sobrieté, für die es im Deutschen keine schöne Entsprechung gibt. (Michael Maar: Sand im Bauchnabel, „Süddeutsche Zeitung“, 17. Dezember 2013)
Gefesselt wird man als Leser sowohl von den subtil und prägnant geschilderten Erlebnissen als auch von der dichten Atmosphäre. Es ist bemerkenswert, welche Bedeutung Ängste in der Entwicklung dieses Sohnes eines zwar herzkranken, aber kraftvollen Vaters von acht Kindern haben. Sogar als Erwachsener sucht er noch das Grab des „schwarzen Mannes“ auf.
Bei älteren Lesern werden durch „Die Kunst, Wasser zu fegen“ persönliche Erinnerungen wach, nicht nur an eigene Erlebnisse, sondern auch an Kohleöfen, Spulentonbandgeräte, Kofferplattenspieler und vieles mehr.
Bei der Lektorierung sind außer ein paar Druckfehlern auch einige verunglückte Formulierungen durchgerutscht. Zum Beispiel:
Die Kommentare von Nachbarn, sogar Unbekannten in der Stadt nahmen zu, so wie er zunahm.
Immerhin bekam jeder eine braune Bratwurst und eine gelbe Limonaden-Marke, die er im Zelt einlösen konnte. Außerdem hatte der Vater ihm eine Mark gegeben.
Rolf-Bernhard Essig, ein Enkel des Schriftstellers Hermann Essig (1878 – 1918), wurde 1963 in Hamburg geboren, wuchs jedoch in Kulmbach auf. Er studierte an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg Germanistik und Geschichte. Der Titel seiner 1999 eingereichten Dissertation lautet „Der Offene Brief. Geschichte und Funktion einer publizistischen Form von Isokrates bis Günter Grass“ (Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2000, ISBN 3-8260-1647-5). Bei einigen Ausstellungen zu diesem Thema fungierte Rolf-Bernhard Essig als Kurator. Er schreibt für „Die Zeit“, die „Süddeutsche Zeitung“, die „Neue Zürcher Zeitung“ und andere Blätter, arbeitet (auch mit seiner Ehefrau Gudrun Schury gemeinsam) für den Rundfunk, beschäftigt sich mit Redensarten, lehrt Literaturwissenschaft und kreatives Schreiben in Bamberg sowie an den Universitäten in den russischen Städten Samara und Togliatti. Nach einigen Sachbüchern veröffentlichte er 2009 sein erstes Kinderbuch („Sirenensang und Schweinezauber. Geschichten aus der Odyssee“). „Die Kunst, Wasser zu fegen“ ist sein erster Roman.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2013
Textauszüge: © Ch. Schroer