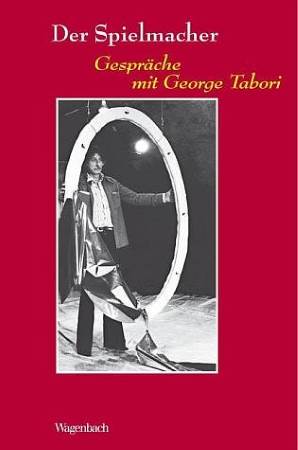Walter Kempowski : Letzte Grüße
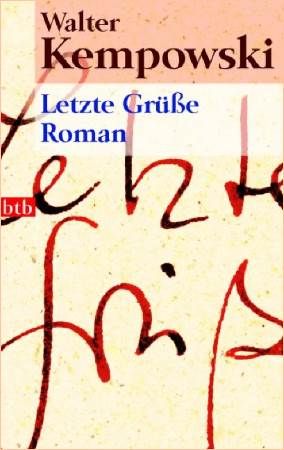
Inhaltsangabe
Kritik
Der vierundsechzigjährige Schriftsteller Alexander Sowtschick wohnt mit seiner Ehefrau Marianne, mit der er seit mehr als vierzig Jahren verheiratet ist, in Sassenholz südwestlich von Hamburg. Ihr Sohn Schitti hat eine Arztpraxis in Stuttgart, ihre Tochter Klößchen studierte Kunst und möchte Graphikerin werden. Mit seinem neuen Roman „Karneval über Lethe“ kommt Sowtschick nicht recht voran, obwohl er längst einen Vorschuss dafür erhalten hat.
Einen „leichten“ Roman schreiben? Das hätte sich machen lassen, einfach draufloserzählen und davon zweihunderttausend Stück verkaufen? Liebe, Leidenschaft und Leid? Wie [sein Verleger] Hessenberg es wieder und wieder forderte? Alexander wusste es: Ein solcher Versuch hätte sich unter seiner Hand in einen schwierigen Text verwandelt, dem die Kritiker zwar zustimmen würden, den die Leser jedoch nicht haben wollten. So war das nun mal. (Seite 333)
Außerdem hat er sich dazu hinreißen lassen, seinen Kollegen Fritz-Harry Mergenthaler aus Aschaffenburg einen „Dünnbrettbohrer“ zu nennen und sich dafür eine Beleidigungsklage eingehandelt. Da kommt ihm die Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts für eine vierwöchige Lesereise durch fünfundzwanzig nordamerikanische Städte mit Abstechern nach Kanada und Mexiko im Spätherbst 1989 gerade recht, auch wenn es strapaziös sein wird, ständig aus den eigenen Werken zu lesen, Vorträge zu halten, sich an Diskussionen zu beteiligen und bei Empfängen herumzustehen.
Nach Japan wäre Alexander Sowtschick jedenfalls nicht gereist.
Straßenschilder nicht lesen können und die Essgewohnheiten dieser Leute! Im Schneidersitz rohen Fisch zu sich nehmen, der womöglich giftig ist? (Seite 13)
Die Amerikaner hatten zwar Bombenteppiche über Barockkirchen abgeladen, dann aber Carepakete geschickt. (Seite 13)
Sowtschick nimmt sich vor, in den USA einen ehemaligen Bomberpiloten zu fragen, wie man sich fühlt, wenn man Barockkirchen zerstört. Er träumt aber auch davon, die junge Frau wiederzusehen, die er vor zehn, fünfzehn Jahren in Santa Barbara auf eine Kirchhofsmauer gehoben und fotografiert hatte. Sie hieß Freddy. Das Foto legt er in seine Brieftasche. In seinen Gedanken nennt er sie noch immer „das Kind“, obwohl inzwischen wohl über vierzig ist. Er befolgt den Rat seines Hamburger Freundes Engelbert von Dornhagen, weder Mantel noch Schalenkoffer mitzunehmen, sondern sich stattdessen Reisetaschen und so einen „praktischen“ Parka zu kaufen.
Die Schwägerin in Peine wurde angerufen, erst mal irgendwie nebenbei, wie’s ihr geht und wie’s den Kindern geht und dann […]: dass Alexander nach Nordamerika fliegen müsse, beruflich, worüber er kreuzunglücklich sei. – Die Schwägerin ärgerte sich furchtbar darüber, denn ihr Mann war nur ab und zu unterwegs, zuweilen hatte er im Schwarzwald zu tun, das war aber auch alles. (Seite 18)
Der Verleger Hessenberg überrascht seinen Autor mit einem Upgrade seines Tickets in die erste Klasse. Stolz sitzt er im pompösen Samtsessel einer SAS-Maschine von Hamburg nach New York.
Endlich war alles gerichtet. Man habe zwar eine Stunde verloren, hieß es, die werde man aber wieder aufholen über dem Atlantik … Da fragte man sich denn doch, wieso die Maschine nicht gleich eine Stunde später abflog? (Seite 37)
Drei Männer und eine Frau vom Niederrhein, für die in der überbuchten Economyklasse keine Plätze mehr frei waren und die man deshalb ohne Aufpreis in die erste Klasse setzte, stören Sowtschick, denn sie lassen sich fortwährend nachschenken und lachen die ganze Zeit laut.
Schlimm! Prosteten sie ihm gar zu? Irregulär Upgegradete prosteten ihm, dem legitimen Erste-Klasse-Passagier zu? (Seite 37)
Bei der Passkontrolle in New York wird Sowtschick barsch zurückgerufen. Ob er den Kreidestrich am Boden nicht sehen könne? Ein bulliger Beamter führt ihn zurück, und da muss er stehen bleiben, bis alle anderen Passagiere an ihm vorbei sind, sogar der „Touristenplebs“ (Seite 52).
Ein Taxi bringt ihn zum Hotel. Er fühlt sich prächtig. Nachdem er seine Reisetaschen ins Zimmer gebracht hat, geht er unternehmungslustig los und verzehrt irgendwo zwei Hamburger mit Mayonnaise. Zurück im Hotel, erbricht er sich, und am nächsten Morgen erreicht er mit Müh und Not das Institut, nicht nur wegen der Vergiftung, sondern auch, weil er dem Taxifahrer als Adresse versehentlich „5th Street“ statt „5th Avenue“ angibt. Der aus Augsburg stammende Institutsdirektor Dr. Heiner Kirregaard kann es kaum fassen, als er von dem Irrtum erfährt.
Und er erzählte von einem Professor, der auf dem Wege zur Columbia-Universität eine Station zu früh die U-Bahn verlassen habe. Mit Klingeldraht erdrosselt sei er aufgefunden worden. (Seite 65)
Da wurde es Sowtschick plötzlich schwarz vor Augen. Er ging in die Knie vor dem Schreibtisch der jungen Dame, die ihn einen Augenblick vermisste. (Seite 64)
Wie Engel um eine Krippe stehen die Sekretärinnen um ihn herum. Den Tag und die folgende Nacht verbringt er auf einer Couch im Institut. Kirregaard bringt ihm schließlich ein Manuskript mit dem Titel „Gleitflug“ und bittet ihn, es während seiner Lesereise zu prüfen. Es sind seine Kindheitserinnerungen, die er aufgeschrieben hat, ohne seiner Frau Gertrude Kirregaard-Fussel etwas davon zu verraten.
Dr. Kirregaard gab eine ziemlich eingehende Inhaltsangabe seiner Kindheit an. Er habe als Kind seine Mutter auf dem Topf urinieren sehen, sagte er, das lasse ihn nicht los, das sei schlechthin das Schlüsselerlebnis seines Lebens … (Seite 75)
Als es Sowtschick am zweiten Tag besser geht, führt ihn eine vom Institut beauftragte Germanistikstudentin namens Jennifer zu den Sehenswürdigkeiten in Manhattan.
Jennifer gab ihm den Rat, auf keinen Fall des Nachts in diesem Park [Central Park] spazieren zu gehen. Sie wies auf die eine Angestellte des Instituts hin, die hier schon mehrmals vergewaltigt worden sei, weil sie es nicht lassen konnte, abends mit dem Fahrrad durch den Park nach Hause zu fahren. Der Körper von blauen Flecken übersät, genäht habe sie werden müssen und so weiter.
Sowtschick sagte: Das verstünde er nicht, man brauche hier doch nur ein paar Polizisten zu postieren.
Da sah ihn Jennifer grade an und sagte: So was mache man vermutlich in Deutschland, hinter jeden Busch einen Polizisten postieren, hier habe man andere Vorstellungen von freiheitlichem Bürgerleben. (Seite 87)
Im Café „Papa Haydn“ legen Jennifer und Sowtschick eine Pause ein.
Eine Gruppe jüdischer Männer in schwarzen Mäntel und Hüten lief am Fenster vorüber. Die schwarzen Mäntel flogen im Wind. Alexander brachte den Fotoapparat in Stellung … Ob es sich bei diesen Menschen um Edelsteinschleifer handelte oder -händler? „Sie wollen diese Leute doch wohl nicht fotografieren?“, fragte die Studentin. „Ist es nicht schon genug, dass in Deutschland Millionen Juden ermordet wurden?“ (Seite 89)
Dr. Kirregaard händigt dem deutschen Schriftsteller schließlich den offiziellen, korrigierten Reiseplan aus und versichert ihm: „Alle freuen sich schon auf Sie.“ (Seite 81)
Am Flughafen in Philadelphia sucht er vergeblich jemand, der gekommen ist, um ihn abzuholen. Nachdem er lange Zeit gewartet hat, nimmt er ein Taxi zur Universität. Dort wendet er sich an eine „überernährte Studentin“, die vor einem Bildschirm sitzt:
„My name is Alexander Sowtschick. I come from Germany, and I’m invited from the German Department for a lectore today at eight o’clock p. m. “ (Seite 118)
Im Veranstaltungsverzeichnis ist für diesen Abend nichts eingetragen. Professor Richmuller, seine Kontaktperson, hat wie alle anderen Mitglieder des Lehrkörpers eine Geheimnummer, damit übermütige Studenten ihn nicht nachts aus dem Bett klingeln können. Schließlich findet sich ein Student, der seinen Doktorvater anruft, von dem er weiß, dass er mit Professor Richmuller befreundet ist. Der telefoniert mit seinem Kollegen und lässt dann ausrichten, der Schriftsteller aus Deutschland möge sich einen Augenblick gedulden, Professor Richmuller komme sofort zum Campus. Um sich die Wartezeit zu verkürzen, isst Sowtschick in der Mensa ein Eis.
Dann war es soweit. Die Tür wurde aufgestoßen, und ein Herr mit Hörgerät und großkariertem Jackett stürzte herein und überschüttete Sowtschick mit Vorwürfen. Wie er dazu kommt zu behaupten, dass er hier ein Meeting hat, er wisse von nichts! Den Namen Sowtschick höre er zum ersten Mal! (Seite 124)
Begleitet wird Richmuller von einer rothaarigen, aus Österreich stammenden Kollegin, die ihn herfuhr, weil er kein Auto besitzt. „Dös kahn jo gor nicht ahngehen“, meint sie (Seite 124). Sowtschick zeigt den beiden den Reiseplan des Deutsch-Amerikanischen Instituts: „Universität Philadelphia 8 p. m. / Prof. Dr. Richmuller“. Richmuller zieht seinen Terminkalender heraus, und da steht nichts von einer Lesung.
Die Österreicherin setzte eine verächtliche Miene auf: ein Deutscher, und noch dazu ein Norddeutscher! Da sieht man’s mal wieder Haben uns in den Krieg hineingezogen, Erster und Zweiter Weltkrieg, von Königgrätz gar nicht zu reden (Seite 125) [Erster Weltkrieg]
Zu spät deckt sie mit ihrem Daumen einen Tag in Richmullers Kalender ab. Sowtschick hat bereits gesehen, dass seine Lesung unter einem falschen Datum eingetragen wurde.
Mit den nagelneuen, von der Dorfsparkasse in Sassenholz eigens besorgten grünen Dollarnoten können die Kassierer in den Hotels nichts anfangen; auch die Reiseschecks der Sassenholzer Raiffeisenkasse weisen sie zurück. Eine Scheckkarte besitzt Sowtschick jedoch nicht. Also bleibt den Hotels am Ende nichts anderes übrig, als die Banknoten zu akzeptieren, aber sie halten jede einzelne davon gegen das Licht.
Bei der nächsten Station wird Sowtschick von seinem Gastgeber Professor Buckrice, dessen Ehefrau Lizzy und den Kindern Joe, Pitt und Ann mit einem VW-Bus vom Airport abgeholt. Nachdem man ihm in Pennsylvania bereits Siedlungen der Amish People gezeigt hatte, fährt Professor Buckrice mit ihm in ein Indianer-Reservat.
Der Professor erklärte ihm mit lauter Stimme das Reservat. Er redete über die danebenstehenden Indianer, als ob die taub wären, und sie waren es wohl auch, denn sie reagierten nicht.
„Alles Taugenichtse, liegen den ganzen Tag auf der faulen Haut. Obwohl sie fischen und jagen gehen könnten wie in alten Zeiten, liegen sie in ihren Hütten und saufen.“ Es sei natürlich wesentlich bequemer, Wohlfahrtsgeld zu kassieren, als zu arbeiten. (Seite 152f)
Am nächsten Tag bringt ihn die Frau des Professors mit einem Jeep in die Berge, zu einer One Room School – wie in Europa. Sowtschicks Begleiterin plaudert herzlich mit der Schulhelferin, die ihnen alles zeigt. Auf der Heimfahrt erzählt sie, dass sie bereits Schritte zur Schließung eingeleitet habe.
Wer könne denn so ein Experiment verantworten? Schmorten da im eigenen Saft. – Die Schulbehörde sei auch der Meinung, dass die Kinder in Far Hill aus der Enge der Verhältnisse wieder erlöst werden müssten. Schließlich lebe man ja nicht mehr im vorigen Jahrhundert. (Seite 172)
Die Herren, die Sowtschick bei seinen Lesungen dem Publikum vorstellen, haben offenbar nur die Klappentexte seiner Bücher gelesen, denn sie weisen übereinstimmend auf die intensiven Bilder hin, die die Prosa dieses deutschen Autors beherrschen und auf die in seltsam spannende Handlungen verpackten spiraligen Erörterungen (Seiten 184, 195). Nach einer Lesung wird Sowtschick gefragt, ob es richtig sei, dass er sich bei seinen Geschichten etwas gedacht habe (Seite 318). Auf den Empfängen prahlen Amerikaner mit einem deutschen Wort, das ihnen geläufig ist: „Blitzkrieg“. Und sie fragen Sowtschick immer wieder, ob er damals in der Partei oder in der Hitlerjugend gewesen sei, und eine Dame möchte von ihm wissen, „wieso sie als Emigrantin ihr Grundstück in Wuppertal nicht zurückerhält“ (Seite 197). Europa kommt zwar in den Nachrichten kaum vor, aber hin und wieder gibt es eine Meldung über die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Dabei weiß kaum jemand, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Ein Militärhistoriker namens Smith ist die Ausnahme, und der weiß auch gleich, wie man die Teilung Deutschlands überwinden könnte.
Dann zeigte Smith auf der Karte, wie man mit ein paar Schnitten der DDR den Garaus machen könnte, beherzt zur Tat schreiten. Ehe die Leute aufwachen, ist schon alles erledigt! (Seite 168)
In Boston vergleicht der Gastgeber in seiner Einführung die aktuellen Vorgänge in Leipzig mit der Boston Tea Party von 1773.
In der ersten Reihe saßen drei Herren. Das waren offensichtlich Professoren […]
Sobald sein Name gefallen war, standen die drei Herren allerdings auf, machten ein Gesicht wie greinende Wasserspeier: Sie hören wohl nicht richtig? Sowtschick? Sie hatten gedacht, Schätzing halte einen Vortrag … Hatte das nicht auf dem Zettel gestanden? Nein, nicht? … Vorige Woche schon? Da hatte man sich also geirrt? Und sie verließen polternd den Saal. (Seite 185)
In Yale spricht Sowtschick den Namen der Elite-Universität wie „jail“ aus und wird sogleich lächelnd darüber aufgeklärt, dass es sich hier nicht um ein Zuchthaus handelt. Nach dem Vortrag verlassen die Zuhörerinnen und Zuhörer das Gebäude. Die Archivarin Elizabeth („Illissebess“) erbarmt sich schließlich des allein zurückgebliebenen Redners und führt ihn zu einem Automaten, um eine Rolle Schokolade zu ziehen, aber das Gerät ist defekt. Sie klärt ihn darüber auf, dass es um diese Zeit nirgendwo mehr etwas zu essen gibt und bietet ihm an, ein paar Spiegeleier für ihn zu braten. Sie wohne gleich um die Ecke. Sowtschick steigt in ihren VW, und nach eineinhalb Stunden Fahrt erreichen sie ihr einsames Häuschen.
Hinter der Wohnungstür hingen dann allerdings lederne Halsbänder und allerlei Peitschen und Würgeketten, das sah Alexander sofort. Um Gottes willen!, dachte er. Das hat mir grade noch gefehlt. (Seite 198)
Aber da trottet ein großer Hund herein.
Die in Washington, D. C., geplante Abendlesung vor großem Publikum wird wegen des „Deutsche-Woche“-Empfangs der Botschaft abgesagt.
In Houston kümmert sich Frau von Rutenigk um ihn, die seit Jahren von ihrem Ehemann, einem höheren Beamten in Bonn, getrennt lebt.
Seine Bücher habe sie natürlich nicht gelesen, sagte sie, ach du lieber Gott! Was hier so an Autoren durchgeschleust werde, da hätte sie ja viel zu tun! (Seite 218)
Frau von Rutenigk erzählt Sowtschick von der Lesung des deutschen Lyrikers Adolf Schätzing vor ein paar Tagen. Da musste man in einen größeren Saal umziehen, und das Publikum war begeistert, „obwohl seine Sachen schwierig und eigentlich gar nicht zu verstehen“ sind (Seite 218). Schon bei seiner Ankunft in New York hat Sowtschick gemerkt, dass dieser dreißig Jahre jüngere Kollege auch gerade durch die USA reist. Offenbar ist der Lyriker, dessen „eiskalte Sachen“ laut Ankündigung seiner Lesungen „voll provozierender Anspielungen“ stecken (Seite 67), Sowtschick ein paar Tage voraus.
In Orlando soll Sowtschick in einem Mädchen-College lesen. Eine Lehrerin empfiehlt dem Gast einen Besuch im Disneypark und drängt ihm ihren kleinen dicken Sohn Olaf als Begleiter auf. Der erbricht schließlich während der Mickymausparade „Hamburger, Eis und Pfannkuchen der Reihe nach“ (Seite 237).
Zwei weiß uniformierte Sanitäterinnen mit Hasenohren und angeklebtem Hasenschnurrbart unter der Nase führten den Jungen von der Straße weg hinter das Gebäude. (Seite 238)
Beim Empfang am Abend gibt es „German sausage with Sauerkraut“. Olafs Mutter zieht Sowtschick mit gedämpfer Stimme ins Vertrauen:
Sie hält es nun nicht länger aus, sie will sich scheiden lassen! Was er dazu sagt? Das hätte er wohl nicht gedacht? […] Die verschiedensten Vergehen ihres Mannes referierte sie, und der Junge hörte sich alles mit an und guckte in die Gegend. Besonders ausführlich wurde geschildert, dass der Mann einen sagenhaften Geschlechtstrieb habe, dass er sie mehrmals am Tag begehrt! Und Alexander wurde gefragt, was er dazu sagt! Kaum lässt sie sich sehen, da kommt er schon an, in der Küche, in der Garage, wo auch immer, und das etliche Male am Tag! Sagenhaft! Von nachts gar nicht zu reden […]
Verschiedene Scheidungsmodelle wurden vor Alexander erklärt, Unterhaltsangelegenheiten und wer den Wagen kriegt. Und so einfach kommt er ihr nicht davon! Den Jungen behält sie natürlich, nicht wahr, Olaf? Du bleibst bei der Mum … (Seite 238f)
Während sie redet und ein Glas Wein nach dem anderen trinkt, rückt sie immer näher an Sowtschick heran. Endlich gelingt es dem erschöpften Gast, sich in sein Hotelzimmer zurückzuziehen. Aber da klopft es. Olafs Mutter hat gerade erst erfahren, dass ihr Sohn sich in Disneyland schlecht benommen habe, und sie wolle sich dafür entschuldigen …
[…] und sie hat noch vergessen, ihm zu sagen, es geht so was Vertrauenserweckendes von ihm aus …“ (Seite 241)
Sowtschick gibt vor, die Wurst sei ihm nicht bekommen und wird sie nach einer Weile endlich los.
In einem der Hotels schlägt die Besitzerin in einem alten Schulatlas die Karte von Ostasien auf und bittet ihren Gast, ihr zu zeigen, wo „Germany“ zu finden ist.
Einmal übernachtet er in einem Hotel auf dem Land und nützt die Gelegenheit, frische Luft zu schnappen.
Er ging den Weg hinunter, und siehe da, es kam ihm ein Polizeiauto entgegengestaubt, hielt an, versperrte ihm den Weg. Was er hier zu suchen hat? Spazieren gehen? Wieso?
Alexander sagte: „My name is Alexander Sowtschick …“, und er zeigte auf das „Yodler“-Hotel, dass er da wohnt. Und dass er hier herumläuft, um sich Bewegung zu machen […]
Er musste seinen Ausweis zeigen, und dabei fielen den Polizisten die Dollarnoten in der Brieftasche auf, Herrgott, das war ja ein Vermögen!
Er musste einsteigen in den warmen, weichen Wagen, und man fuhr ihn die paar Meter hinunter bis zum Hotel.
An der Rezeption bestätigte man es, dass dieser Gentleman ein Gast des Hauses sei, ein deutscher Dichter. Also ein bisschen verrückt. (Seite 253)
Für den Übersetzerkongress in Los Angeles hatten die Veranstalter einen großen Hörsaal reserviert. Da außer Alexander Sowtschick aber nur eine Dame und drei Herren teilnehmen, wird die Besprechung in ein Klubzimmer verlegt.
Zum Schluss wollten sie wissen, diese Polizeisache damals, wegen dem Mädchen da irgendwie, man habe ihn ja wohl gecaptured – ob das noch Folgen gezeitigt hätte? Wenn die Zeitungen hier Wind davon kriegten, weshalb er diese Schwierigkeiten gehabt hätte, werde es kaum möglich sein, die Übersetzung seiner Romane unterzubringen. Mit Mädchensachen seien sie hier sehr etepetete. (Seite 281)
Im Restaurant, wo für dreißig Übersetzer gedeckt ist, muss Sowtschick die Rechnung bezahlen.
Professor Flowers holt Sowtschick vom Flugplatz in Salt Lake City ab.
Flowers fuhr einen betagten Cadillac, gelb, dreihundertsechzig PS, ein Auto nur für besondere Gelegenheiten der saufe so viel Sprit, als ob man die Klospülung angestellt hat, sagte er, fünfunddreißig Liter auf hundert Meilen. (Seite 303)
Flowers, der selbst „member“ ist, zeigt seinem Gast Einrichtungen der Mormonen. Einer der frommen Männer erzählt bei einer Abendgesellschaft von einem Besuch in Hamburg.
In Hamburg hätte er halb nackte Frauen in einem Schaufenster sitzen sehen! Ein Preisschild draußen dran! Ihm stockte die Stimme, und Tränen schossen aus seinen Augen, als er davon berichtete, und manch einer der Gläubigen sah zu Sowtschick hinüber, ob der auch zu denen gehört, die sich Frauen aussuchten wie Semmeln beim Bäcker? (Seite 321)
Zur Abschiedsfeier bei Professor Flowers fährt Sowtschick mit einem Leihwagen. Es ist Halloween, und er fährt langsam an den vielen mit Kerzen beleuchteten Kürbis-Köpfen vorbei. Als er bemerkt, dass ihm ein Polizeiauto folgt, nimmt er den Fuß noch weiter vom Gas und ist erleichtert, als ihn der Streifenwagen überholt. Im nächsten Augenblick wird er zum Halten am Straßenrand aufgefordert. Ein Beamter kommt mit einer Taschenlampe auf ihn zu. Ob er der Kerl sei, der den kleinen Kindern die Candys wegnimmt, die sie wegen Halloween geschenkt kriegen? Rasch erkennen die Polizisten, dass der verschüchterte Deutsche kein Mann von der Sorte ist, die kleinen Kindern Süßigkeiten rauben, und er darf weiterfahren.
Rutherford, ein strohblonder Student, unternimmt mit Sowtschick einen Ausflug von New Mexico nach Mexiko. Als sie dort in einer schmutzigen Kneipe etwas essen, kommt ein vier- oder fünfjähriges Mädchen mit seinem kleinen Bruder zu ihnen an den Tisch und hält ihnen einen Pappdeckel hin, auf dem Kaugummipäckchen liegen. Sowtschick nimmt ein Päckchen, legt Geld in die Schachtel und dann auch die Kaugummis zurück. Das hätte er nicht tun sollen! Die Kinder weinen. Sie fühlen sich beschämt und verhöhnt. Vergeblich versucht er ihnen auf Deutsch zu erklären, dass er es nicht so meinte.
Die Gäste des Cafés nahmen Anteil an diesem Drama, sie selbst hätten zwar kein Kaugummi kaufen wollen, aber dies war nun doch ein starkes Stück: Der Mann dort mit der goldenen Brille hatte die Kinder beleidigt! (Seite 364)
Als Sowtschick und Rutherford mit ihrem für 5 Dollar im Garten einer alten Mexikanerin geparkten VW wegfahren wollen, werden sie von einer aufgebrachten Schar aufgehalten. Die beiden Kinder aus der Kneipe zeigen auf Sowtschick: Der war es! Der hat uns beleidigt! Der blonde amerikanische Student redet auf die Leute ein. Die Situation ist bedrohlich.
In der Ferne zeigten sich Polizisten, die sich aber wegdrehten, sie konnten sich schließlich nicht um alles kümmern. Sie hatten schließlich noch was anderes zu tun. (Seite 365)
Jetzt zu sagen „My name is Alexander Sowtschick, I’m invited …“ hätte wohl keinen Sinn, überlegt der deutsche Schriftsteller. Rutherford hat eine bessere Idee: Er verkündet laut, der Herr neben ihm sei Russe, „el ruso“. Die Wirkung ist verblüffend: Ein Freund des Volkes und der Werktätigen! Wer hätte das gedacht. Die beiden können losfahren. Unterwegs droht ihnen allerdings das Benzin auszugehen: Da hat die Alte während ihrer Abwesenheit wohl ein paar Liter aus dem Tank abgesaugt!
Der holländische Professor Tennhoff lädt Sowtschick zu einer Tour durch die Wüste ein, wobei der Gast allerdings die Spritkosten übernehmen soll. Sie fahren zu zwei benachbarten Gasthäusern mitten in der Wüste: „Ratskeller“ und „Dem Wiener Schnitzel“. Nachdem sie etwas gegessen und getrunken haben, kehren sie zum Auto zurück. Es steht zwar noch im Schatten, aber die Windschutzscheibe ist mit seitenverkehrten Hakenkreuzen beschmiert und die Reifen sind zerstochen.
Tennhoff regte sich furchtbar auf: Er sei doch gar kein Deutscher! Was das denn zu bedeuten habe? Wenn man einem Deutschen die Reifen einsticht, das kann er notfalls noch verstehen. Aber ihm als Holländer? (Seite 380)
Über San Francisco und Chicago geht es zurück nach New York. Bereits während seines ersten Aufenthalts in New York hatte eine Mrs Samson ihm ausrichten lassen, dass sie sich gern mit ihm getroffen hätte. An mehreren Stationen seiner Reise erhielt er die gleiche Botschaft. Nun findet er in New York einen Brief dieser Frau vor. Der beginnt mit den Worten „lieber Alexander“ und endet mit „deine Freddy“.
Bei einem Telefongespräch erzählt Marianne, ihre Freundin Edith Vormhagen habe Fritz-Harry Mergenthaler kurzerhand in Aschaffenburg angerufen. Der Schriftsteller sei sehr nett gewesen und habe zugegeben, dass ihm sein Anwalt die Beleidigungsklage gegen Alexander Sowtschick eingeredet habe.
„Wenn er wieder da ist, gibt er einen aus, und die Sache ist erledigt.“ (Seite 427)
Im Fernsehen sieht Sowtschick in einem kurzen Beitrag, wie die Menschen in Berlin durch die geöffnete Mauer strömen (Wiedervereinigung). Es ist der 9. November 1989. Er öffnet seinen Geldgürtel und will gerade sein Geld zählen, da bricht er tot zusammen.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Die Figur des Schriftstellers Alexander Sowtschick kennen wir bereits aus Walter Kempowskis Roman „Hundstage“ (1988). In „Letzte Grüße“ begegnen wir ihm wieder: Während einer Lesereise durch Nordamerika muss der eitle Autor nicht nur damit leben, dass die Amerikaner seinen Namen wie „Sauschick“ aussprechen, sondern auch ertragen, dass Ellen Butt-Prömse, die Verfasserin von Pferde-Lyrik, bereits da war und der Dichter Adolf Schätzing ihm ständig ein paar Tage voraus ist und offensichtlich mehr Erfolg hat. Das Deutsch-Amerikanischen Institut ist zwar hektisch bemüht, für ein pausenloses Kulturprogramm zu sorgen, aber nicht einmal die Veranstalter selbst haben Sowtschicks Bücher gelesen. Statt Fragen über seine Arbeit als Schriftsteller zu stellen, erkundigen sich Leute, die so gut wie nichts über Deutschland wissen, ob er damals bei der Hitlerjugend gewesen sei. In den Nachrichten ist kaum jemals von Europa die Rede, und über die Montagsdemonstrationen in Leipzig, ja selbst über den Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 (Wiedervereinigung) hört Sowtschick nur kurze Meldungen. Dennoch ist die deutsche Geschichte von 1933 bis 1989 im Hintergrund stets gegenwärtig.
Walter Kempowski lässt in seinem zehnten Roman „Letzte Grüße“ kaum ein Klischee aus, aber er spielt damit ironisch und pointenreich. Selbst vor Kalauern, Running Gags und Slapstick-Szenen schreckt er nicht zurück. Der Aufbau ist bewusst schlicht wie bei einem Reisetagebuch. Das liest sich ausgesprochen leicht und unterhaltsam wie ein Trivialroman, aber „Letzte Grüße“ hat darüber auch eine traurige Dimension, denn Walter Kempowski schildert in diesem Buch die letzten Wochen im Leben eines Schriftstellers, der nicht mehr ernst genommen, sondern nur noch in einen hohlen Kulturbetrieb eingespannt wird.
„Letzte Grüße“ gibt es auch als fast sechsstündiges Hörbuch, gelesen von Peter Franke (Hoffman und Campe, 2004).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2004
Textauszüge: © Albrecht Knaus Verlag
Walter Kempowski (Kurzbiografie)
Walter Kempowski: Tadellöser & Wolff
Walter Kempowski: Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch