Herbert Rosendorfer : Der Meister
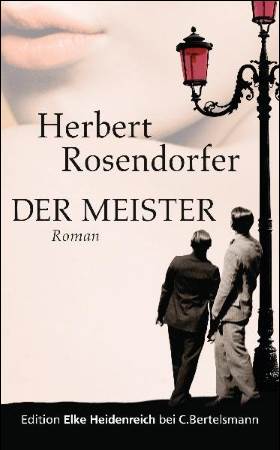
Inhaltsangabe
Kritik
Als R. während eines Venedig-Aufenthalts in dem trotz seiner Nähe zur Rialto-Brücke vorwiegend von Einheimischen besuchten Ristorante La Madonna essen geht, gibt es kaum noch einen freien Stuhl. Der Kellner führt ihn zu einem Zweiertisch, an dem ein einzelner älterer Herr sitzt. Zufällig handelt es sich um einen früheren Kommilitonen R.s, der wegen seiner Italophilie von seinen Freunden Carlone gerufen wurde. Obwohl sich die beiden seit 50 Jahren nur selten – zum Beispiel bei der Beerdigung eines Professors – gesehen haben, erkennen sie sich sofort wieder und beginnen, in Erinnerungen zu schwelgen.
– – –
R. studierte damals in München Jura, besuchte aber nebenbei zwei Jahre lang als Gasthörer Vorlesungen im Musikwissenschaftlichen Institut. Carlones Vater war ein Unternehmer in Bielefeld – er „stellte irgendwelche Waschmittel her, könnte auch sein Zahnpasta oder Schraubverschlüsse“ – und erwartete von seinem Sohn eine Promotion in Chemie. Dass Carlone stattdessen Musik studierte, durfte er zunächst nicht wissen. Irgendwann erfuhr er es und fand sich damit ab, dass sein Erbe nach der Promotion Dramaturg wurde, statt die Firmenleitung zu übernehmen.
In einem Proseminar des Professors Julius Goblitz über Gustav Mahler sahen R. und Carlone sich zum ersten Mal. Goblitz galt als Nestor der Musikologie. Er behauptete, grundsätzlich keine Musik zu hören, weil alles verfälscht werde und es beispielsweise sauber blasende Hornisten nur in der Theorie gebe. Er lese deshalb nur die Noten und erlebe dabei die Musik in reiner Form. Als einmal ein Student bei Goblitz‘ Wohnung vorbeikam, hörte er allerdings die Comedian Harmonists mit „Mein kleiner grüner Kaktus“. Der Professor behauptete, seine Putzfrau habe die Platte aufgelegt, aber wieso er besaß er überhaupt einen Plattenspieler?
R. und Carlone sprechen über eine Exkursion, die Goblitz‘ Hauptassistent Dr. Rosenfeld organisierte, während sein Chef ein Freisemester nahm. Anlass war die Aufführung der Barockoper „La Lunarda ossia Il incesto impedito“ von Tizio Calabassi in einer fränkischen Stadt. Den Nachmittag vor dem Opernbesuch verbrachten die Studenten, Dr. Rosenfeld und der Schweizer Gastprofessor Beat Amtobel im Schwimmbad. Dabei trug die schöne Helene Romberg, die im Hauptfach Germanistik fürs Lehramt studierte, nur ein grünes Höschen, und sie erklärte den erstaunten Männern keck, ihre Brüste seien noch nie eingepfercht gewesen. Nachdem sie ein paar Jahre lang an einem Gymnasium unterrichtet hatte, heiratete sie den Oberregierungsrat Dr. jur. Sigurd Winter und gebar einen Sohn, der auf den Namen Amadeus getauft wurde. Als ihr Mann dann von seinem Ministerium nach Brüssel abgeschoben wurde, blieb Helene mit dem Jungen in Deutschland. Sigurd Winter brach sich schließlich im Rausch das Genick, aber zu diesem Zeitpunkt war die Ehe bereits wegen seiner Sekretärin Blandine Sellebien geschieden.
Carlone erinnert sich, wie die schöne Helene einmal von einer Romreise mit einem Fotografen erzählte. Die beiden fuhren eines morgens so früh nach Tivoli, dass sie als erste an der Kasse der Villa Adriana standen. Helene Romberg trug nichts außer einem leichten Mantel, denn der Künstler wollte sie nackt an historischen Säulen, in Nischen und auf Podesten ablichten. Aber sie wurden von einer japanischen Touristengruppe überrascht. Helene blieb nichts anderes übrig, als möglichst bewegungslos stehenzubleiben, bis alle Japaner die vermeintliche Venus-Statue geknipst hatten und weitergegangen waren.
Nach dem Studium gehörte Carlone einige Zeit zu den freien Mitarbeitern des Kulturmagazins „A“.
Wofür das „A“ stand, wusste niemand. Aber Geld war da. Irgendein Millionär wollte wohl, statt Steuern zu zahlen, investieren.
Als der Chefredakteur Frank Nickol von einer in Oppenhusten im Münsterland geplanten Corrida hörte, schickte er Carlone und zwei weitere Redaktionsmitglieder hin. Um den Tourismus zu fördern, hatte ein in einem Schloss bei Oppenhusten residierender Fürst bereits ein Windhundrennen und ein Akkordeon-Festival veranstaltet. Nun also hatte man auf einer Pferderennbahn eine Arena eingezäunt. Die vom Ansager aufgrund deutscher Tierschutzbestimmungen angekündigte „Modifikation“ des traditionellen spanischen Stierkampfs begann damit, dass statt eines Stiers eine Kuh in die Arena stürmte. Und dieses „Kampftier“ war auch noch an einem langen Strick angebunden. Über den höhnischen Artikel in „A“ darüber beschwerte sich der Fremdenverkehrsverband Oppenhusten u. Umg. e.V., aber die Klageandrohung erreichte die Redaktion erst nach der Einstellung der Kulturzeitschrift.
„Was macht der Göttliche Giselher?“, fragt R. im Ristorante La Madonna. Lachend antwortet Carlone:
„Ja, ach der. Der hat eine reiche Frau geheiratet und tut gar nichts mehr. Nur ab und zu schreibt er für irgendeine elitäre Zeitschrift einen Aufsatz über etwas, wovon er nichts versteht.“
Während der „Göttliche Giselher“ von allem nichts verstand, aber es sich nicht nehmen ließ, lange Vorträge darüber zu halten, wusste Thomas Wibesser tatsächlich alles besser – soweit es nicht das praktische Leben betraf – und trug deshalb den Spitznamen „der Meister“. Sein Hauptfach war Romanistik, und er arbeitete jahrelang an seiner Dissertation über den Verfall und das Ende der okzitanischen Troubadour-Dichtung am Beispiel des Guiraut Riquier. Dabei kam ihm zugute, dass er die französische Sprache besser als die Franzosen beherrschte, was sich zeigte, wenn er Grammatikfehler von Franzosen korrigierte. Sein Perfektionismus verhinderte allerdings auch, dass er mit seiner Dissertation jemals fertig wurde.
Der Meister war der einzige Sohn eines todkrank aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Berufsoffiziers. Dessen Witwe gelang es nur unter beträchtlichen Opfern, den Sohn aufs Gymnasium zu schicken und ihn studieren zu lassen. Aber das verfügbare Geld reichte auch nur für eine Dachkammer.
Deshalb war es ein Glücksfall, dass der reiche Schweizer Dr. Dorpat auf ihn aufmerksam wurde. Der wollte ein Buch über Jean Sibelius schreiben: ein kühnes Unterfangen, denn Theodor W. Adorno, die maßgebliche Autorität nicht nur in der Musikwissenschaft, hatte sich abfällig über den finnischen Komponisten geäußert.
Aber ich brauche Hilfe. Ich bin kein Musikwissenschaftler. Mir fehlt das Handwerkszeug. Also, Sie verstehen, Notenlesen kann ich schon, aber die feinere, die tiefere Terminologie und so fort. Wollen Sie mir helfen? Sie sollen es nicht umsonst tun und auch nicht im geheimen. Ihre Mitarbeit soll auf dem Titelblatt festgehalten werden.
Dr. Dorpat bezahlte dem Meister D-Zug-Fahrkarten erster Klasse und ein Honorar. Aber noch vor der Vollendung des Manuskripts wurde er zum Pflegefall. Als Dr. Dorpat starb, stellte sich heraus, dass er dem Meister nicht nur das Manuskript und alle angesammelten Unterlagen zur freien Verfügung hinterließ, sondern auch ein beträchtliches Legat.
Der Erbe bot das Manuskript dem aufstrebenden Verleger Leipisius an. Der wagte zwar wegen Adornos Meinung keine Veröffentlichung eines Buches über Jean Sibelius, bereitete jedoch gerade ein Musiklexikon vor und bot dem Meister an, dafür Beiträge zu schreiben. Weil nach Zeilen bezahlt wurde, erfand der Meister schließlich einige Komponisten.
Dummerweise stolperte Adriane Bärlocher, eine fleißige Studentin der Musikwissenschaft, in der Musik-Enzyklopädie Leipisius über Thremo Tofandor.
Tofandor, Thremo (eig. Ralf Schlierenzer), geb. 1896 (?) in Bombay als Sohn eines deutschen Konsulatsbeamten und einer Parsenprinzessin, kam ca. 1900, weil sein Vater in die Heimat zurückversetzt wurde, nach Berlin […]
Adriane Bärlocher setzte sich brieflich mit dem Verlag in Verbindung, um mehr über den in keinem anderen Werk erwähnten Musiker herauszufinden, und Leipisius leitete die Anfrage an den Autor weiter. Als die eifrige Studentin ihren ersten Besuch ankündigte, fälschte der Meister noch rasch einen Brief von Thremo Tofandor und bastelte später mit Hilfe des früheren Kommilitonen Carlone auch noch aus einem Klaviertrio von Carl Gottlieb Reißiger die Thremo Tofandor zugeschriebene Violinsonatine „Warum das Pläßhuhn ruft“. Das scharfe S wunderte Adriane Bärlocher zwar, aber sie suchte begeistert nach weiterem Material über Thremo Tofandor und fuhr sogar nach Eppan in Südtirol, wo der Komponist gelebt haben soll. Dort kannte niemand den Namen, aber als sie nach Ralf Schlierenzer fragte, schickte man sie zu einer Adresse. An der Klingel stand „Scheuchenzuber R.“ Die alte Frau, die öffnete, erklärt der Studentin, der Hausherr sei nicht da und komme erst in einigen Monaten wieder; sie passe nur während seiner Abwesenheit auf das Haus auf. Immerhin durfte Adriane Bärlocher ein paar Fotos knipsen.
Mit diesen Aufnahmen illustrierte ihr Doktorvater, Professor Katruse, einen Aufsatz mit dem Titel „Eine Wanderung zu Tofandor“, der in der Neuen Zeitschrift für Musik erschien. Darin schilderte Katruse seinen angeblichen Besuch bei dem zurückgezogen lebenden Komponisten. Den Aufsatz besprach dann der Kollege Professor Mahrgut in einer anderen Zeitschrift.
Frustriert wandte sich Adriane Bärlocher von der Musikwissenschat ab, wechselte zur Ökotrophologie und promovierte über die Geschichte des Semmelknödels.
Inzwischen stand in einer Neuauflage eines Musiklexikons – nicht der Musik-Enzyklopädie Leipisius – zur Verwunderung des Meisters der 30. Juli 1897 als Geburtsdatum des Komponisten Thremo Tofandor.
Ein anderer Student des Professors Katruse, ein Japaner namens Kyomori, dessen Magisterarbeit Thremo Tofandor zum Thema hatte, suchte – wie seine Kommilitonin vor ihm – den Autor des Beitrags über Thremo Tofandor in der Musik-Enzyklopädie Leipisius auf. Dem Meister blieb nichts anderes übrig, als sich weitere Einzelheiten über das Leben des Komponisten auszudenken, zum Beispiel eine schwere psychische Erkrankung in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem erfand er eine Symphonie mit obligater Soloposaune: „Der tote Jadebaum“, op. 72. Als sich Kyomori nach der Partitur erkundigte, behauptete der Meister, die habe Tofandor dem japanischen Botschafter in Berlin geschenkt, und sie sei beim Atombombenangriff auf Hiroshima vernichtet worden. Kyomori suchte dann auch selbst nach Thremo Tofandor, verwechselte jedoch Eppan bzw. Appiano mit Attnang-Puchheim.
Die von Hans Günther Pustknochen verfasste Biografie „Der geheimnisvolle Einsiedler. Thremo Tofandor, sein Leben und Werk“ erschien, und der Meister erhielt den Auftrag, den jüngst aufgetauchten Briefwechsel Tofandors mit Hindemith in den Jahren 1930 bis 1939 herauszugeben. Weil seine Frau Emma Raimer nach zwei Jahren Ehe mit dem Pferdezüchter Attilio durchgebrannt war und den Porsche 911 Carrera mitgenommen hatte, benötigte der Meister Geld und erfand auch gleich noch eine Korrespondenz von Thremo Tofandor und Maurice Ravel. Außerdem stellte ihm Carlone aus von Friedrich Nietzsche komponierten Fragmenten eine „Missa sacra“ für vierstimmigen Chor und Orgel sowie Solovioline von Thremo Tofandor zusammen.
Es war eine mühevolle Arbeit, aber Carlone amüsierte sich so sehr dabei, dass er weder Zeit noch Mühe sparte: Nietzsche sang in der Maske eines Thremo Tofandor, den es nicht gab, in einer katholischen Kirche ad maiorem Dei gloriam – denn die Messe wurde tatsächlich aufgeführt. Bei einem Gottesdienst, zu dem Monsignore Rohrdörfer den gerade in der Stadt weilenden Dalai Lama eingeladen hatte.
Während der Meister übrigens mit seiner eigenen Promotion gescheitert war, hatte Emma Raimer mit einer von ihm verfassten Dissertation promoviert. Dass sie auch durch das Rigorosum kam, verdankte sie ihrer intimen Beziehung mit der „Doktorvaterin“.
Als sie nach kurzem Glück mit dem italienischen Pferdezüchter zu ihrem Ex-Mann zurückkehren wollte, wies dieser sie zurück und drohte, mit der Information, nicht sie, sondern er habe ihre Dissertation geschrieben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Den Beweis, den handschriftlichen Entwurf, habe er aufgehoben.
Zu diesem Zeitpunkt lebte der Meister wieder in einer Dachkammer. Das Haus gehörte einer unter ihm wohnenden, extrem kurzsichtigen Generalswitwe. Bei ihr fragte einmal ein schätzungsweise 70 Jahre alter Herr nach Herrn Dr. Wibesser und stellte sich selbst als Thremo Tofandor vor. Der Meister war nicht zu Hause. Als er von dem Besucher erfuhr, nahm er an, dass sich jemand einen Scherz erlaubt habe. Die Person kam wieder. Schließlich fand die Polizei aufgrund eines anonymen Anrufs den Meister tot in seiner Dachkammer vor. Auf dem Tisch stand eine angebrochene Flasche Portwein, und in einem der beiden Gläser wiesen die Forensiker ein rasch wirkendes Gift nach.
Tofandor – die Suche begann. Die Kriminalpolizei sah sich plötzlich in die Musikwissenschaft verstrickt.
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
überspringen Sie bitte vorerst den Rest der Inhaltsangabe.
Als enger Freund des Toten wurde auch Carlone vernommen. Zwei Kriminalbeamte begleiteten ihn in die Dachwohnung und fragten ihn, ob seiner Meinung nach etwas fehle. Erst später fiel ihm ein, dass das Manuskript der von Emma eingereichten Dissertation nicht mehr da gewesen war. Sie hatte allerdings ein Alibi:
Sie war inzwischen in der Redaktion einer Provinzzeitung in ihrer schwäbischen Halbheimat untergekommen. Sie und ihr neuer Freund, der Juniorchef eines größeren holzverarbeitenden Betriebes, waren zur betreffenden Zeit bei einem Umweltkongress in Ravensburg, über den Emma berichten sollte.
Als Carlone später erfuhr, dass Emma Raimer neben dem Holzfachmann heimlich einen etwa 70 Jahre alten pensionierten Oberstudienrat als Freund hatte, meldete er sich bei der Polizei, aber die hatte den Fall bereits ad acta gelegt und interessierte sich nicht mehr dafür.
– – –
R. und Carlone wechselten inzwischen vom Ristorante La Madonna zum Beccafico am Campo Santo Stefano. Am nächsten Tag verabreden sie sich in der Bar Algiobarò an den Fondamenta Nuove, nahe einer Linienboot-Anlegestelle. Carlone hat nur kurz Zeit für einen „Spritz“, denn er ist bereits auf dem Weg zum Flughafen.
Zufällig treffen sich zwei ältere Herren, die vor Jahrzehnten gemeinsam am Musikwissenschaftlichen Institut in München studierten, in Venedig wieder. Dass Herbert Rosendorfer den Familienname des Ich-Erzählers in „Der Meister“ mit R anfangen lässt, ist wohl kein Zufall. Im Plauderton tauschen die beiden Venedig-Touristen Anekdoten über Professoren, Assistenten und andere Kommilitonen aus („Weißt du noch “).
Die Studenten von damals betrachteten die Universität noch als Bildungschance und nicht nur als Voraussetzung für einen erfolgreichen beruflichen Einstieg. Beispielsweise studierte der Ich-Erzähler Jura – wie der Autor Herbert Rosendorfer – und besuchte nebenher als Gasthörer musikwissenschaftliche Vorlesungen. Ähnlich ist es auch bei den meisten anderen Romanfiguren in „Der Meister“.
Die weitaus größte Zahl der Buchseiten widmet Herbert Rosendorfer der Figur Thomas Wibesser, Spitzname: Der Meister. Dieser ewige Doktorand löst mit einem Lexikonbeitrag über einen fiktiven Komponisten eine Dynamik aus, die er am Ende nicht mehr zu kontrollieren vermag. Zu diesem Musiker Thremo Tofandor gibt es übrigens eine Parallele außerhalb des Romans von Herbert Rosendorfer: Otto Jägermeier (1870 – 1933). Auch den gibt es nicht wirklich, aber sein Name steht in seriösen Lexika. Mit diesem Teil der Geschichte nimmt Herbert Rosendorfer den Wissenschaftsbetrieb am Beispiel der Musik satirisch aufs Korn.
Gekonnt mäandert Herbert Rosendorfer durch die skurrilen Episoden, springt von einem Thema zum anderen, schweift ab, baut Exkurse ein, kommt wieder zurück. Zwischendurch funkeln witzige Einfälle auf, etwa wenn der Ich-Erzähler R. sich fragt, wie Passfotos von Nonnen aussehen („linkes Ohr frei, ohne Kopfbedeckung“). Auch wenn Herbert Rosendorfer mitunter etwas übertreibt, bietet er mit „Der Meister“ ein geistreiches Lesevergnügen.
Den Roman „Der Meister“ von Herbert Rosendorfer gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Gert Heidenreich (Regie: Corinna Zimber, ISBN 978-3-89964-433-3).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2015
Textauszüge: © C. Bertelsmann Verlag
Herbert Rosendorfer (Kurzbiografie)
Herbert Rosendorfer: Briefe an die chinesische Vergangenheit
Herbert Rosendorfer: Die große Umwendung. Neue Briefe an die chinesische Vergangenheit
Herbert Rosendorfer: Die Kellnerin Anni
Herbert Rosendorfer: Der Mann mit den goldenen Ohren



















