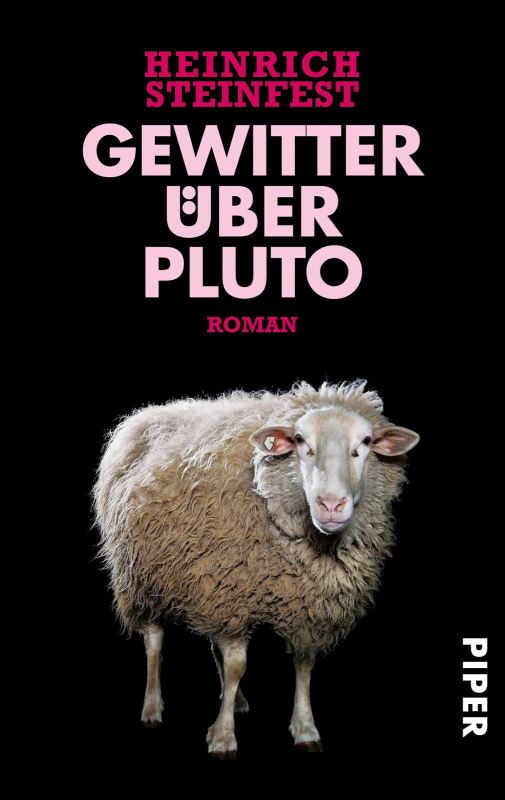Herbert Rosendorfer : Die Kellnerin Anni

Inhaltsangabe
Kritik
Die Kellnerin Anni
Anni arbeitet als Kellnerin in der Gaststätte „Sängerheim“ in München. Weil der Wirt nicht möchte, dass die Bedienungen vor den Gästen rauchen („Eine deutsche Frau raucht nicht!“), zieht sie sich zwischendurch auf eine Zigarettenlänge in eine leere Besenkammer zurück. Das Rauchen sei ihr einziges Laster, beteuert sie.
Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Giselher, als sie Unterhaltszahlungen von ihm bekam und deshalb noch nicht arbeiten musste, hatte sie einen verheirateten Mann als Liebhaber. Der hieß Max.
Man hat natürlich auch als Bedienung ein Intimleben. Obwohl das sehr eingeschränkt ist, sehr eingeschränkt. Gehen Sie einmal um halb zwei in der Nacht weg, nachdem Sie mit größter Mühe die letzten Rauschkugeln hinausgeworfen haben […] (Seite 12)
Er hat mir immer Blumen mitgebracht. Er war schon ein feinerer Mensch, so gesehen. Und Handelsverteter, aber nicht für einen Schund, nein, nein: für eine große Firma, was Fernseher verkauft […] Er war quasi eine Art Verkaufsdirektor dort, jedenfalls war er viel unterwegs, und das war natürlich günstig, ich meine: für mich und für ihn. (Seite 14)
Obwohl Max nur noch dünnes Haar hatte, am Kopf jedenfalls, kam er beim Duschen in ihrer Einzimmerwohnung auf die Idee, sich auch noch rasch die Haare zu waschen. Dabei erwischte er ausgerechnet Annis Hennashampoo.
Quasi wie ein plattertes Eichkatzl hat er ausg’schaut. Und heim hat er auch müssen, zur Alten. (Seite 16)
Sie versuchten, die rote Farbe wieder herauszukriegen – mit normalem Shampoo, Essig, Geschirrspülmittel, Klosettreiniger –; nichts half, und dabei hätte er schon längst zu Hause sein müssen.
Wie soll ein Mensch seiner Frau erklären, dass er zu seinem Freund Reiter Karl fährt, und warum er von da mit rote Haar zurückkommt – erklären Sie das einmal einem Menschen respektive Ehefrau. (Seite 16)
So endete die Affäre.
Am Anfang […] hab ich Rotz und Wasser g’heult, aber mehr aus Zorn, weil ihn jetzt die andere wieder g’habt hat. (Seite 17)
In ihrer Einzimmerwohnung bereitet Anni einen „griechischen Salat“ zu, jedenfalls das, was sie dafür hält und wie sie es von Urban lernte. Das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, seufzt sie. Urban hatte sie in der Frauengruppe kennen gelernt, in die sie nach ihrer Scheidung gegangen war. Weil Urban sich ebenfalls für „die betreffenden Ziele“ einsetzte, wurde er zur „Frau ehrenhalber“ ernannt.
Das war sein Trick. Alle hat er gevögelt. Mich auch. Der Urban. So klein wie er war. Und eine Platten hat er g’habt. Nein: schön war er nicht. Aber natürlich braucht auch so einer partnerschaftliche Zuwendung. Ob er eine Platten hat oder nicht. Aber im Intimbereich war er ganz große Klasse. Kein Vergleich mit meinem Geschiedenen. Er hat – ich will ja nicht ins Detail gehen. Ich kann Ihnen nur sagen, im Vertrauen: Hut ab. (Seite 34f)
Nach einem Treffen in der Frauengruppe flüsterte er Anni zu, sie solle beim Katra-Laden auf ihn warten, dort habe er seinen Mercedes geparkt. Als er kam, hatte er angeblich die Wagenschlüssel vergessen und wollte nicht noch einmal zurück, um kein Aufsehen zu erregen. Also nahmen sie ein Taxi zu Annis Wohnung.
[…] den ganzen nächsten Tag bin ich fast auf alle Viere ‚krochen, so hat er mich … (Seite 36)
Zwei Wochen lang erzählte er ihr immer wieder neue Geschichten, warum er das Auto gerade nicht zur Hand hatte, einmal war es bei der Inspektion, dann ausgeliehen und schließlich behauptete er, es für einen noch schöneren Wagen in Zahlung gegeben zu haben und jetzt die Lieferfrist abwarten zu müssen. Weil angeblich fällige Überweisungen ausblieben, half sie ihm mit Geld aus und hob sogar alles von ihrem Sparbuch ab. Endlich durchschaute sie ihn, aber er hatte „mit seine Händ so Griffe, so gewisse“ (Seite 37) – und da wurde sie immer wieder schwach. Sechs Wochen lang ging das so.
Nach sechs Wochen praktisch ununterbrochen … na ja, Sie wissen. Ich war ja vorher schon längere Zeit Singel und getrennt lebend im Intimbereich. Da staut sich auch bei einer Frau etwas an, auch wenn sie Dame ist. (Seite 38)
War schon ein Hund, der Urban. (Seite 36)
Anni sitzt in der Gaststätte „Sängerheim“ an der Theke und lackiert ihre Fingernägel. Das sieht der Wirt zwar ungern, aber im Augenblick ist ohnehin keiner da. Die sind alle bei der Beerdigung vom Randlsböck Günther. Der war Schuhverkäufer im Geschäft gegenüber. Sobald er zumachen konnte, kam er in die Gaststätte, mischte die Spielkarten und schaute sich nach Partnern um, die mit ihm Schafkopf spielten. Am Ostermontag 1974 hatte er ein „Herz-Solo-Du“. Eine Sensation! Die drei Karten hängen in einem Bilderrahmen an der Wand.
Der Schafkopf war halt sein Leben. Das „Sängerheim“ hier war seine Heimat, gewissermaßen. Ab und zu hat er eine von uns Bedienungen hinten in der Besenkammer … na ja – man hat ja Verständnis für einen so relativ jungen Menschen, dass er gewisse Bedürfnisse hat, auch wenn er an und für sich lieber Schafkopf spielt. (Seite 52)
Auf die Dauer fand Anni die raschen Nummern in der Besenkammer allerdings unbefriedigend.
[…] immer nur in der Besenkammer … das füllt eine Frau auf Dauer erotisch nicht aus.“ (Seite 53)
Dann kaufte eine Ladenkette das Schuhgeschäft und versetzte den Randlsböck Günther nach Köln. Sobald er ein paar Tage frei hatte, kam er wieder nach München in die Gaststätte „Sängerheim“ – bis er entlassen wurde. Bald danach schnitt er sich auf der Herrentoilette im „Sängerheim“ die Pulsadern auf. Wegen der Sauerei erteilte der Wirt ihm ein Lokalverbot. Das war vor einer Woche. Vorgestern hat der Achtundzwanzigjährige sich an einem Baum in den Anlagen aufgehängt.
Zigarettenpause
Anni ist inzwischen achtunddreißig und arbeitslos. Um nicht ständig allein herumzusitzen, unternimmt sie gern Werbefahrten.
[…] also von meinen vielen Verkaufsfahrten her kenne ich das. Da sind auch immer nur – also nur höchstens … sagen wir … also, wenn unter siebzig Weibern zehn Männer sind – und Sie ahnen ja nicht. Da werden Weiber zu Hydranten, wie mein Giselher, also mein ehemaliger Giselher zu sagen ge – pfle – also gesagt hat – weiß schon, zu Hyänen. Schiller: „Glocke“. Zu Hyänen. Und ich sage Ihnen: so alt und zwischen Schlaganfall und scheintot kann eine gar nicht sein, dass sie nicht zur Hyäne wird, wenn einer frei herumläuft. Aber meistens sind’s ja eh schwer verheiratete Ehekrüppel, und die Alte passt auf wie ein Schießhund. (Seite 60)
Jetzt befindet sie sich im Bus auf einer Pilgerreise nach Rom, oder genau gesagt, während einer Zigarettenpause in der Nähe des Busses. Sie raucht allerdings nicht mehr. Einschließlich des Priesters sind sechs Herren dabei.
Anni erinnert sich an frühere Urlaubsreisen.
Ja – und so erweitert der Mensch gastronomisch seinen Horizont: über Calamari bis Campari Orange und – ich weiß nicht mehr genau, wie das geheißen hat: in Frankreich. (Seite 72)
Ihr sportbegeisterter Ex-Mann Giselher hatte auch mal ein Segelboot gekauft, gebraucht, also „längst stapelgelaufen“; das hieß „Biene Maja“ und war auch ungefähr so groß. Damit machten sie einen Segeltörn nach Dalmatien.
Der Segeltörn dann nach Dalmatien: auch das konnte nicht gutgehen. Ich sage nur: Mars und Jupiter in Opposition und mein Giselher Widder letzte Dekade mit Aszendent Stier. Also! Ich hab ihn gewarnt, aber er hat, obwohl sonst astrologisch nicht uneinsichtig, alle Warnungen in den Wind geschlagen. „Mars und Jupiter hin oder her, soll ich dem Chef sagen, ich kann erst Urlaub nehmen, wenn der Jupiter weitergewandert ist?“ Also sind wir gefahren. Die Fahrt mit dem Bootsanhänger nach Rijeka – also, das will ich gar nicht schildern. Wenn es ein Fegfeuer gibt, hab ich alle Stünden, auch die künftigen, allein durch diese Fahrt abgebüßt. Wir haben gar nicht gewusst, dass es hinter Triest so gebirgig ist. (Seite 83)
Wie Anni zu einer Pilgerreise kommt, wo sie doch, als sie noch Kellnerin war, aus der Kirche austrat, um Steuern zu sparen? Frau Marchthaler hat ihr diese Reise geschenkt. Anni besucht die fromme aber schon etwas verkalkte Witwe einmal im Monat „caritativ“ und spielt mit ihr Rommee. Zwei Tage vor Reisebeginn griff die alte Frau aus unerfindlichen Gründen mit ihrem gichtigen Zeigefinger in so einen „eisernen Fußabstreifer, quasi also so ein Gitter“, und konnte dann den rasch anschwellenden Finger nicht mehr herausziehen. Die Feuerwehr musste anrücken und das einbetonierte Gitter mit dem Presslufthammer aus dem Boden holen. Danach war an eine Pilgerreise nicht mehr zu denken; weil sie aber bereits bezahlt war, durfte Anni an Frau Marchthalers Stelle fahren.
Eingegipst in einem Krankenhausbett liegend, erzählt Anni von der Rückfahrt aus Rom. Da berichtete so ein „G’scheitloch“ im Trachtenanzug, der ständig damit prahlte, seit zweiundvierzig Jahren den „Spiegel“ abonniert zu haben, von einem afrikanischen Stamm – den Namen hat Anni inzwischen vergessen, „irgendwelche Tutzi-Wutzi halt“ (Seite 88) –, bei dem alle Jahre einmal die Alten auf die Bäume getrieben werden. Die Jüngeren schütteln dann die Bäume und erschlagen diejenigen, die herunterfallen. Wer sich noch festhalten kann, darf ein Jahr weiterleben bis zum nächsten Schütteln. Der „Spiegel“-Leser hielt das für eine gute Methode zur Vermeidung zu vieler alter Menschen in einer Gesellschaft. Damit löste er im Bus einen Tumult aus, und der Priester hielt dem Mann vor, dass er in seinem Alter auch bereits auf die Bäume müsste. Aber da lachte er bloß, zog sich am Gepäckfach hoch und forderte den Busfahrer auf: „Wackeln S‘ jetzt einmal – fester! Fester!!“ (Seite 89) Nach einer kurzen Fahrt im Zickzack raste der Bus über die Böschung hinunter und stürzte in einen Fluss. Drei Tote. Anni gehört zu den vierzehn Verletzten und muss drei Wochen im Krankenhaus in Miesbach liegen.
Neues Glück
Sieben Jahre später sitzt Anni auf dem Dachgarten des Hotels „Minerva“ in Rom und trinkt einen Campari Orange. Eigentlich nennt sie sich nicht mehr Anni, sondern Frau Konsul Anna M. Frohmund, denn sie hat vor fünf Jahren wieder geheiratet, und zwar den Konsul Karlheinz N. Frohmund. Der ließ sich damals, als sie im Krankenhaus lag, ein Überbein am Fuß wegoperieren, und zwar auch in Miesbach, weil er den Chefarzt vom Rotary-Club her kannte. Zufällig hinkte er an ihrem Zimmer vorbei und schaute durch die offene Tür hinein. Später gestand er, ihr Anblick habe ihn wie der Blitz getroffen. Weil er zu schüchtern war, um sie anzusprechen, ließ er sich vom Chefarzt – Datenschutz hin oder her – ihre Adresse geben und schrieb ihr dann einen Brief. Es sei wie im Märchen gewesen, schwärmt Anni.
Ihr Bopsi ist zwar bereits über sechzig, aber er liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab und ist sehr großzügig.
Schön ist er nicht. Na ja, ich bin auch kein Moddl. Obwohl – ist noch alles vorhanden soweit.
Sie kichert.
Und voll verwendbar. (Seite 95)
Während der Konsul geschäftlich in Rom zu tun hat, geht Anni spazieren und sieht sich in den Geschäften um – Gucci, Ferragamo, Versace, Ferré et cetera –, aber die vielen Japaner beispielsweise auf der Spanischen Treppe stören sie.
Wo du hintrittst, steigst auf einen Japaner. Ich hab ja nichts dagegen … also nicht fremdenfeindlich und so, ich sag auch: mancher Neger ist mir lieber wie ein deutscher Gebrauchtwagenhändler. Aber Japaner! An sich selbstverständlich auch Menschen, wenngleich nicht immer als solche erkennbar – also nicht, dass Sie meinen, ich wäre – von wegen Rassismus und so. Soll jeder Japaner sein, wo will, von mir aus, nur unheimlich viele sind’s. (Seite 97)
Als wir Anni das nächste Mal begegnen, sitzt sie in der Lounge des Hotels „Waldorf Astoria“ in New York und erzählt, dass sie gleich am ersten Tag nach ihrer Ankunft „in der Früh zum Tiffany“ (Seite 101) gingen. Frühstück gebe es dort allerdings nicht, erläutert sie im Scherz.
Während ihr Mann beim Ski-Langlaufen ist und „unschuldige Reh erschreckt“ (Seite 105), wartet Anni in der warmen Halle des „Schlosshotel Mittersill“ auf ihn, denn sportliche Aktivitäten langweilen sie und sie mag die Kälte nicht.
Anni zieht sich in ihrem Zimmer in „Pflaums Posthotel“ in Pegnitz um. Sie besucht nämlich gleich mit ihrem Mann eine „Lohengrin“-Aufführung auf dem „Hügel“ in Bayreuth.
Nach einem geschäftlichen Aufenthalt in San Francisco überrascht der Konsul seine Frau und fliegt mit ihr nicht in westlicher Richtung heim, sondern auf dem Umweg über Hawaii. Jetzt sitzt Anni gerade in der Halle vor dem „Ewigen Feuer“ des Hotels „Vulcano House“ auf Hawaii und schreibt – wie bei all ihren Reisen – ihrem geschiedenen Ehemann Giselher eine Ansichtskarte. Sonst schreibt sie niemand, aber für ihn sucht sie immer Ansichtskarten heraus, auf denen ihr Hotel abgebildet ist. Mit den vielen Karten könnte er seinen windigen Wohnwagen tapezieren. Anni hat gehört, dass er mit seiner neuen Freundin – wie früher mit ihr – zum Campen fährt. Seine zweite Frau ist ihm davongelaufen.
Alt geworden, sitzt Anni in der Halle des Hotels „Bauer Grünwald“ in Venedig. Nachdem ihr Mann gestorben war, fochten seine Kinder aus erster Ehe das Testament an und versuchten, ihren Vater im Nachhinein für schwachsinnig erklären zu lassen. Der zweite Mann seiner ersten Frau, ein Jurist namens Schäpfner, zog das alles auf. Aber Erfolg hatte der damit keinen.
Statt in einer Wohnung lebt Anni in Hotels.
Sie muss ein paar Mal rufen, bis ein Kellner zu ihr kommt und ihre Bestellung eines Glases Champagner entgegennimmt: „Un Tschampann!!“ Unzufrieden mit der Bedienung, zieht Anni in Erwägung, am nächsten Tag vom Hotel „Bauer Grünwald“ ins „Gritti Palace“ umzuziehen. Aber sie fühlt sie jetzt immer so müde.
In sechzehn Monologen erzählt „die Kellnerin Anni“, die schließlich durch Heirat zur „Frau Konsul Anna M. Frohmund“ aufsteigt, aus ihrem Leben. Eingeschoben sind nur Regieanweisungen wie bei einem Theaterstück. Tatsächlich könnte man sich das Ganze gut auf der Bühne vorstellen. Durch ihre Sprache, die sich mit dem gesellschaftlichen Aufstieg ändert, wird die Figur zur lebendigen Person, die wir Leser uns sehr gut vorstellen können. Herbert Rosendorfer versteht es nämlich, seine differenzierten Beobachtungen anderer Menschen in der charakteristischen Sprach- und Denkweise seiner Protagonistin wiederzugeben. In ihren Münchner Dialekt haben sich allerdings Südtiroler Besonderheiten eingeschlichen. Viele Passagen sind komisch und humorvoll, und auch vor Kalauern schreckt Herbert Rosendorfer in seinem unprätentiösen, in drei Teile gegliederten Buch nicht zurück. Nebenbei nimmt er in „Die Kellnerin Anni“ die Auswüchse des Sports und die Hohlheit des gehobenen Gesellschaftslebens, aber auch die ewig Gestrigen und gedankenlose Rassenvorurteile aufs Korn.
Lise Kreuzer liest „Die Kellnerin Anni“ auf zwei CDs (Langen Müller, München 2002).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2004
Textauszüge: © Nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München
Die Seitenangaben beziehen sich auf die dtv-Ausgabe (München, 2004)
Herbert Rosendorfer (Kurzbiografie)
Herbert Rosendorfer: Briefe an die chinesische Vergangenheit
Herbert Rosendorfer: Die große Umwendung. Neue Briefe an die chinesische Vergangenheit
Herbert Rosendorfer: Der Mann mit den goldenen Ohren
Herbert Rosendorfer: Der Meister