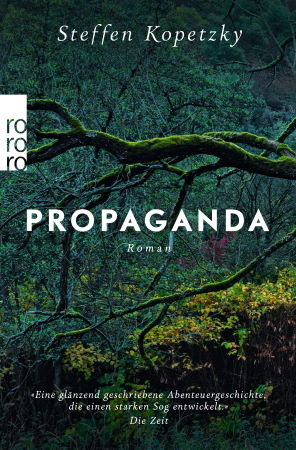Eugen Ruge : Cabo de Gata

Inhaltsangabe
Kritik
Berlin, Anfang der Neunzigerjahre. Ein Jahr nachdem Karolin sich von ihm getrennt hat, sitzt der knapp über 40 Jahre alte Ich-Erzähler in Berlin vor einem Café, das zu DDR-Zeiten eine Kohlenhandlung war. Drei Herren steigen aus einer dunklen Limousine und setzen sich ebenfalls an einen der ohne behördliche Genehmigung aufs Trottoir gestellten Tische. Einer von ihnen spricht mit bayerischem oder österreichischem Akzent von Datenverarbeitung, Marktanteilen, Expansion, Absatz, Vertrieb, Gewinnspannen und Franchising. Da will der Erzähler nur noch weg, nicht nur aus dem Café …
Das war, glaube ich, der Moment, da mir der Gedanke kam, diese Stadt (dieses Land, dieses Leben) bis auf weiteres zu verlassen.
Er kündigt seine Stelle am Institut für Chemietechnik, seine Verträge mit der Telefongesellschaft und dem Energieversorger, verfällt in eine regelrechte Kündigungsmanie, sucht nach Versicherungsverträgen, die er auflösen könnte und erreicht mit der Behauptung, er werde für unbestimmte Zeit im Ausland leben seine Befreiung aus der gesetzlichen Krankenkasse. Nur beim Einwohnermeldeamt stößt er auf Schwierigkeiten: Weil er keine neue Adresse vorlegen kann, ist eine Abmeldung unmöglich.
In der Stadtbibliothek sucht er auf Klimakarten nach einem geeigneten Zufluchtsort.
Je genauer man hinsah, desto mehr verschwamm alles. Natürlich fiel mir an dieser Stelle die Heisenberg’sche Unschärferelation ein, und mir kam der zugegeben eher philosophische als naturwissenschaftliche Gedanke, dass das, was Heisenberg auf der atomaren Ebene beschrieb (nämlich die prinzipielle Unfassbarkeit des Objekts), eine der Materie immanente Eigenschaft sei, die sich folgerichtig, ja zwangsläufig in der sichtbaren Welt fortsetzen müsse. Es war unmöglich, den richtigen Ort zu finden – diese Erkenntnis gefiel mir, ja sie erheiterte mich sogar, statt mich zu erschrecken.
An seine Wohnungstüre hängt er einen Zettel mit der Aufschrift „Schlafsofa zu verschenken“. Daraufhin meldet sich ein lesbisches Paar bei ihm, aber die beiden Frauen lehnen das fleckige Sofa ab und bieten ihm stattdessen 20 Mark für einen schweren Ledersessel, den er bei einem Trödler gekauft hatte. Obwohl er die im Erdgeschoss desselben Hauses wohnenden Punks im Verdacht hat, sein Fahrrad gestohlen zu haben, bietet er ihnen die restlichen Möbel in seiner Wohnung an. Der „verpennte Typ“, der mit nach oben kommt, um sich die Sachen anzuschauen, spricht jedoch von einer Entrümpelung und verlangt Geld dafür. Daraufhin zerlegt der Erzähler den Kleiderschrank und die Regale, bringt die sperrigen Teile zur Berliner Stadtreinigung und stopft die kleineren Sachen in die Müllcontainer. Den Rest deponiert er im Kellerverschlag seines verwitweten Vaters.
Sein Vater hält ihn für einen Versager und hat auch höchstens zwei seiner Radio-Features gehört. Von der Absicht, einen Roman zu schreiben, hat er ihm nichts erzählt, denn darüber würde der 70-Jährige nur spotten. Für bedeutsam hält der alte Mann allerdings die geschichtsphilosophischen Artikel, die er selbst noch immer für Zeitungen schreibt, die allerdings kein Honorar zahlen. Früher war er SED-Mitglied; inzwischen bezieht er eine stattliche Pension von der verhassten West-Republik – und befürchtet ständig eine Kürzung.
In der folgenden Nacht träumt der Erzähler von der Auferstehung seiner rothaarigen Mutter. Sie verlässt den Friedhof, geht nach Hause, hat vor, die Wohnung aufzuräumen, einzukaufen und zu kochen, aber ihr Mann hindert sie daran.
Er habe, argumentiert er, sämtliche Formalitäten erledigt, habe sämtliche ärztlichen Stempel beisammen, auch sei der Platz auf dem Friedhof bereits für 25 Jahre im Voraus bezahlt, und meine Mutter, findet er, könne jetzt nicht erwarten, dass er das alles rückgängig mache (auch ist ihm, ich spüre es, peinlich, all den Leuten, denen er Traueranzeigen geschickt hat, nun anzuzeigen, dass die Sache ein Irrtum gewesen ist). Kurz, er protestiert aufs Schärfste gegen die Auferstehung – und meine Mutter legt sich wieder ins Grab.
Für Silvester wurde der Erzähler von einem Freund zu einer Großparty mehrerer selbstständiger Unternehmer in einer Fabriketage eingeladen, aber nun ruft Karolin unerwartet an und behauptet, ihre Tochter Sarah habe Sehnsucht nach ihm. Sarah weiß noch immer nicht, dass er nicht ihr leiblicher Vater ist. Zu spät begreift er, dass es Karolin nur darum geht, zu einer Silvesterfeier gehen zu können. Er isst mit dem Kind in einer Nordsee-Filiale und geht dann mit Sarah ins Kino.
Am Neujahrsmorgen fährt er mit dem Zug von Berlin nach Basel und von dort weiter nach Barcelona, wo er sich in einem Hostal einquartiert. Nachdem er vergeblich nach dem von Miró entworfenen Mosaik auf den Ramblas gesucht hat, isst er versalzenen Fisch in dunkler Mehlschwitze und umrundet dann die Kirche Sagrada Família von Antoni Gaudí, die er für „eine monströse Kleckerburg“ hält. Die schönen langen Beine einer mit dem Rücken zu ihm stehenden Prostituierten fallen ihm auf, aber statt sie anzusprechen, geht er an ihr vorbei in einen Sexshop und sieht auf dem Bildschirm in einer Videokabine zwei Frauen in bunten Strapsen, die sich am Gemächt eines Esels oder Maultieres zu schaffen machen. Als er wieder draußen ist, sieht er das Gesicht der Prostituierten und stellt fest, dass sie 70 Jahre alt ist.
Während er am nächsten Morgen in einem Straßencafé sitzt, bleibt ein Müllauto mit laufendem Dieselmotor neben ihm stehen, und auf der gegenüberliegenden Seite reißt ein Arbeiter mit einem Pressluftbohrer die Straße auf. Er findet Barcelona so abstoßend, dass er so rasch wie möglich weg will. Beim Blättern in einer Zeitung entdeckt er eine Grafik, aus der hervorgeht, dass es in Cabo de Gata in Andalusien am wärmsten ist.
Dass es sich bei Andalusien um einen geografischen Begriff handelt, wusste er noch gar nicht, er kannte das Wort nur im Zusammenhang mit dem Film „Ein andalusischer Hund“ von Luis Buñuel, den er in einem halb legalen Klubkeller in Ostberlin gesehen hatte und dachte bisher, es bedeute so etwas wie wunderbar oder zauberhaft.
Er nimmt den Nachtbus nach Almería, und steigt dort in einen Bus nach Cabo de Gata.
Ich erinnere mich an regelrechte Müllhalden links und rechts der Landstraße. Bauschutt, zerbrochene Fliesen, Steine, alles schon zugeweht, spärlich überwuchert. […]
Dann […] ein riesiges Schild […]:
PARQUE NACIONAL CABO DE GATA – EL ULTIMO PARAISO DE EUROPA
Der Ort, in dem er aussteigt, kommt ihm wie eine Geisterstadt vor. Es gibt kein Hotel; ein ungeheiztes Zimmer kann er nur im Restaurant an der Promenade mieten. Wenn die Witwe, die das Restaurant betreibt, nicht gesagt hätte, dass erst am nächsten Tag wieder ein Bus nach Almería führe, wäre er sofort abgereist, nach Gibraltar, um von dort nach Afrika überzusetzen. Um sich die Zeit zu vertreiben, sammelt er Muscheln am Strand. In einer findet er einen toten Einsiedlerkrebs. Das versteht er als Zeichen:
Offensichtlich hatte es ihn ans Ufer gespült, und anstatt in dieser Lage sein Haus zu verlassen, hatte er ausgeharrt, bis er darin verdorrt war. Hieß das nun Gehen oder Bleiben?
Er beschließt, in Cabo de Gata zu bleiben und handelt mit der Witwe einen Preis für drei Monate aus. Dann besorgt er sich eine hellere Glühbirne, Kerzen, zehn Schreibhefte und eine Handvoll Stifte, denn er beabsichtigt, mit der Arbeit an einem Roman zu beginnen.
Der erste Satz handelte, wenn ich nicht irre, von kleinen gescheckten Kötern, die alle gleich aussahen. Woran ich mich aber mit Sicherheit erinnere, ist die verbitterte Tonart, die sich, gewissermaßen über Nacht (oder über die Nächte), eingestellt hatte, an den grimmigen Rhythmus, in dem meine allumfassende Enttäuschung ihren Ausdruck fand.
[…] und versuchte, mich wieder auf die grimmig bittere Tonart einzustimmen, die ich zum Vorantreiben der Erzählung benötigte.
Zwischendurch liest er in dem einzigen Buch, das er bei sich hat: „Der Koloss von Maroussi. Eine Reise nach Griechenland“ von Henry Miller.
Alfredo, der älteste der drei Söhne der Witwe, arbeitet wie seine beiden Brüder Carlos und Paco als Fischer. Er ruft dem Gast zu: „Mucho trabajo! Poco pescado!“. Das wird zu ihrer Grußformel: „Mucho trabajo!“ „Poco pescado!“
Nach ungefähr einem Monat trifft ein Engländer mit einem Motorrad ein. Es handelt sich um einen Bergarbeiter, der dem Deutschen schließlich seine Geschichte erzählt: Er hatte geheiratet und ein Reihenhaus für Selbstausbau gekauft, aber dann ließ seine Frau sich von ihm scheiden. Er ging nicht mehr zur Arbeit und saß ein Jahr lang allein herum, bis er vor ein paar Wochen das Haus verkaufte, sich vom Erlös ein Motorrad kaufte und nun damit herumfährt. Der Erzähler sagt, er schreibe einen Roman, und weil der Engländer wissen möchte, von was er handelt, erfindet er schnell eine Geschichte. Daraufhin möchte der Engländer seinen Namen wissen, damit er das Buch später kaufen kann. „Peter Handke“, sagt der Erzähler.
Bald nachdem der Engländer sich verabschiedete und nach Gibraltar weiterfuhr, kommt ein Amerikaner nach Cabo de Gata, der sich für zwei oder drei Jahre als Englischlehrer in Saudi-Arabien verpflichtet hat, gerade Urlaub macht und beabsichtigt, einen Roman zu schreiben. Aber der Amerikaner ist nach kurzer Zeit verschwunden.
Eines Abends folgt dem Erzähler eine rotgetigerte Katze. Allerdings bleibt sie stets in sicherer Entfernung von ihm. Er gibt ihr etwas Käse zu fressen, und am nächsten Abend kommt sie wieder. Aber dann bleibt sie fort, und er sucht vergeblich nach ihr. Bisher hat er noch gar nicht darüber nachgedacht, aber nun fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, dass Cabo de Gata Kap der Katze bedeutet. Erst nachdem er die Suche aufgegeben hat, kehrt sie unerwartet zurück und wagt sich nun auch in sein Zimmer. Da auch seine Mutter rothaarig war, vermutet er in der Begegnung mit der Katze eine Botschaft:
Die Katzenbotschaft in Worten: dass ich vergeblich hier bin. Dass nämlich das, worauf ich hoffe, nicht eintreten wird – und zwar, weil ich darauf hoffe.
War das nicht gerade die Botschaft gewesen? Sie kam nicht, weil ich auf ihr Kommen hoffte. Ich fand sie nicht, weil ich suchte. Es geschah nichts, weil ich immerzu etwas tat. Weil ich immer noch glaubte, ich könnte irgendetwas ausrichten. Weil ich immer noch überzeugt war, irgendetwas hinge von mir ab. Weil ich immer noch hoffte, Erlösung ließe sich erzwingen.
Und obwohl ich mir natürlich nicht ernstlich zu glauben gestatte, das sie meine Mutter ist, kommt mir ein bisschen inzestuös vor, was wir da treiben.
Am 73. Tag seines Aufenthalts in Cabo de Gata zählt er sein restliches Geld und rechnet aus, dass es noch für 73 weitere Tage reicht. Das könne, denkt er, kein Zufall sein.
Er fährt mit dem Bus nach Almería, schläft am Strand im Freien und kehrt am zweiten Tag zu Fuß zurück.
Inzwischen ist die Katze trächtig. Als er versucht, ihren prallen Bauch zu streicheln, kratzt sie ihn und springt aus dem Fenster. Er sorgt sich, dass er sechs Katzenjunge umgebracht haben könnte.
Nachdem er „einhundertdreiundzwanzig Tage lang vergeblich versuchte, einen Roman zu schreiben“, steht die Abreise bevor. Zuletzt geht er noch einmal über den Fischmarkt.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Es [das Bild in seiner Erinnerung] zeigt einen kleinen, offenbar nicht verwertbaren Rochen, der unbeachtet in einem der bunten Kähne liegen geblieben war, und zwar in einer kleinen Meerwasserpfütze, die sich zwischen den hölzernen Rippen am Boden des Bootes gebildet hatte. Die Pfütze war flach, gerade so tief, dass sie den Rochen bedeckte. Seine Bewegungsfreiheit war praktisch gleich null, zum Umdrehen reichte das Wasser nicht aus, und das Tier lag dort mit der falschen Seite nach oben.
[…] nur ein kleiner, zahnloser Mund war zu sehen, der – ungefähr im Rhythmus des menschlichen Herzschlags – nach Luft schnappte.
Dann hörte der Mund plötzlich auf, sich zu bewegen. Nach einigen Sekunden krümmte sich das kleine Tier noch einmal kurz, als versuchte es, sich auf die richtige Seite zu drehen – und starb.
Und, was weiter?
Nichts weiter. Es starb. Und ich packte meine Sachen und stieg in den Vormittagsbus, obwohl die bereits beglichene Wochenmiete den Preis für das Mittagessen beinhaltet hätte.
„Cabo de Gata“ handelt von einem in der DDR aufgewachsenen, inzwischen gut 40 Jahre alten Intellektuellen, der sich in einer Midlife Crisis befindet, die Brücken in Berlin hinter sich abbricht und nach Spanien aufbricht. Dort, in Cabo de Gata, versucht er vergeblich, einen Roman zu schreiben. Er lernt, dass man nichts herbeizwingen kann und nur findet, was man nicht sucht.
„Ich erinnere mich“ sind die ersten drei Wörter des Romans „Cabo de Gata“. Das namenlose Ich erzählt die Geschichte 15 Jahre nach dem Aufenthalt in Cabo de Gata aus der Erinnerung. Inzwischen ist aus ihm ein erfolgreicher Schriftsteller geworden, und wenn er im Flugzeug nach Tokio oder Minneapolis sitzt, benutzt er ein Notebook, um an seinen Texten zu arbeiten. Damals verfügte er nur über Schreibhefte. Immer wieder beteuert der Autor, dass er nichts erfinden und ehrlich sein wolle:
Wie ich den Abend verbrachte, weiß ich nicht mehr.
Wohl aber erinnere ich mich an den nächsten Morgen […]Jetzt ertappe ich mich beim Versuch zu betrügen. In Wahrheit weiß ich nicht mehr, wie es geschah.
Der ständig wiederholte Hinweis darauf, dass es sich um Erinnerungen handelt, wirkt mitunter ermüdend:
Ich erinnere mich, dass der Engländer nach dem Mittagessen unbedingt die Flamingos sehen wollte. Ich erinnere mich an seinen großen Fotoapparat, mit dem er sich, unablässig den Auslöser betätigend, dem Ufer des Flamingo-Sees näherte. Ich erinnere mich, dass ich mich darüber ärgerte, dass er sämtliche Verbotsschilder, die man zum Schutz der Vögel aufgestellt hatte, ignorierte. Aber ich erinnere mich auch daran, dass […]
Ich erinnere mich, dass es sehr still war: das Meer.
Ich erinnere mich, dass Paco in geringer Entfernung vom Ufer in seinem grün-weißen Boot an mir vorbeituckerte – und winkte.
Ich erinnere mich, dass es an diesem Tag Kichererbsensuppe gab.
Ich erinnere mich an das Gefühl völliger Ratlosigkeit […]
Ich erinnere mich aber auch an eine Art Stolz.
Durch die Konstruktion des Romans täuscht Eugen Ruge Authentizität vor. Folgenden Satz hat er „Cabo de Gata“ vorangestellt:
Diese Geschichte habe ich erfunden, um zu erzählen, wie es war.
Eigentlich dürfte nur die Rahmenhandlung im Präsens stehen, aber Eugen Ruge wechselt auch, wenn es um 15 Jahre zurückliegende Ereignisse geht, mehrmals für ein paar Seiten ins Präsens. Er schreibt schlicht, unaufgeregt, lakonisch und erzählt mit unterschwelliger Selbstironie. Auch scheinbar belanglose Details aus dem Alltagsleben werden genau beobachtet und ausführlich beschrieben.
Den Roman „Cabo de Gata“ von Eugen Ruge gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Ulrich Noethen (Regie: Harald Krewer, Berlin 2013, 200 Minuten, ISBN 978-3-8398-1247-1).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2013
Textauszüge: © Rowohlt Verlag
Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts