Patrick Süskind : Die Taube
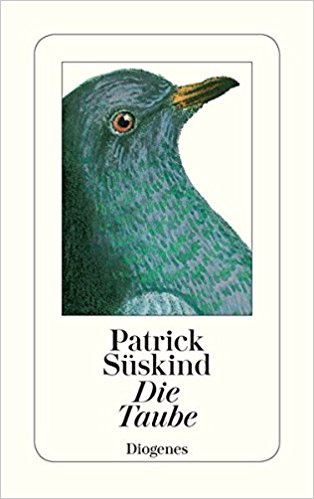
Inhaltsangabe
Kritik
Als ihm die Sache mit der Taube widerfuhr, die seine Existenz von einem Tag zum andern aus den Angeln hob, war Jonathan Noel schon über fünfzig Jahre alt, blickte auf eine wohl zwanzigjährige Zeitspanne von vollkommener Ereignislosigkeit zurück und hätte niemals mehr damit gerechnet, dass ihm überhaupt noch etwas anderes Wesentliches würde widerfahren können als dereinst der Tod. Und das war ihm durchaus recht. Denn er mochte Ereignisse nicht, und er hasste geradezu jene, die das innere Gleichgewicht erschütterten und die äußere Lebensordnung durcheinander brachten. (Seite 5)
Jonathan wuchs in Charenton auf. Als er im Juli 1942 – damals war er noch ein Kind – vom Angeln nach Hause kam, hatte man seine Mutter abgeholt; nur ihre Schürze hing noch über einer Stuhllehne. Man brachte sie zuerst ins Vélodrome d’Hiver, dann ins Lager von Drancy und von dort nach Osten. Von dort kam niemand zurück. Ein paar Tage nach der Mutter verschwand auch der Vater. Jonathan und seine kleine Schwester wurden in einen Zug nach Süden gesetzt und in Cavaillon von einem Onkel abgeholt, den sie noch nie gesehen hatten. Der versteckte sie bis zum Ende des Krieges auf seinem Bauernhof bei Puget im Tal der Durance.
Zu Beginn der Fünfzigerjahre wollte der Onkel, dass Jonathan sich zum Militärdienst meldete. Gehorsam verpflichtete der Junge sich für drei Jahre. Im zweiten Jahr schickte man ihn nach Indochina in den Krieg [Indochina-Krieg], den größten Teil des dritten Jahres verbrachte er mit Schussverletzungen und Amöbenruhr in einem Lazarett. Als er im Frühjahr 1954 wieder nach Puget zurückkehrte, war seine Schwester fort, nach Kanada ausgewandert, wie es hieß. Nun verlangte der Onkel von ihm, dass er Marie Baccouche aus dem Nachbarort Lauris heiratete, und Jonathan fügte sich, obwohl er sie nie zuvor gesehen hatte. Vier Monate nach der Hochzeit brachte Marie einen Jungen zur Welt, und im Herbst brannte sie mit einem tunesischen Obsthändler aus Marseille durch.
Danach traf Jonathan erstmals selbst eine Entscheidung: Er hob seine Ersparnisse ab, fuhr nach Paris und wurde Wachmann bei einer Bank in der Rue de Sèvres. In der sechsten Etage eines Mietshauses in der Rue le la Planche nahm er sich ein Zimmer mit Etagenklo. Inzwischen ist er über fünfzig Jahre alt und könnte sich ein richtiges Apartment mit eigener Toilette leisten, aber Jonathan hat das Zimmer im Lauf der Jahre immer weiter eingerichtet und sich daran gewöhnt. Hier findet er seine Zuflucht.
Durch die vielen Anschaffungen war das Zimmer freilich noch kleiner geworden, es war gleichsam nach innen zugewachsen wie eine Muschel, die zuviel Perlmutt angesetzt hat, und ähnelte mit seinen diversen raffinierten Installationen eher einer Schiffskabine oder einem luxuriösen Schlafwagenabteil als einer einfachen chambre de bonne. (Seite 12)
Mit der Eigentümerin, Madame Lassalle, schloss Jonathan einen Kaufvertrag für das Zimmer. Der Preis beträgt 55 000 Francs. 47 000 Francs hat Jonathan bereits bezahlt; die letzte Rate von 8 000 Francs ist Ende des Jahres fällig. Dann wird das Zimmer ihm gehören.
So stehen die Dinge im August 1984, als ihm die Sache mit der Taube widerfährt.
Jonathan war gerade aufgestanden. Er hatte Pantoffeln und Bademantel angezogen, um wie jeden Morgen vor dem Rasieren das Etagenklo aufzusuchen. Ehe er die Türe öffnete, legte er das Ohr an die Türfüllung und lauschte, ob niemand auf dem Gang sei. Er liebte es nicht, Mitbewohnern zu begegnen, schon gar nicht morgens in Pyjama und Bademantel, und am allerwenigsten auf dem Weg zum Klo. Die Toilette besetzt vorzufinden wäre ihm unangenehm genug gewesen; geradezu peinigend grässlich aber war ihm die Vorstellung, vor der Toilette mit einem anderen Mieter zusammenzutreffen. Ein einziges Mal war ihm das passiert, im Sommer 1959, vor fünfundzwanzig Jahren, und ihn schauderte, wenn er daran zurückdachte: Dies gleichzeitige Erschrecken vor dem Anblick des anderen, der gleichzeitige Verlust von Anonymität bei einem Vorhaben, das durchaus Anonymität erheischte, das gleichzeitige Zurückweichen und wieder Vorangehen, die gleichzeitig gehaspelten Höflichkeiten, bitte nach Ihnen, o nein, nach Ihnen, Monsieur, ich habe es durchaus nicht eilig, nein, Sie zuerst, ich bestehe darauf – und das alles im Pyjama! (Seite 13f)
Zwanzig Zentimeter vor der Türschwelle hockt eine Taube und glotzt Jonathan mit dem linken Auge an. Überall auf dem Boden sind Kleckse von ihr. Zu Tode erschrocken, starrt Jonathan das Tier an. Sein erster Impuls ist, die Taube mit seiner Dienstwaffe zu erschießen, aber dann würde man seine Dienstwaffe einziehen, ihn entlassen und zu einer Haftstrafe verurteilen. Töten kann er die Taube also nicht, aber mit ihr in einem Haus wohnen auch nicht, denn „eine Taube ist der Inbegriff des Chaos und der Anarchie“!
Auf den Korridor wagt Jonathan sich nicht mehr hinaus. Aus Verzweiflung uriniert er ins Waschbecken. Er hätte nicht geglaubt, dass er das fertigbringen würde, aber es geht nicht anders. Um 8.05 Uhr muss er los, damit er um 8.15 Uhr seinen Dienst pünktlich antreten kann. Jetzt ist es 7.15 Uhr. Es bleibt ihm also noch etwas Zeit. Jonathan bereitet sich darauf vor, in eine Pension zu ziehen, packt Rasierzeug, Zahnbürste und Wäsche zum Wechseln ein, Scheckheft und Sparbuch. Das Geld auf dem Girokonto reicht für zwei Wochen in einem billigen Hotel. Wenn die Taube dann immer noch sein Zimmer blockiert, muss er seine Ersparnisse angreifen; davon könnte er notfalls monatelang im Hotel wohnen, denn außerdem erhält er ja auch noch sein Gehalt. Allerdings muss er Ende des Jahres 8 000 Francs an Madama Lassalle bezahlen, obwohl er das Zimmer vielleicht gar nicht mehr bewohnen kann. Vorsorglich steckt Jonathan auch fünf Goldmünzen ein, die er 1958 aus Angst vor der Inflation gekauft hatte.
Im Hinterhof begegnet er der Concierge, die gerade die geleerten Mülltonnen von der Straße heraufbringt. „Guten Tag, Madame Rocard“, sagt er wie an jedem Werktagmorgen seit ihrem Dienstantritt vor zehn Jahren. Wenn sie ihm die Post aushändigt, heißt es: „Danke Madame“. Mehr hat er noch nie mit ihr gesprochen. Immer schon ist es ihm unangenehm, dass er nicht anonym an ihr vorbeikommt. Sie sieht, welche Kleidung er trägt, wie oft er sich die Haare wäscht und ob und von wem er Post erhält. Heute will er seiner Empörung darüber Luft machen, stellt sich ihr in den Weg und spricht sie barsch an: „Madame! Ich habe Ihnen ein Wort zu sagen.“ Dann fährt er fort: „Vor meinem Zimmer befindet sich ein Vogel, Madame. Eine Taube, Madame. Sie sitzt vor meinem Zimmer auf den Fliesen.“ Obwohl er bezweifelt, dass sich die Concierge darum kümmern wird, eilt er weiter.
Mitgenommen von den Ereignissen des Morgens, überhört Jonathan das Surren der Limousine des Bankdirektors Roedel. Erst als der Chauffeur mehrmals ungehalten hupt, eilt Jonathan zum Tor und öffnet es. Diese Nachlässigkeit im Dienst erschreckt ihn zutiefst. Wo wird das hinführen?
Die Mittagspause nutzt er, um sich in einem kleinen, hauptsächlich von Studenten und Gastarbeitern bewohnten Hotel in der Rue Saint-Placide ein Zimmer zu nehmen. Sonst pflegt er mittags nach Hause zu gehen und sich auf der Kochplatte schnell etwas zuzubereiten, ein Omelett, Spiegeleier mit Schinken oder Nudeln mit geriebenem Käse. Heute dagegen kauft er an einem Kiosk zwei Rosinenschnecken und eine Packung Milch. Damit setzt er sich auf eine Anlagenbank. Zwei Bänke weiter verzehrt ein Clochard Sardinen und trinkt Rotwein dazu. Den Clochard hatte er früher wegen seines ungebundenen Lebens beneidet. Dann aber, Mitte der Sechzigerjahre, sah er ihn seine Notdurft zwischen zwei geparkten Autos verrichten. Seither bemitleidet Jonathan den Clochard. Auf keinen Fall möchte er selbst als Clochard enden.
In der Stadt, da half nichts anderes zur Distanzierung der Menschen als ein Verschlag mit gutem Schloss und Riegel. Wer ihn nicht besaß, diesen sicheren Hort für die Notdurft, der war der erbärmlichste und bedauernswerteste aller Menschen, Freiheit hin oder her. (Seite 56)
Weil er die leere Milchpackung achtlos liegengelassen hat, kehrt Jonathan noch einmal zu der Anlagenbank zurück. Als er über die Rückenlehne nach der Packung greift, bleibt er mit der Hose an einer Schraube hängen und reißt sie sich an der Seite ein Stück auf. In Panik hetzt er zu dem „Bon Marché“ in der Nähe, in dem auch eine Änderungsschneiderin arbeitet. Sie wird doch nicht in der Mittagspause sein! Nein, zum Glück sitzt Jeannine Topell an ihrer Nähmaschine. Es sei kein Problem, den zwölf Zentimeter langen Riss zu flicken, meint sie. In drei Wochen könne er die Hose wieder haben. Da kauft Jonathan einen Tesafilm, klebt damit den Riss notdürftig zu und hält während des Dienstes am Nachmittag die Hand darüber.
Nach Dienstschluss läuft er durch die Straßen und den Jardin du Luxembourg. Dann kauft er sich Brot, Sardinen und Rotwein, eine Birne und etwas Ziegenkäse. In seinem Hotelzimmer, dessen Grundriss dem eines Sarges gleicht und das auch kaum größer ist als ein Sarg, zieht er sich einen Stuhl ans Bett, breitet die Sachen darauf aus und isst. „Morgen bringe ich mich um“, denkt er vor dem Einschlafen.
Nachts zieht ein scharfes Gewitter heran. Von einem heftigen Donnern geweckt, schreckt Jonathan am frühen Morgen hoch. Verwirrt glaubt er, noch ein Kind zu sein, im Keller eines Hauses geschlafen und sein Erwachsenenleben nur geträumt zu haben. Dann aber packt er seinen Koffer, schlüpft an dem schlafenden Nachtportier vorbei – bezahlt hat er schon bei der Ankunft – und hüpft wie ein ausgelassenes Kind durch die Regenpfützen. Er kehrt in die Rue le la Planche zurück, geht beklommen die Treppen hinauf, atmet den vertrauten Duft des Kaffees von Madame Lassalle ein und stellt beruhigt fest, dass vor seiner Zimmertür wieder alles in Ordnung ist.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Der Gang war vollkommen leer. Die Taube war verschwunden. Die Kleckse auf dem Boden waren fortgewischt. Kein Federchen, kein Fläumchen mehr, das auf den roten Kacheln zitterte. (Seite 100)
In „Die Taube“ stellt Patrick Süskind einen seltsamen Kauz vor, der jede Veränderung als Bedrohung empfindet, am liebsten anonym und unbeachtet bleibt und Zuflucht in seinem kleinen Zimmer sucht. Schon der Anblick einer Taube auf dem Korridor bringt ihn völlig aus dem Gleichgewicht.
Ist Patrick Süskind ein wenig wie Jonathan Noel? Zumindest meidet er die Öffentlichkeit. In dem Kinofilm „Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“, zu dem Patrick Süskind und der mit ihm befreundete Regisseur Helmut Dietl das Drehbuch schrieben, karikiert der Schriftsteller sich selbst in der Figur des medienscheuen Autors Lutz Windisch, der seine Bücher nicht verfilmen lassen will. Bei der Premiere des Films ließ Patrick Süskind sich nicht sehen, er gibt keine Interviews, lässt sich nicht fotografieren und schirmt sein Privatleben sorgfältig ab.
Bekannt ist nur, dass er 1949 am Starnberger See als Sohn eines Journalisten geboren wurde und zu Beginn der Siebzigerjahre in München Geschichte studierte. Die ersten Erfolge als Schriftsteller hatte er mit den Drehbüchern zu „Kir Royal“ und „Monaco Franze“, die er gemeinsam mit Helmut Dietl schrieb.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2003
Textauszüge: © Diogenes Verlag
Patrick Süskind: Der Kontrabass
Patrick Süskind: Das Parfum
Patrick Süskind: Die Geschichte von Herrn Sommer
Patrick Süskind und Helmut Dietl: Kir Royal (Drehbuch)
Patrick Süskind und Helmut Dietl: Rossini (Drehbuch)
Patrick Süskind und Helmut Dietl: Vom Suchen und Finden der Liebe (Drehbuch)



















