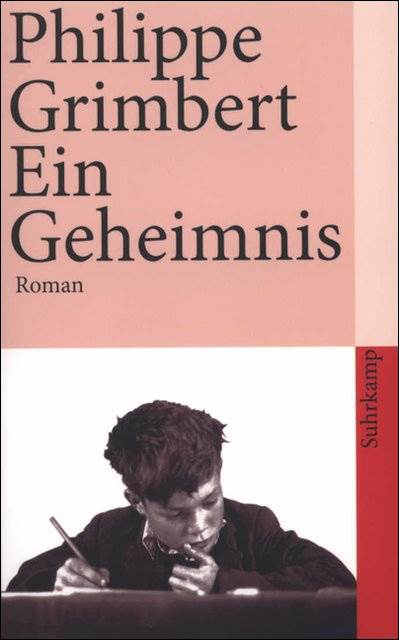Julian Barnes : Flauberts Papagei
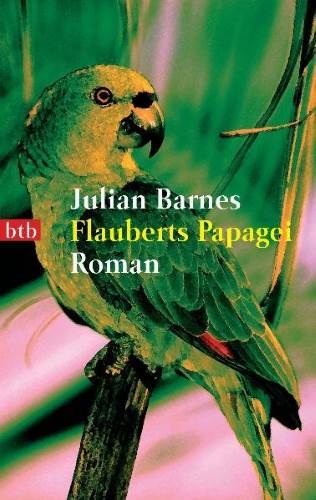
Inhaltsangabe
Kritik
Beim Ich-Erzähler Geoffrey Braithwaite handelt es sich um einen Engländer, der früher als Arzt praktizierte und sich im Ruhestand intensiv mit Gustave Flaubert beschäftigt. In einer Kontaktanzeige würde er sich folgendermaßen beschreiben:
60 + verwitweter Arzt, erwachsene Kinder, aktiv, fröhlich, wenn auch mit Hang zur Melancholie, freundlich, Nichtraucher, Hobby-Flaubert-Gelehrter, mag Lesen, Essen, Reisen zu vertrauten Orten, alte Filme, hat Freundeskreis […]
1940 heiratete er. Die beiden Kinder wurden 1942 bzw. 1946 geboren.
Ellen war um die fünfzig, als ihre Zustände begannen. (Nein, nicht was Sie denken: Sie war immer gesund; ihr Klimakterium verlief rasch, fast beiläufig.) Sie hatte einen Ehemann, Kinder, Liebhaber, einen Job. Die Kinder waren aus dem Haus; der Ehemann blieb stets der gleiche. Sie hatte Freunde und das, was man so Interessen nennt; doch im Unterschied zu mir hatte sie keine blindwütige Verehrung für einen toten Ausländer, die sie in Gang gehalten hätte.
Ellen vergiftete sich 1975. Zwar überlebte sie den Suizidversuch, erwachte aber nicht mehr aus dem Koma. Ihr Mann schaltete schließlich die künstliche Beatmung ab. Daraufhin starb die 55-Jährige [Sterbehilfe].
Vier oder fünf Jahre später fährt Geoffrey Braithwaite innerhalb eines Jahres dreimal mit der Fähre von Newhaven nach Dieppe und sieht sich sowohl in Rouen als auch in Croisset nach Gustave Flauberts Spuren um.
In der Normandie war er 1944 schon einmal als Soldat. Die Deutschen hatten 1941 die Bronzestatue von Gustave Flaubert auf der Place des Carmes in Rouen eingeschmolzen. Inzwischen steht dort eine neue, nach dem Original-Gipsabguss von Leopold Bernstamm (1859 – 1939) angefertigte. Am dritten Tag seines Aufenthalts sieht Braithwaite sich im Hôtel-Dieu de Rouen um, einem früheren Krankenhaus, in dem Gustave Flauberts Vater Achille-Cléophas Flaubert Chefarzt gewesen war. Dort fällt ihm ein ausgestopfter Papagei mit folgender Beschreibung auf:
Von G. Flaubert beim Museum von Rouen entliehener Papagei, der während der Niederschrift von Un cœur simple auf seinem Schreibtisch stand. Dort heißt er Loulou und ist der Papagei von Félicité, der Hauptfigur der Geschichte.“
Braithwaite kennt die Beschreibung des Papageis in der Erzählung „Ein schlichtes Herz“:
Er hieß Loulou. Sein Körper war grün, die Spitzen der Flügel rosa, seine Stirn blau und seine Kehle goldgelb.
Am 28. Juli 1876 schrieb Gustave Flaubert an Mme. Brainne:
Wissen Sie, was seit drei Wochen vor mir auf dem Schreibtisch steht? Ein ausgestopfter Papagei. Der ist da immer auf dem Posten. Sein Anblick beginnt mir auf die Nerven zu gehen. Aber ich behalte ihn, um mein Hirn mit der Idee des Papageientums zu füllen. Zur Zeit schreibe ich nämlich über die Liebe zwischen einem alten Mädchen und einem Papagei.
Drei Wochen lang stand der vom Naturhistorischen Museum in Rouen ausgeliehene Papagei auf Gustav Flauberts Schreibtisch, dann gab er ihn zurück.
Braithwaite fragt sich:
Wie und wann wurde ein einfacher (wenn auch prächtiger) lebendiger Vogel der Jahre nach 1830 umgewandelt in einen komplizierten, transzendenten Papagei des Jahres 1876?
Am letzten Tag seines Aufenthalts in Rouen fährt er nach Croisset und besucht den Pavillon Flaubert. Bei dem Gebäude handelt es sich um die Überreste des Gutshofes, den Achille-Cléophas Flaubert 1844 erworben und sein Sohn 35 Jahre lang bewohnt hatte. In der lieblos zusammengestellten Ausstellung findet Braithwaite einen zweiten hellgrünen Papagei vor. Dabei soll es sich ebenfalls um das Vorbild für Loulou handeln. Welcher der beiden ausgestopften Papageien stand tatsächlich auf Flauberts Schreibtisch? Dieser Frage geht Braithwaite nach.
Zwei Jahre später, im August 1982, kommt er wieder nach Rouen. Im Hôtel-Dieu wird ihm versichert, dass es sich bei dem hier ausgestellten Papagei um den echten handele. Zum Beweis zeigt man ihm einen fotokopierten Auszug aus dem Register des Naturhistorischen Museums mit einer Liste der von Gustave Flaubert ausgeliehenen und zurückgegebenen Exponate. Darunter ist auch der Papagei. Aber im Pavillon Flaubert in Croisset weist man ähnliche Beweisstücke für die Echtheit des dortigen Papageis vor. Geoffrey Braithwaite wendet sich deshalb an Lucien Andrieu, denn 77-jährigen Sekretär der Société des amis de Flaubert in Rouen. Der klärt ihn darüber auf, dass sich der Kustos des Museums in Croisset vor der Eröffnung im Jahr 1905 mit der Bitte um den von Flaubert in der Erzählung „Ein schlichtes Herz“ beschriebenen Papagei an das Naturhistorische Museum in Rouen gewandt habe. Er sei daraufhin in die Reservesammlung geführt worden, und man habe ihn aufgefordert, sich von den etwa 50 Papageien einen auszusuchen. 40 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, tat dies auch der Kustos der Sammlung im Hôtel-Dieu de Rouen. Braithwaite geht ins Naturhistorische Museum. In der Reservesammlung befinden sich inzwischen nur noch drei Papageien.
Es lässt sich also nicht mehr feststellen, welcher Papagei drei Wochen lang auf Gustave Flauberts Schreibtisch stand.
Zwischen den Aufenthalten in Rouen und Croisset lernte Geoffrey Braithwaite in London den Amerikaner Ed Winterton kennen, der sich auf den Schriftsteller Gosse spezialisiert hatte. Ein Jahr später kam Winterton noch einmal nach London. Weil er wegen seiner obsessiven Beschäftigung mit Gosse alles andere vernachlässigt hatte, war er jetzt arbeitslos. Ein halbes Jahr vor seinem erneuten Treffen mit Braithwaite hatte er eine Nachfahrin Gosses besucht. Das Gespräch erbrachte zwar keine neuen Erkenntnisse über Gosse, aber die Engländern besaß Briefe von Juliet Herbert, der Gouvernante, die Gustave Flaubert um 1855 für seine Nichte Caroline angestellt hatte. Das Konvolut der 75 Briefe hatte Gosse einer Cousine Juliet Herberts für ein Tausendstel des Wertes abgekauft. Es lagen auch Fotos bei. Ob die Korrespondenz beweise, dass Gustave Flaubert und Juliet Herbert eine Affäre hatten, fragt Braithwaite neugierig. Winterton bejaht es. Braithwaite kann es kaum erwarten, sich mit den Briefen zu beschäftigen. Aber Winterton klärt ihn darüber auf, dass Flaubert in einem seiner letzten Briefe angeordnet habe, die Korrespondenz zu verbrennen. Diesem Wunsch sei er nachgekommen, sagt Winterton zum Entsetzen Braithwaites.
Wie also fassen wir die Vergangenheit? Wird ihr Bild mit wachsender Entfernung schärfer? […] Ich weiß nicht so recht.
Braithwaite bezweifelt, dass sich ein zuverlässiges Bild der Vergangenheit gewinnen lässt.
Lange Zeit nahm man an, Gustave Flaubert sei lediglich mit Louise Colet intim gewesen. Dann entdeckte man jedoch sein Verhältnis mit Élisa Schlesinger. Seinen Ägyptischen Tagebücher ist zu entnehmen, dass er es mit Badehausjungen in Kairo trieb, und eine besondere Beziehung zu Louis Bouilhet kam dazu. Aber Jean-Paul Sartre, der sich 15 Jahre lang intensiv mit Gustave Flauberts Biografie beschäftigte und eine auf 4000 Seiten in vier Bänden angelegte Studie mit dem Titel „L’Idiot de la famille“ plante, von der allerdings nur die erste Hälfte fertig wurde, zeigt sich in seiner Darstellung überzeugt davon, dass Flaubert nicht bi- bzw. homosexuell gewesen sei.
Gustave Flaubert hasste die Eisenbahn, aber die am 9. Mai 1843 in Betrieb genommene Strecke Paris – Rouen war für ihn und Louise Colet nützlich. Er wohnte in Croisset, sie in Paris, und sie trafen sich ab September 1846 auf halber Strecke in Mantes-la-Jolie. Die Fahrt dorthin dauerte zwei Stunden statt eines ganzen Tages, wie zuvor mit der Postkutsche.
In einem Kapitel des Romans „Flauberts Papagei“ lässt Julian Barnes Gustave Flauberts Geliebte Louise Colet zu Wort kommen. Sie besteht darauf, ihre Version der Geschichte zu erzählen. Dabei weist sie darauf hin, dass sie am 15. September 1810 geboren wurde, acht Tage vor Élisa Schlesinger. Louise Colet beschuldigt Gustave Flaubert, damit geprahlt zu haben, dass ihn eine Fünf-Sous-Kurtisane in Ägypten mit einer Geschlechtskrankheit infizierte.
Geoffrey Braithwaite zählt die in Croisset gehaltenen Haustiere auf und beschreibt die Tiere in Flauberts „Bestiarium“, zum Beispiel: Bär („Flohbär“), Kamel, Affe, Esel, Papagei, Hund. 1847 habe Gustav Flaubert in einer Schaubude auf dem Jahrmarkt in Guérande nordwestlich von St. Nazaire ein fünfbeiniges Schaf mit trompetenförmigem Schwanz entdeckt, berichtet Braithwaite, und sei davon schwer beeindruckt gewesen.
In Zusammenhang mit Flauberts „Bestiarium“ fasst er den Inhalt der Fabel „Der Bär und der Gartenliebhaber“ von Jean de La Fontaine zusammen: Ein Bär gesellt sich zu einem Einsiedler und vertreibt die Fliegen vom Gesicht des einsamen Gärtners, wenn dieser schläft. Als sich eines Tages eine Fliege nicht verjagen lässt, nimmt der dumme Bär einen Pflasterstein zu Hilfe. Damit erschlägt er die Fliege, aber auch den Mann, den er beschützen wollte.
Auch in „Madame Bovary“ werden Bären erwähnt:
Das menschliche Wort ist wie ein gesprungener Kessel, auf dem wir Melodien trommeln, nach denen Bären tanzen können, während wir doch die Sterne rühren möchten.
Am 20. Juni 1863 berichtete die Zeitung „L’Opinion nationale“ von dem Misanthropen Henri K. in Gérouville bei Arlon, der nur einen Papagei in seiner Nähe geduldet und sich nach dessen Tod selbst für einen Papagei gehalten hatte. Deshalb war er von seinen Angehörigen in das Maison de santé in Gheel eingeliefert worden.
Braithwaite zitiert außerdem, was Gustave Flaubert vor „Ein schlichtes Herz“ über Papageien geschrieben hatte:
Als er Louise die Anziehungskraft fremder Länder erklärt (11. Dezember 1846), schreibt Gustave: „Als Kinder wollen wir alle im Land der Papageien und kandierten Datteln leben.“ Als er eine traurige und mutlose Louise tröstet (27. März 1853), erinnert er sie daran, dass wir alle Käfigvögel sind und dass das Leben auf jenen mit den größten Flügeln am schwersten lastet: „Wir alle sind mehr oder weniger Adler oder Kanarienvögel, Papageien oder Geier.“ Als er Louise gegenüber bestreitet, dass er eitel sei (9. Dezember 1852), unterscheidet er zwischen Stolz und Eitelkeit: „Der Stolz ist ein wildes Tier, das in Höhlen haust und in der Wüste; die Eitelkeit hingegen hüpft wie ein Papagei von Ast zu Ast und plappert im hellen Sonnenschein daher.“ Als er Louise die heroische Suche nach dem Stil anhand von Madame Bovary darstellt (19. Juni 1852), erklärt er: „Wie oft bin ich nicht flach aufs Gesicht gefallen, gerade als ich glaubte, ihn greifen zu können. Dennoch habe ich das Gefühl, nicht sterben zu dürfen, ohne den Stil, den ich in meinem Kopf höre, aufbrüllen zu lassen, einen Stil, der die Stimmen der Papageien und Zikaden sehr wohl übertönen dürfte.“ […]
Auf 14 Seiten zählt Braithwaite die „Delikte“ Gustave Flauberts auf und nimmt dazu Stellung.
1. Er hat die Menschheit gehasst. […]
2. Er hat die Demokratie gehasst. […]
3. Er hat nicht an den Fortschritt geglaubt. […]
4. Er hat sich nicht genügend für Politik interessiert. […]
5. Er war gegen die Commune. […]
6. Er war unpatriotisch. […]
7. Er hat in der Wüste Tiere geschossen. […]
8. Er hat nicht am Leben teilgenommen. […]
9. Er war Pessimist. […]
10. Er vermittelt keine positiven Werte. […]
11. Er war ein Sadist. […]
12. Er war Frauen gegenüber gemein. […]
13. Er glaubte an die Schönheit. […]
14. Er war stilbesessen. […]
15. Er glaubte nicht an einen gesellschaftlichen Zweck der Kunst. […]
Die irische Literaturwissenschaftlerin Enid Starkie (1897 – 1970), die an der University of Oxford französische Literatur lehrte und 1967 eine Biografie über Gustave Flaubert veröffentlichte („Gustave Flaubert. Kindheit, Lehrzeit, frühe Meisterschaft“), bemängelte, dass der Schriftsteller in seinem Roman „Madame Bovary“ die Augenfarbe der Titelfigur abwechselnd als braun, tiefschwarz und blau beschreibt. Diese Kritik findet Geoffrey Braithwaite lächerlich. Seiner Meinung nach beziehen sich die verschiedenen Angaben Flauberts auf Emma Bovarys Aussehen bei unterschiedlichem Lichteinfall.
Andererseits nimmt er es selbst sehr genau, wenn er schreibt:
1853 sah er [Gustave Flaubert] in Trouville die Sonne über dem Meer versinken und erklärte, sie gleiche einer großen Scheibe aus Johannisbeerkonfitüre. Sehr anschaulich. Aber hatte Johannisbeerkonfitüre 1853 in der Normandie dieselbe Farbe wie heute?
Geoffrey Braithwaite beschäftigt sich mit der Frage, was einen guten Roman ausmacht.
Wäre ich ein Diktator der Romanliteratur, ich würde Zufälle verbieten.
Seiner Meinung nach sollten bestimmte Arten von Romanen verboten werden:
1. Es soll keine Romane mehr geben, in denen eine Gruppe von Menschen durch äußere Umstände isoliert wird, worauf ihre Mitglieder in den ‚Urzustand‘ zurückfallen […]
2. Es soll keine Romane mehr geben über Inzest. […]
3. Keine Romane, die in Schlachthäusern spielen. […]
4. Erlassen wir ein 20-Jahres-Verbot für Romane, die in Oxford und Cambridge spielen. […]
5. Es wird ein Quotensystem eingeführt für erzählende Literatur, die in Südamerika spielt. […]
6. a) Keine Szenen, in denen eine geschlechtliche Vereinigung zwischen einem Menschen und einem Tier stattfindet. […]
b) Keine Szenen, in denen eine geschlechtliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau […] in der Dusche stattfindet. […]
7. Keine Romane über kleine, bislang vergessene Kriege in entlegenen Teilen des British Empire […]
8. Keine Romane, in denen der Erzähler oder irgendeine der Personen nur durch eine Initiale ausgewiesen ist. […]
9. Es soll keine Romane mehr geben, die eigentlich von anderen Romanen handeln. […]
10. Es soll ein 20-Jahres-Verbot für Gott geben […]Man soll die direkten, schlichten, wahren Wörter gebrauchen. Tot sage ich, und im Sterben und verrückt und Ehebruch. Ich sage nicht verblichen oder dem Ende zugehen oder Endstation […] oder Persönlichkeitsstörung oder rummachen, nebenrausgehen, na ja, sie geht in letzter Zeit oft ihre Schwester besuchen. Ich sage verrückt und Ehebruch, so nenne ich das.
Braithwaite propagiert die Idee, das Endes eines Romans dem Leser zu überlassen:
Hinten im Buch befände sich ein Päckchen verschiedenfarbiger, verschlossener Umschläge. jeder davon trüge eine eindeutige Aufschrift: Traditioneller Glücklicher Schluss; Traditioneller Unglücklicher Schluss; Traditioneller Halbe-Halbe-Schluss; Deus ex Machina; Modernistisch Willkürlicher Schluss; Weltuntergangs-Schluss; Spannender Fortsetzungsroman-Schluss; Traum-Schluss; Undurchsichtiger Schluss; Surrealer Schluss; und so weiter. Man dürfte nur einen Umschlag nehmen, und die anderen, die man nicht ausgewählt hat, müsste man vernichten. Das hieße für mich, dem Leser die Wahl lassen zwischen verschiedenen Schlüssen; aber vielleicht finden Sie ja, ich nehme die Dinge allzu wörtlich.
In einem Kapitel zitiert Geoffrey Braithwaite aus seinem „Wörterbuch der übernommenen Ideen“. Über Ironie heißt es da:
Der moderne Modus: entweder ein Teufelsmal oder der Schnorchel geistiger Gesundheit.
Und zum Stichwort „Prostituierte“ schreibt Braithwaite:
Im neunzehnten Jahrhundert notwendig zur Erwerbung von Syphilis, ohne die kein Anspruch auf Genialität erhoben werden konnte.
Julian Barnes‘ Alter Ego Geoffrey Braithwaite fragt:
Warum können wir ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Warum reichen die Bücher nicht?
Aber er beschäftigt sich selbst obsessiv mit Einzelheiten der Biografie Gustave Flauberts. Wer erwartet, in „Flauberts Papagei“ viel über den französischen Schriftsteller zu erfahren, wird enttäuscht sein. Ebenso wenig kann „Flauberts Papagei“ Lesern gefallen, die von einem Roman eine Handlung mit einer sich entwickelnden Figur erwarten, denn eine solche gibt es allenfalls rudimentär: Ein skurriler englischer Arzt im Ruhestand fährt mehrmals nach Rouen und Croisset, um der Frage nachzugehen, welcher der beiden dort ausgestellten Papageien drei Wochen lang auf Flauberts Schreibtisch stand. Ansonsten besteht „Flauberts Papagei“ aus einem Kaleidoskop von Gedanken und Aufzählungen, Anekdoten und Anspielungen, Abschweifungen, Zitaten und Inhaltsangaben. Einige Überlegungen finde ich durchaus geistreich, einige Formulierungen pointiert, aber die meisten sind trivial, und Julian Barnes‘ Witz bzw. Satire fehlt es meines Erachtens an Esprit.
Falls Julian Barnes versucht hätte, Gustave Flaubert zu porträtieren, wäre dieser Versuch ohnehin zum Scheitern verurteilt gewesen – so kann man „Flauberts Papagei“ interpretieren. Der „echte“ Gustave Flaubert lässt sich ebenso wenig finden wie der authentische Papagei. Die Wahrnehmung einer anderen Person bleibt immer subjektiv. Das veranschaulicht Julian Barnes in „Flauberts Papagei“ nicht nur durch den Hinweis auf die wechselnde Augenfarbe Emma Bovarys, sondern vor allem, indem er drei tabellarische Chroniken zu Gustav Flauberts Leben zusammenstellt: eine über die Erfolge, eine zweite über Fehlschläge, Krankheiten und Todesfälle sowie eine dritte mit Flaubert-Zitaten.
Der Ich-Erzähler Geoffrey Braithwaite – bei dem es sich um eine fiktive Figur handelt – spricht den Leser immer wieder direkt an und tut auch so, als sei dieser mit ihm auf der Kanalfähre. Mehrmals entschuldigt er sich für seine Abschweifungen:
Noch so eine lange Abschweifung, deren Ton moralischer Entrüstung wahrscheinlich das Gegenteil bewirkt. Und dabei wollte ich doch über die Papageien schreiben.
Hier sind noch ein paar Beispiele mehr oder weniger gelungener Formulierungen aus „Flauberts Papagei“:
Man könnte sagen, der Papagei, die Verkörperung geschickter Lauterzeugung ohne viel Hirn, sei das reine Wort.
Sie fragt sich, ob der üblicherweise als Taube dargestellte Heilige Geist nicht besser als Papagei porträtiert werden sollte. Die Logik ist gewiss auf ihrer Seite: Papageien und Heilige Geiste können sprechen, Tauben hingegen nicht.
Für den religiösen Menschen zerstört der Tod den Körper und befreit den Geist; für den Künstler zerstört der Tod die Persönlichkeit und befreit das Werk.
Wenn der schönste Moment im Leben ein Bordellbesuch ist, der nicht zustande kommt, dann ist der schönste Moment beim Schreiben vielleicht das Auftauchen der Idee zu einem Buch, das nie geschrieben werden muss, das verschont bleibt vom Makel einer definitiven Form, das sich nie einem weniger liebevollen Blick als dem seines Autors auszusetzen braucht.
Die Form ist kein über das Fleisch des Gedankens geworfener Mantel (ein alter Vergleich, alt schon zu Flauberts Zeit); sie ist das Fleisch des Gedankens selbst. Eine Idee ohne Form kann man sich genauso wenig vorstellen wie eine Form ohne Idee.
In den Büchern werden die Dinge erklärt; im Leben nicht. Es überrascht mich nicht, dass manche Leute Bücher vorziehen. Bücher verleihen dem Leben einen Sinn. Das Problem dabei ist nur, dass die leben, denen sie Sinn verleihen, die Leben anderer Leute sind, niemals das eigene.
Für die einen ist das Leben üppig und sahnig, nach einem alten Bauernrezept und nur aus natürlichen Produkten hergestellt, die Kunst hingegen blässliches, fabrikmäßig hergestelltes Konfekt, zur Hauptsache aus künstlichen Farb- und Aromastoffen bestehend. Für die anderen ist die Kunst das Echtere, prall, pulsierend und emotional befriedigend, wohingegen das Leben schlimmer als der dürftigste Roman ist: ohne Handlung, bevölkert mit Langweilern und Gaunern, arm an Witz, dafür umso reicher an unerfreulichen Ereignissen, und mit einer Auflösung von schmerzhafter Voraussehbarkeit.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2013
Textauszüge: © Verlag Kiepenheuer & Witsch
Gustave Flaubert (Biografie)
Julian Barnes: Vom Ende einer Geschichte
Julian Barnes: Lebensstufen
Julian Barnes: Der Lärm der Zeit
Julian Barnes: Die einzige Geschichte