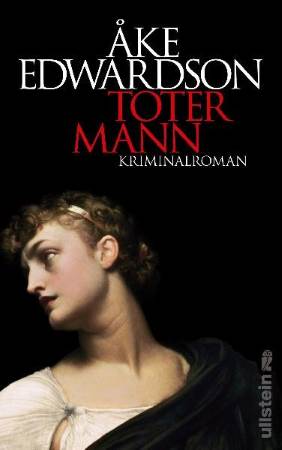Daniel Kehlmann : Der fernste Ort
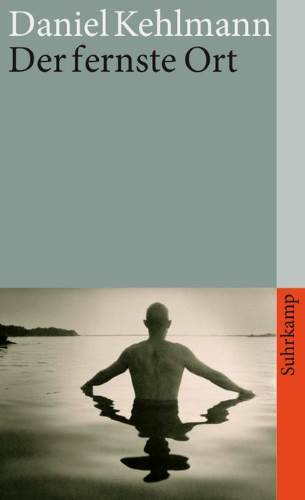
Inhaltsangabe
Kritik
Der Versicherungsmathematiker Julian, der von Wöllner, seinem Vorgesetzten, mit zu einer Tagung in einem Hotel in Italien genommen wurde, soll in zwei Stunden einen Vortrag über Elektronische Medien in der Risikokalkulation halten, aber er ist überhaupt noch nicht vorbereitet. Statt sich endlich Gedanken darüber zu machen, was er sagen soll, geht Julian trotz der Warnung des Portiers vor gefährlichen Strömungen im nahen See schwimmen. Er ist allein. Nachdem er seine Kleidung abgelegt und seine Badehose angezogen hat, schwimmt er hinaus. Plötzlich wird ihm bewusst, dass er das Ufer nicht mehr sieht und sich offenbar in der Mitte des Sees befindet. Angestrengt bemüht er sich, keinen Krampf in den Beinen oder Armen zu kriegen, aber er droht zu ertrinken.
Ein Schwarm wirbelnder Flecken, Fische vielleicht oder auch Blätter, die geraden Lichtstrahlen, ein Würfel aus Metall, ein weggeworfener Kühlschrank, dessen Tür offenstand, überzogen mit Rost. (Seite 18)
Am Ufer kommt er wieder zu sich.
Er wusste noch, dass die Strömung ihn hinuntergezogen und dass er gekämpft und dann aufgehört hatte zu kämpfen; und da tauchten Bilder vor ihm auf, Bruchstücke von Erinnerungen, er wusste nicht, woher. (Seite 20)
Julian hebt seine Kleidung auf, und weil er längst am Rednerpult stehen müsste, schleicht er sich durch den Hintereingang ins Hotel und gelangt unbemerkt in sein Zimmer. Dort zieht er Hose, Hemd und Pullover an, verzichtet auf das Jackett, entnimmt seiner Brieftasche nur zwei Geldscheine, die für eine Bahnfahrkarte reichen müssten. Die Brieftasche, den Pass, Uhr und Brille lässt er liegen, und auf dem Weg zum Bahnhof wirft er die nasse Badehose in einen Abfallbehälter.
Mit elf Jahren war Julian zum ersten Mal weggelaufen, und zwar während des Mittagessens, als seine Mutter nebenan telefoniert hatte. Er ging zum Bahnhof und setzte sich in den nächsten Zug. Als der Schaffner kam, bezahlte ein dicker Herr eine Fahrkarte für ihn. Julian stieg bei der übernächsten Station aus und trieb sich in einen Park herum. Als ihm ein Polizist die Hand auf die Schulter legte und nach seinem Namen fragte, nannte er ihn und ließ sich nach Hause bringen.
Julian stand immer im Schatten seines älteren Bruders Paul; der Vater schrie, die Mutter war zerstreut. Sein Mitschüler Peter Bohlberg hänselte ihn, riss ihm die Schultasche weg oder zerbrach ihm mit einem gut gezielten Ballwurf die Brille. Während Paul ohne besondere Anstrengung hervorragende Schulzeugnisse erhielt, war Julian kein guter Schüler und schaffte den Abschluss nur mit Hilfe seines Bruders. Dann studierte er Mathematik, ohne sich dafür zu interessieren. Nach einem Referat über Veterings Kommentar zu Pascals Gesetz der großen Zahl bot ihm Professor Kronensäuler eine Promotion über den niederländischen Denker Jerouen Vetering an, der mit ausgebreiteten Armen aus einem Fenster im obersten Stockwerk seines Hauses sprang, um zu beweisen, dass er ein freier Mensch war. Statt zu fliegen, starb er beim Aufprall auf dem Straßenpflaster.
In dieser Zeit schrieb er [Jerouen Vetering] eine lateinische Abhandlung Per Spaeculum, eine Schrift, deren Eleganz und scheinbare Klarheit auf das seltsamste dem offensichtlichen Wahnsinn ihres Verfassers widersprach, der etwa behauptete, dass ein Sterbender noch tagelang durch die allmählich unwirklicher werdende Welt seiner Einbildungen irren könne oder dass die fesselnde Kraft der Schwere keine Gewalt habe über den Geist eines freien Menschen. (Seite 84)
Auch mit Spinoza beschäftigte sich Julian.
Er verstand immer noch nichts, außer dass alles eines war, aber irgendwie dann wieder nicht, und dass es Freiheit nicht gab, oder eigentlich doch, denn sie bestand eben darin, zu begreifen, dass sie nicht da war. (Seite 51)
Julians Kommilitonin Clara wurde von ihm schwanger, erlitt jedoch eine Totgeburt.
Seine nach viel zu langer Zeit fertiggestellte Dissertation veröffentlichte Julian unter dem Titel Vetering. Person, Werk und Wirkung, aber das Buch wurde verrissen, und er kaufte schließlich die Restauflage, damit der Verlag sie nicht einstampfen ließ.
Nachdem die Mutter sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben genommen hatte, verschaffte ihm Paul – der inzwischen bei Infotoy-Software beschäftigt war – eine Anstellung bei einer Versicherung. Die Arbeit machte Julian keinen Spaß, und seinen Chef konnte er nicht leiden. Seine Kollegin Andrea, mit der er eine Affäre begonnen hatte, sagte ihm unlängst, er brauche sie nicht mehr anzurufen.
Julian nimmt ein Taxi zu seiner Wohnung und achtet darauf, dass die Nachbarn ihn weder sehen noch hören. Kurz nach seiner Ankunft überrascht ihn allerdings sein Bruder, der vom Hotel in Italien angerufen wurde. Julian werde vermisst und sei möglicherweise ertrunken, hieß es. Paul gibt ihm Geld.
Wenn Sie noch nicht erfahren möchten, wie es weitergeht,
lesen Sie bitte vorerst nicht weiter.
Wie in Trance geht Julian durch die Straßen seiner Heimatstadt, bis er überrascht feststellt, dass er sich vor dem Gebäude der Versicherung befindet. Da Sonntag ist, braucht er nicht zu befürchten, dort jemand anzutreffen. Er fährt noch einmal mit dem Lift hinauf und geht in sein Büro. Dort wählt er Claras Nummer, meldet sich jedoch nicht und kommt sich wie ein Geist vor.
Hin und wieder hat Julian den Eindruck, von Wasser umgeben zu sein, und manchmal fühlt es sich so an, als streife ihn eine Schlingpflanze am Hals. Er spürt, wie er sinkt (S. 122f, S. 145).
Nachdem er seinen Vater im Krankenhaus besucht hat, ohne von dem Todkranken erkannt zu werden, lässt er sich von einem Taxifahrer zu einem Nachtklub bringen und fragt dort nach dem Geschäftsführer, denn aus Kinofilmen weiß er, dass die Betreiber solcher Etablissements auch gefälschte Pässe beschaffen können. Der Mann hinter dem Schreibtisch sieht Wöllner zum Verwechseln ähnlich und meint:
„Du glaubst wirklich, du bist dann frei, Julian?“ (Seite 125)
Immerhin händigt er Julian einen Pass aus und verlangt nichts dafür. Von dem Geld, das er von Paul bekam, kauft Julian eine Zugfahrkarte. In einem der Abteile fallen ihm ein dicker Mann und ein Junge auf. Während der Fahrt wird er auf dem Gang des Waggons von zwei Männern ausgeraubt (sie wollen nicht nur sein ganzes Geld, sondern auch seinen Pass) und niedergeschlagen. Als der Zug auf freier Strecke hält, springt er hinaus. Es ist kalt. Der Zug fährt wieder an; Julian versucht, aufzuspringen, schafft es jedoch nicht. Da geht er einfach zwischen den Schienen weiter.
Neben den Gleisen lag ein Kühlschrank, weggeworfen, geschwärzt von Rost, die Tür weit offen. (Seite 144)
Er kommt zu einem Bahnhof und wartet dort auf den nächsten Zug.
Vermutlich ist es kein Zufall, dass der Protagonist in „Der fernste Ort“ schlecht sieht. Julian stand von klein auf im Schatten seines älteren, erfolgreichen Bruders. Er verfügt weder über ein besonderes Talent, noch über ausgeprägte Interessen – selbst seine Gefühle für Frauen bleiben eher halbherzig – und kann auch keine Erfolge vorweisen. Ein Badeunfall in einem italienischen See scheint dem Versicherungsmathematiker die Möglichkeit zu eröffnen, seinen Tod vorzutäuschen und ein neues Leben zu beginnen. Erst nach und nach begreifen wir beim Lesen des Romans „Der fernste Ort“ von Daniel Kehlmann, dass Julian keine neue Chance hat, sondern stirbt.
Auf den ersten Blick wirkt „Der fernste Ort“ einfach, doch während der Lektüre merken wir, dass die scheinbare Einfachheit das Ergebnis einer ausgeklügelten Komposition ist, in der Daniel Kehlmann meisterhaft die Balance zwischen Wirklichem und Vorgestellten hält und die Zeitebenen wechselt. Leise und ohne Effekthascherei erzeugt er einprägsame Bilder, in denen auch Details präzise beobachtet sind. „Der fernste Ort“ ist ein beklemmender Roman über das Sterben, der an die Erzählung „Die folgende Geschichte“ von Cees Nooteboom erinnert, aber alles andere als ein Aufguss ist.
Nach Jerouen Vetering würden Sie übrigens vergeblich im Lexikon suchen; es handelt sich um eine fiktive Figur.
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2007
Textauszüge: © Suhrkamp
Daniel Kehlmann: Ich und Kaminski
Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt
Daniel Kehlmann: Ruhm
Daniel Kehlmann: F
Daniel Kehlmann: Tyll
Daniel Kehlmann: Mein Algorithmus und ich
Daniel Kehlmann: Lichtspiel