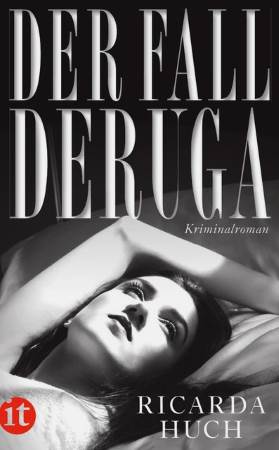Klaus Mann : Der Wendepunkt
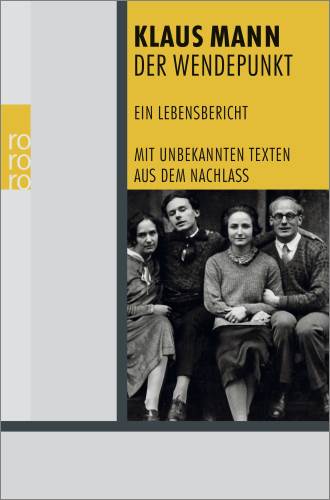
Inhaltsangabe
Kritik
„Woher stammt diese Unruhe in meinem Blut?“, fragt Klaus Mann zu Beginn seiner Autobiografie „Der Wendepunkt“. Von seinem Großvater Heinrich Mann (1840 – 1891), einem Senator der Hansestadt Lübeck? Der war zwar gestorben, bevor Klaus Mann geboren wurde, aber man wusste in der Familie selbstverständlich, dass er sich 1869 mit der elf Jahre jüngeren Julia da Silva-Bruhns („Dodo“, 1851 – 1923) vermählt hatte, der Tochter eines deutschstämmigen Farmers und einer Brasilianerin! Das war für einen Patrizier aus Bremen recht ungewöhnlich. Oder stammte die Unruhe, die Klaus Mann verspürte, von seiner schönen, lebensfrohen und musisch begabten Großmutter aus Übersee? Oder von Elisabeth (1838 – 1917), einer Schwester des Großvaters, die sich 1864 von Ernst Elfeld scheiden ließ, aber auch mit Gustav Haag, ihrem zweiten Ehemann, nicht auskam?
Heinrich und Julia Mann bekamen fünf Kinder: Heinrich (1871 – 1950), Thomas (1875 – 1955), Julia („Lula“, 1877 – 1927), Carla (1881 – 1910) und Viktor (1890 – 1949). Als der Senator und Getreidekaufmann am 13. Oktober 1891 starb, stellte sich heraus, dass sein Vermögen dahingeschmolzen war. Das Familienunternehmen wurde daraufhin aufgelöst; die Witwe Julia Mann zog mit ihren drei jüngeren Kindern nach München, und die beiden älteren Söhne Heinrich und Thomas folgten „nachdem sie sich irgendwie durch die Schule gemogelt hatten“ (Seite 12).
Heinrich und Thomas Mann wurden Schriftsteller. Klaus Mann behauptet, es sei beiden vor allem um „das Problem der gemischten Rasse, die schmerzlich-stimulierende Spannung zwischen dem nordisch-germanischen und dem südlich-lateinischen Erbe in ihrem Blut“ gegangen (Seite 12).
Aus diesem primären Konflikt entsprang ihnen ein zweiter, der Antagonismus zwischen „Bürger“ und „Künstler“: auf der einen Seite der Typ des gewöhnlichen und robusten Durchschnittsmenschen; auf der anderen der Entwurzelte, Gespaltene, von des Gedanken Blässe Angekränkelte – Hamlet, der Intellektuelle. Die Beziehung zwischen den beiden ist problematisch, doppeldeutig, geladen mit ambivalentem Gefühl. Eine recht eigentlich erotische Beziehung, wenn man Eros, im Sinne des Sokrates, als den Dämon der unstillbaren Sehnsucht, des dialektischen Spieles versteht.
Der „Bürger“, das heißt der normale Mann, der sich wohl fühlt in seiner Haut und in dieser Welt, ehrt und bewundert (wenngleich niemals ganz ohne misstrauische Reserve) die „Macht des Geistes“, die „erhabenen Ideale“, die „reine Schönheit der Kunst“, all jene sublimen Produkte moralischer Fragwürdigkeit, leidvollen Dienstes, stolz verborgener Qual. Der kreative Typ seinerseits empfindet eine seltsame Mischung aus Verachtung und Neid angesichts von so viel ahnungsloser Unschuld. Wie leicht, denkt er, muss das Leben sein für jene, die keinen Traum, keine Sendung haben! Glückliche Toren – sie wissen nichts vom Fluch der schöpferischen Manie, vom Martyrium der Auserwähltheit! […]
Beim jungen Heinrich Mann dominierte der künstlerische Stolz; seine Geringschätzung des Philisters – wenngleich zunächst durchaus vom Ästhetischen her bestimmt – hatte von Anfang an die gesellschaftskritisch-revolutionäre Nuance. So unbedingt und intensiv war diese Idiosynkrasie gegen den deutschen Spießer, den „Untertan“, dass sie zum Ausgangspunkt, zur Basis einer politischen Gesinnung weden konnte […]
Der jüngere der beiden Brüder hingegen war geneigt, die sehnsüchtige Zärtlichkeit für die Blonden und Lachenden inniger zu betonen als die sinnlich-übersinnlichen Ekstasen des Künstertums. Er war ein Bohemien mit schlechtem Gewissen, voll Heimweh nach den „Wonnen der Gewöhnlichkeit“, dem Paradies des wohlbehüteten Bürgerhauses. (Seite 12f)
Carla Mann vergiftete sich am 30. Juli 1910 im Alter von achtundzwanzig Jahren.
Sie nahm Gift im Hause ihrer Mutter, die auf dem Korridor zuhören musste, wie ihr Kind in der verriegelten Stube röchelte und verschied. (Seite 14)
Thomas Mann begegnete 1904 Katharina („Katia“) Pringsheim (1883 – 1980), der acht Jahre jüngeren Tochter einer der angesehensten und kultiviertesten Familien in München. Ihr Vater war der Mathematikprofessor Alfred Pringsheim (1850 – 1941); bei ihrer Mutter, der früheren Berliner Schauspielerin Hedwig Pringsheim (1855 – 1942), handelte es sich um die Tochter der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831 – 1919).
Die Pringsheims waren unter den Ersten, die sich in München ein Telefon und elektrisches Licht zulegten. Ihr Haus wurde bald zu einem Zentrum der intellektuellen und mondänen Welt. (Seite 17)
Die Mathematikstudentin Katia Pringsheim zögerte zunächst, auf das Werben des Schriftstellers einzugehen, der sich mit seinem Roman „Buddenbrooks“ bereits einen Namen gemacht hatte, aber am 11. Februar 1905 gab sie ihm das Jawort. Thomas und Katia Mann bekamen sechs Kinder: Erika (1905 – 1969), Klaus (1906 – 1949), Golo (1909 – 1994), Monika (1910 – 1992), Elisabeth (1918 – 2002) und Michael (1919 – 1977).
Als Klaus Mann am 18. November 1906 geboren wurde, lebte die Familie noch in München-Schwabing. Bald darauf zogen die Manns nach Bogenhausen und 1914 in eine Villa an der Isar. Ein 1908 erbautes Landhaus in Tölz, in dem Klaus Mann sich als Kind gern aufgehalten hatte, wurde 1918 verkauft.
Klaus Mann erinnert sich an seine Großeltern mütterlicherseits, „Ofey“ und „Offi“, die ein Haus in der Arcisstraße besaßen.
Sie waren charmante Leute, unsere Großeltern, solange man ihre Kostbarkeiten in Ruhe ließ und sich überhaupt hübsch artig bei ihnen aufführte. Offi war anmutig und majestätisch, Ofey steckte voll bizarrer Einfälle und kleiner Späße, von denen viele „nichts für Kinder“ waren. (Seite 49)
Die Eltern trugen die Kosenamen „Zauberer“ und „Mielein“.
Von neun Uhr morgens bis zwölf Uhr mittags muss man sich still verhalten, weil der Vater arbeitet, und von vier bis fünf Uhr nachmittags hat es im Hause auch wieder leise zu sein: Es war die Stunde der Siesta. (Seite 31f)
Schon mit geringeren Verfehlungen kann man den Vater erheblich irritieren. Es ist quälend, bei ihm in Ungnade zu sein, obwohl oder gerade weil sein Missmut sich nicht in lauten Worten zu äußern pflegt. Sein Schweigen ist eindrucksvoller als eine Strafpredigt […] Die Mutter zankt, wenn man Ungezogenheiten begeht […] Der Vater ist dazu imstande, so eklatante Übeltaten zu ignorieren, während scheinbar ganz harmlose Irrtümer ihn überraschend verdrießen können. Die väterliche Autorität ist unberechenbar. (Seite 32)
Das unzertrennliche Geschwisterpaar Erika und Klaus Mann besuchte von 1912 bis 1914 eine renommierte Privatschule in München. Weil die Familie während des Ersten Weltkriegs sparen musste, wechselten die beiden dann doch noch zu einer gewöhnlichen Volksschule.
Sie [Erika] etablierte sich schnell als eine Art von Anführerin und Häuptling unter den Mädchen, während meine Position in der Bubenklasse irgendwie unsicher blieb. Erstens konnte ich, im Gegensatz zu Erika, den Münchener Dialekt nicht sprechen […] Meine Klassengenossen hielten mich deshalb für einen „Saupreußen“, was fast ebenso schlimm war wie ein feindlicher Ausländer. Außerdem nahmen sie mir meine künstlerische Aufmachung und meine Abneigung gegen Raufereien übel. (Seite 67)
Not brauchten die Manns allerdings keine zu leiden. Sie führten nach wie vor einen großbürgerlichen Haushalt mit mehreren Dienstboten.
Wenn ich versuche, die Atmosphäre von 1914 wiedereinzufangen, so sehe ich flatternde Fahnen, graue Helme mit possierlichen Blumensträußchen geschmückt, strickende Frauen, grelle Plakate und wieder Fahnen – ein Meer, ein Katarakt in Schwarz-Weiß-Rot. Die Luft ist erfüllt von der allgemeinen Prahlerei und den lärmenden Refrains der vaterländischen Lieder […] Jeden zweiten Tag wird ein neuer Sieg gefreiert. Das garstige kleine Belgien ist im Handumdrehen erledigt. Von der Ostfront kommen gleichfalls erhebende Bulletins. Frankreich, natürlich, ist im Zusammenbrechen. Der Endsieg scheint gesichert: Die Burschen werden Weihnachten zu Hause feiern können. (Seite 65)
Kurz vor seinem zwölften Geburtstag erlebte Klaus Mann die Novemberrevolution.
Erstaunliches geschah. Unser Kaiser [Wilhelm II.] floh in Nacht und Nebel über die Grenze nach Holland. Auch der große Ludendorff und andere Helden machten sich aus dem Staube. Es war alles sehr überraschend und nicht ganz leicht zu verstehen. Deutschland war geschlagen und doch auch wieder nicht. Unser Professor sagte, es läge nur am „Dolchstoß“, für den die Juden und die Spartakisten verantwortlich seien. Die waren unserem Kaiser in den Rücken gefallen, gerade als alles zum besten stand und wir den Endsieg gleichsam schon in der Tasche hatten. (Seite 84f)
Nach der Ermordung des bayrischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner am 21. Februar 1919 herrschten in München chaotische Zustände.
In meiner Erinnerung wird diese kurzlebige „Räterepublik“ zur wüsten Farce. Ein grelles, klirrendes Tohuwabohu von schreienden Plakaten, Steinwürfen, Menschenansammlungen, improvisierten Rednertribünen, roten Fahnen und offenen Lastwagen voll verwegener Gestalten mit roten Armbinden. Die ganze Sache hatte einen Beigeschmack von wilder „Gaudi“ […], etwas Unernstes, Karnevalistisches. Freilich ging es bei diesem exzessiven Fasching nicht ganz ohne Terror ab; alle respektablen Bürger gerieten in einen Zustand von hysterischer Panik. Man erzählte sich Schauriges über geplünderte Banken, vergewaltigte Frauen und misshandelte Kinder. (Seite 86)
In diesen wirren Zeiten stellte sich heraus, dass es sich bei Josepha („Affa“), die als „Perle“ im Dienst der Familie Mann stand, um eine Kleptomanin handelte, die über Jahre hinweg alles Mögliche gestohlen hatte. Vor Gericht inszenierte sich die Beschuldigte allerdings in „einer knapp anliegenden Bluse aus grünem Atlas, unter dessen straffer Glätte ihr bedeutender Busen sich besonders schön profilierte“ (Seite 95) und wehrte sich mit einer „volkstümlichen Schlagfertigkeit“ so geschickt, dass sie freigesprochen wurde.
Mit rührender Eloquenz beschrieb sie, wie man versucht hatte, sie des Rotweins zu berauben. „Nur drei kleine Flascherln – das einzige Andenken, wo ich hab‘ von meinem Stiefbruder, dem seligen Fregattenkapitän, und da kommen diese Preußen daher, diese Ausbeuter, diese Großkopfeten, und wollen mir die drei Flascherln auch noch nehmen, wo’s doch den ganzen Keller voll haben von Schampus und Schnaps und was s‘ alles saufen …“ (Seite 95)
Zu den engsten Freunden von Erika und Klaus Mann zählten Richard („Ricki“) Hallgarten (1905 – 1932), der Sohn des Juristen und Germanisten Robert Hallgarten (1870–1924) und der Frauenrechtlerin Constanze Hallgarten (1881–1969), sowie Lotte und Marguerite („Gretel“) Walter (1903 – 1970; 1906 – 1939), die Töchter des Generalmusikdirektors Bruno Walter (1876 – 1962).
Musik war etwas Schönes und Erhebendes, besonders wenn Bruno Walter am Dirigentenpult stand; Theater war noch besser. Am weitaus besten war die Oper – beglückende Vereinigung von Drama und Symphonie, der vollkommene Kunstgenuss. (Seite 119)
Gemeinsam gründeten die Freunde 1919 einen Theaterbund, der innerhalb von drei Jahren acht Stücke im privaten Rahmen aufführte. Aber nicht alle ihre Tätigkeiten waren so kultiviert; häufig spornte sie der Reiz des Verbotenen zu Schandtaten an. Erika rief beispielsweise Frau Sanitätsrat Meyer an, gab sich als Stubenmädchen von Frau Doktor Ruderer aus und lud das Ehepaar Meyer in deren Namen zum Abendessen ein.
Erika verstand sich auf das Nachahmen aller möglichen Stimmen. Sie war wie einer jener Kobolde, die sich nach Belieben verwandeln und mit fremden Zungen reden können. (Seite 127)
Als der Theaterschauspieler Albert Fischel, mit dem sich Erika und Klaus Mann befreundeten, einmal über Diebstähle in seiner Kindheit flunkerte, luden ihn die Geschwister während der Abwesenheit ihrer Eltern zu einem Gastmahl ein, dessen Zutaten sie samt und sonders gestohlen hatten. Um die beiden zu disziplinieren, schickten die Eltern sie daraufhin im März 1922 in die reformpädagogische „Bergschule Hochwaldhausen“ bei Fulda.
Als drakonische Strafe empfand Klaus Mann das nicht. Im Gegenteil: Während Erika sich in München aufs Abitur vorbereitete, besuchte er ab September 1922 auf eigenen Wunsch die Odenwaldschule bei Heppenheim an der Bergstraße. Als er sich dort jedoch in seinen Mitschüler Uto verliebte, ängstigten ihn seine Gefühle so sehr, dass er seine verwunderten Eltern bat, vorzeitig zu ihnen zurückkehren zu dürfen (Juni 1923).
Die Berliner hielten München Anfang der Zwanzigerjahre für die Hochburg der Reaktion. Die Münchner waren dagegen überzeugt, „dass Berlin von einer Bande jüdischer Schieber und bolschewistischer Agitatoren regiert“ wurde (Seite 110). Mit siebzehn kam Klaus Mann zum ersten Mal in die Reichshauptstadt – und fand die „Romantik der Unterwelt“ so unwiderstehlich, dass er dort bleiben wollte. Nachdem er sich jedoch als Dichter auf einer Tingeltangel-Bühne blamiert hatte, nahm er den nächsten Zug zurück nach München.
Während die Inflation 1923 die Ersparnisse der Deutschen wertlos machte, beobachtete Klaus Mann eine paradoxe Reaktion der Betroffenen:
Millionen von unterernährten, korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazz-Delirium. Der Tanz wird zur Manie, zur idée fixe, zum Kult […] Ein geschlagenes, verarmtes, demoralisiertes Volk sucht Vergessen im Glanz. Aus der Mode wird die Obsession; das Fieber greift um sich, unbezähmbar, wie gewisse Epidemien und mystische Zwangsvorstellungen des Mittelalters. (Seite 164f)
Klaus Mann brach den Privatunterricht ab, den er inzwischen im Elternhaus bekam, denn er wollte ein weltberühmter Tänzer werden, und was sollte er da mit dem Abitur?! Kurz darauf beschloss er, sich als Schriftsteller zu versuchen. Mit achtzehn begann er, Theaterkritiken für das „Zwölf-Uhr-Mittagsblatt“ in Berlin zu schreiben, und 1925 erschien sein erstes Buch, ein Band mit Erzählungen unter dem Titel „Vor dem Leben“.
Im Juni 1924 verlobte sich Klaus Mann mit Pamela Wedekind (1906 – 1986), der Tochter des verstorbenen Dramatikers Frank Wedekind (1864 – 1918) und dessen Witwe Tilly (1886 – 1970). Am 22. Oktober 1925 stand das Paar zusammen mit Erika Mann und Gustaf Gründgens (1899 – 1963) bei der Hamburger Premiere des Stücks „Anja und Esther“ von Klaus Mann auf der Bühne. Während die Uraufführung zwei Tage zuvor in München ein Misserfolg gewesen war, spielten die jungen Leute in Hamburg jeden Abend vor vollem Haus. Weil es in dem „romantischen Stück in sieben Bildern“ um lesbische Liebe ging, galt es als skandalös. (Erika Mann und Gustaf Gründgens vermählten sich am 24. Juli 1926, ließen sich aber am 9. Januar 1929 wieder scheiden.)
In Paris befreundete sich Klaus Mann mit dem französischen Dichter René Crevel (1900 – 1935), der gegen seine Mutter und die Bourgeoisie rebellierte:
Er verbrachte seine Tage mit Amerikanern, Deutschen, Russen und Chinesen, weil seine Mutter alle Ausländer für kriminelle oder pathologische Subjekte hielt. Er trank Whisky und Gin, da der Geruch davon ihr Übelkeit erregte. Er hasste das Christentum, weil sie zur Kirche ging. Sie war nationalistisch; er machte respektlose Witze über la douce France und ihre heiligsten Güter. Madame war Puritanerin; er schockierte sie mit Obszönitäten. Es machte ihm Vergnügen, in großer Gesellschaft über den Selbstmord seines Vaters zu scherzen, denn er wusste, dass die Witwe diese Familienschande zu cachieren suchte. Nicht genug damit, dass Monsieur Crevel senior sich umgebracht hatte (Madame fand ihn eines Abends erhängt in ihrem Salon, wo sie gerade einige besonders distinguierte Gäste empfangen wollte) – er war auch verrückt gewesen, ein Syphilitiker im letzten Stadium, wenn man dem schaurig aufgekratzten Bericht des Sohnes Glauben schenken durfte. Eine charmante Idee, nicht wahr, unter solchen Umständen ein Kind in die Welt zu setzen!
„Meine gute Mama war zu gottesfürchtig, um mich abzutreiben“, erklärte der Sohn mit verzweifelter Munterkeit, „obwohl sie wusste, dass ich krank sein würde … Die Sünden der Väter. Man kennt das. Ich muss nun büßen für die Laster des alten Herrn – und die Tugend seiner Gemahlin.“ (Seite 222)
Weil Pamela Wedekind inzwischen beabsichtigte, den achtundzwanzig Jahre älteren Dramatiker Carl Sternheim (1878 – 1942) zu heiraten, scheiterte ihre Beziehung mit Klaus Mann.
Der reiste 1927 mit seiner Schwester Erika in die USA. Während sie von New York begeistert waren, fanden sie Los Angeles und vor allem Hollywood enttäuschend.
Hollywood […] wirkte auf uns wie eine Provinzstadt, die verzweifelte Anstrengungen macht, Hollywood zu imitieren […]
Wir hatten uns das Leben in Hollywood zwanglos-heiter vorgestellt. Ein naiver Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte! Tatsächlich herrscht unter Filmleuten ein Zeremoniell von chinesischer Starrheit und Kompliziertheit, ein Kastensystem, welches nur Personen von gleicher Nationalität und ungefähr gleichem Einkommen miteinander in Kontakt kommen lässt. (Seite 248ff)
Während eines Besuchs bei dem deutschen Schauspieler Emil Jannings (1884 – 1950) in Hollywood fiel ihnen eine Schwedin auf, die wie Erika Mann zweiundzwanzig Jahre alt war.
Man saß beim Whisky auf der Terrasse nach dem Abendessen. Plötzlich war sie da – eine atemberaubende Erscheinung […] „Ich bin ja so furchtbar müüüde!“, rief sie uns, statt eines Grußes, mit tiefem Klageton zu […], wobei sie sich auch schon in einen Sessel warf. Abgewendeten Hauptes, die Mundwinkel tragisch gesenkt, verlangte sie einen Schnaps: „Aber einen großen, Emil! Einen doppelten!“
Ihr Anlitz unter der Löwenmähne war von verblüffender Schönheit, das schönste Gesicht, wollte mir scheinen, das ich jemals gesehen; und in der Tat ist mir ein schöneres bis auf den heutigen Tag nicht begegnet […]
Mit grollender Pythia-Stimme forderte sie einen zweiten Whisky und erklärte dann, zur allgemeinen Überraschung, dass sie nun tanzen wolle. Sie tanzte einen Tango mit der Tochter des Hauses […]
Nach dem Tanz ließ sie uns mit sonorem Jammerlaut wissen, dass sie sich nun entschieden besser fühle. „Ich danke euch allen“, sprach sie nicht ohne Feierlichkeit. „als ich kam, war ich furchtbar müüüde; aber jetzt geht es mir gut […]“ Und sie verschwand im düfteschweren Dunkel der kalifornischen Nacht […]
„Das Mädel wird ein Bombenerfolg“, prophezeite Emil mit fachmännischem Respekt. „Die setzt sich durch, wartet nur! In zwei bis drei Jahren kennt die ganze Welt ihren Namen.“
Ihr Name war Greta Garbo. (Seite 251f)
Von Amerika brachen Klaus und Erika Mann zu einer Weltreise auf (Japan, Korea, UdSSR). Erst nach insgesamt acht Monaten kehrten sie in die Heimat zurück.
Seit Jahren sollte Thomas Mann Gerüchten zufolge mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet werden. 1929 war es endlich so weit.
Als das längst vorausgesagte Ereignis dann endlich eintraf, hob der Vater nur die Augenbrauen: „Ist es diesmal ernst?“ (Seite 281)
Mit dem Nationalismus, der nach dem Ersten Weltkrieg immer stärker aufkam, konnte Klaus Mann nichts anfangen.
Ich fühlte mich der Nation nicht zugehörig. Schon deshalb nicht, weil ich den Begriff des Nationalstaates überhaupt als überholt empfand und an die Notwendigkeit übernationalen Zusammenschlusses glaubte. Kein anderer Nationalismus aber erschien mir so unselig und dabei so lächerlich wie eben der deutsche, mit seiner „Meistersinger“-Biederkeit und seiner „Tristan“-Schwüle, seinem säbelrasselnden Draufgängertum und seiner schluchzenden Sentimentalität, seinem ewig-unbefriedigten Anspruch, seinem überkompensierten Inferioritätskomplex, seiner primitiven Tücke und gerissenen Naivität, seinem Dünkel, seinem Verfolgungswahn, seiner ganzen quälenden, sterilen Problematik. (Seite 338)
Was die Nationalsozialisten dachten, konnte Klaus Mann erst recht nicht verstehen.
Mir wollte es nicht in den Kopf, dass die Deutschen Hitler allen Ernstes für einen großen Mann, ja für den Messias halten könnten. Der und groß? Man brauchte ihn doch nur anzusehen! (Seite 333)
Zufällig geriet er 1932 in der „Carlton“-Teestube in München an Hitlers Nachbartisch.
Da saß er, umgeben von ein paar bevorzugten Spießgesellen, und ließ sich sein Erdbeertörtchen schmecken […] Er verschmauste noch ein Erdbeertörtchen mit Schlagrahm […], dann ein drittes – wenn es nicht schon das vierte war. Ich esse selbst recht gerne süßes Zeug; aber der Anblick seiner halb infantilen, halb raubtierhaften Gefräßigkeit verschlug mir den Appetit […]
Chaplin hat Charme, Anmut, Geist, Intensität – Eigenschaften, von denen bei meinem schlagrahmschmatzenden Nachbarn durchaus nichts zu bemerken war. Dieser erschien vielmehr von höchst unedler Substanz und Beschaffenheit, ein bösartiger Spießer mit hysterisch getrübtem Blick in der bleich gedunsenen Visage. Nichts, was auf Größe oder auch nur auf Begabung schließen lassen konnte!
[…] Die Vulgarität seiner Züge beruhigte mich, tat mir wohl. Ich sah ihn an und dachte: Du wirst nicht siegen, Schicklgruber, und wenn du dir die Seele aus dem Leibe brüllst. (Seite 334f)
Am 1. Januar 1933 eröffneten Erika und Klaus Mann, Therese Giehse (1898 – 1975) und Magnus Henning (1904 – 1995) in der „Bonbonniere“ am Platzl in München das Kabarett „Die Pfeffermühle“.
Als Adolf Hitler am 30. Januar Reichskanzler wurde, dachten viele, er sei in der Hand der Schwerindustrie und des Generalstabs. Spätestens nach dem Reichstagsbrand stellte sich jedoch heraus, dass sie sich geirrt hatten.
Am 12. März 1933 reiste Erika Mann zu den Eltern, die sich gerade in der Schweiz von einer Vortragstournee Thomas Manns erholten. (Am 1. Oktober 1933 eröffnete sie „Die Pfeffermühle“ in Zürich.) Klaus Mann verließ München am folgenden Tag und setzte sich nach Paris ab. Am 6. November 1934 erfuhr er aus der Presse, dass ihm die Nationalsozialisten die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt hatten.
Im September 1938 emigrierten die Manns in die USA.
Ende 1941 trat Klaus Mann in die US Army ein – und wunderte sich über die Ignoranz seiner amerikanischen Kameraden. In einem Brief vom 14. Februar 1943 an Erika schrieb er:
Dass Amerika den Krieg gewinnen wird, gilt allgemein als selbstverständlich; was aber die Probleme und Umstände betrifft, die zum Kriege geführt haben, so herrscht eine erstaunliche Ahnungslosigkeit […] Skeptische Ignoranz ist nicht zu überzeugen, nicht zu beunruhigen, nicht zu erschüttern. Konzentrationslager? Gestapo-Terror? Überfälle auf schwache Nachbarn? Vertragsbruch? Massenmord? Welteroberungspläne? Der ignorante Skeptiker grinst und hebt die Schulter: „That’s just propaganda …“ Der ignorante Skeptiker amüsiert sich über Hitler und Mussolini – zwei harmlose Clowns, die zum Vergnügen der G.I.s auf der Leinwand gestikulieren und schwadronieren. Der ignorante Skeptiker findet den Nürnberger Parteitag „a pretty good show“, die Bücherverbrennungen „a lot of fun“. Pfui-Rufe gab es nur für die Japaner, die man wirklich nicht besonders gerne hat: „Pearl Harbor“ wird ihnen doch ein wenig nachgetragen, und übrigens sind sie „farbig“, was als verächtlich gilt. (Seite 585f)
Entsetzt beobachtete Klaus Mann den Rassenhass in den USA und verglich ihn mit dem Antisemitismus in Europa.
Nachdem er die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, wurde er Ende 1943 als Angehöriger einer Einheit zur psycholoischen Kriegsführung zunächst nach Nordafrika, dann nach Italien versetzt.
Am 11. Mai 1945 gehörte er als Korrespondent der Armeezeitung „The Stars and Stripes“ zu den Journalisten, die den festgenommenen Hermann Göring in Augsburg interviewen durften.
Seinem Vater teilte er fünf Tage später in einem Brief mit, dass die Villa in München noch stehe, aber das Innere verwüstet sei.
Richard Strauss (1864 – 1949) fragte er in Garmisch, warum er nicht emigriert sei. Der Komponist wies ihn darauf hin, dass er in Deutschland seinen Lebensunterhalt habe verdienen müssen. Wenn allerdings die Lebensmittelknappheit anhalte, werde er vielleicht doch noch in die Schweiz auswandern. Seine halbjüdische Schwiegertochter Alice klagte darüber, was sie im „Dritten Reich“ auszustehen gehabt habe:
„Durfte ich etwa jagen gehen? Nein! Sogar das Reiten war mir zeitweise verboten … “ (Seite 650)
Da musste Klaus Mann daran denken, dass die Nationalsozialisten die Tänzerin und Bildhauerin Oda Schottmüller (1905 – 1943), eine seiner Mitschülerinnen in der Odenwaldschule, am 5. August 1943 in Berlin-Plötzensee enthauptet hatten, weil sie zur „Rote Kapelle“ gehört hatte.
Nazis, so stellt sich jetzt heraus, hat es in Deutschland nie gegeben; selbst Hermann Göring war im Grunde keiner. Lauter „Innere Emigration“! Plötzlich entdecken alle ihre demokratische Vergangenheit und, wenn irgend möglich, ihre „nichtarische“ Großmama. Jüdische Ahnen sind enorm gefragt. (Seite 658)
Am 1. Juli 1945 berichtete er in einem Brief über einen Besuch bei Emil Jannings:
Von Salzburg aus fuhr ich eines Tages zum Wolfgangsee, wo ich in seinem schönen, reichen Haus alles wie früher fand: Chow-Hund und Papagei, Frau Gussy, Fräulein Ruth und Emil selber, dick und jovial, ein Biedermann mit falschen, kleinen Augen und schweren, hängenden, dabei beweglichen und expressiven Zügen. – „Ich – ein Nazi?“ Die Idee schien ihm belustigend, aber zugleich empörend. „Haha, mein Junge! Da kennst du aber deinen Emil nicht!“ […] Ein Verfolgter war er gewesen! Ein Märtyrer – Goebbels hatte ihn gehasst – vor allem wegen der schlechtrassigen Großmama, aber auch, weil unser Emil die demokratischen Ideale nicht verleugnen wollte. „Du weißt ja, wie ich bin!“ Sein Gesicht, gar zu nah dem meinen, war von einer Redlichkeit, wie man sie höchstens bei sehr alten Hunden findet. „Ich kann den Mund nicht halten.“ Jetzt auch noch feuchte Augen! Offenbar, er hatte nichts verlernt, war schauspielerisch in großer Form geblieben. (Seite 658f)
Unter dem Titel „The Turning Point. Thirty-Five Years in this Century“ veröffentlichte Klaus Mann im Herbst 1942 in New York nach „Kind dieser Zeit“ (Berlin 1932) seine zweite Autobiografie. Zehn Jahre später erschien im Verlag S. Fischer in Frankfurt am Main „Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht“. Wie Klaus Mann im Nachwort betont, handelt es sich dabei nicht einfach um eine Übersetzung des Buches „The Turning Point“, sondern um „ein neues deutsches Buch“ mit Ergänzungen und Erweiterungen, so zum Beispiel zusätzlichen Zitaten aus Tagebüchern und Briefen. Während „The Turning Point“ mit einer Tagebuch-Notiz vom Juni 1942 endet, beschließt Klaus Mann „Der Wendepunkt“ mit einem Brief vom September 1945.
Sowohl in „The Turning Point“ als auch in „Der Wendepunkt“ schildert Klaus Mann persönliche Erlebnisse chronologisch vor dem Hintergrund des Zeitgeschehens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dabei referiert er nicht abstrakt über das politische Geschehen – Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit –, sondern er beleuchtet bezeichnende Facetten in einprägsamen Szenen.
„Der Wendepunkt“ erzählt ein Leben, beschreibt ein Generationen-Schicksal, illustriert eine Epoche (und deren Umschwung) – bleibt also, ungeachtet seines Bekenntnis-Charakters, um verlässliche Zeugenaussage bemüht […] (Walter Jens im Begleitheft zu der Ausgabe von „Der Wendepunkt“, die in der von ihm und Marcel Reich-Ranicki herausgegebenen „Bibliothek des 20. Jahrhunderts“ erschien)
Bei der Lektüre wird deutlich, dass es sich bei Klaus Mann um eine außergewöhnliche Persönlichkeit in einem Umfeld exzeptioneller Menschen handelte. Einige dieser faszinierenden Verwandten, Freunde und Bekannten werden von Klaus Mann beschrieben, wobei er stets das Wesentliche, Charakteristische erfasst und es in der Darstellung auf den Punkt bringt. „Der Wendepunkt“ enthält eine ganze Reihe von brillanten Miniaturen. Überhaupt lassen Esprit und geschliffene Formulierungen den Text funkeln.
„Der Wendepunkt“, im hohen poetischen Stil klassischer Bildungsromane beginnend, geprägt durch Meisterschaft im Nachzeichnen der Atmosphäre und der filigranartigen Personenbeschreibung, ist ein Bürger-Buch, das, den Vor-Schriften von Vater und Onkel verpflichtet, den Untergang der Bourgeoisie, ihr Ende in Laster und politischer Selbstaufgabe, beschreibt. (Walter Jens, a. a. O.)
Bemerkt man, wie sich, mit wechselnden Zeiten, der Stil des Buches verändert? Wie poetisch-breite Beschreibung, impressionistisch ins Gerade-noch-Moderne gewendet: mit virtuoser Stimmungsmalerei und Porträtierungskunst, überschwappt in ekstatische Rede; wie der Tonfall, hektischer werdend, sich dem Inhalt anpasst? (Walter Jens, a. a. O.)
Ab 1940 (Seite 524) zitiert Klaus Mann aus Tagebüchern und Briefen. Da gibt es zwar auch noch einige prägnante Porträts berühmter Zeitgenossen, aber die Gestaltungskraft, die sich in den ersten zehn Kapiteln zeigt, erreicht Klaus Mann auf den letzten 150 Seiten von „Der Wendepunkt“ nicht mehr. Vielleicht hätte er die deutschsprachige Autobiografie ebenso wie „The Turning Point“ im Jahr 1942 enden lassen sollen. Allerdings würden dann die maliziösen Schilderungen der Besuche bei Richard Strauss in Garmisch und bei Emil Jannings am Wolfgangsee fehlen.
„Der Wendepunkt“ gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Ulrich Nöthen und mit Originalaufnahmen von Klaus Mann (13 CDs, Der Hörverlag, 2004, ISBN 978-3895849589).
Der Rowohlt Verlag veröffentlichte 2006 eine von Fredric Kroll herausgegebene und kommentierte Neuausgabe von „Der Wendepunkt“ mit Textvarianten und Entwürfen (895 Seiten, ISBN 978-3499244094, 12.90 €).
nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)
Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2008
Textauszüge: © edition spangenberg
Klaus Mann (Kurzbiografie)
Erika Mann (Kurzbiografie)
Gustaf Gründgens (Kurzbiografie)
Heinrich Breloer: Die Manns
Klaus Mann: Mephisto
Klaus Mann: Der Vulkan (Verfilmung 1999)